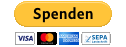Individualität ist ein Trugschluss.
Ihr werdet individuell, um das Ganze voranzubringen.
Ihr seid ein Teil des Ganzen.
Das Ganze sind die Menschheit und über ihr das Leben.
Euer – unser – Wunsch nach Individualität ist ein Trick des Ganzen, euch dazu verleiten eure persönlichen Fähigkeiten, Anlagen, herauszuarbeiten.
Habt ihr dies getan, eure Veranlagung zu eurer sogenannten Individualität gebracht, so sterbt ihr.
Etwas von euch, eure Individualität, lebt weiter.
Sie hat das Ganze verändert und wurde Teil von ihr.
Ihr wart immer Teil und wertet immer Teil bleiben.
Dies ist euer Sinn – dies ist eure Unsterblichkeit.
Aphorismus 77: Individualismus als Trick des Ganzen
Juli 26, 2009Aphorismus 75: Freiheit im Kapitalismus
Juli 20, 2009Im Kapitalismus ist man erst frei, wenn man es sich leisten kann.
Bis dahin kann man kaum mehr als ein eingesperrtes Haustier der Reichen und Mächtigen sein; ihrer Gnade ausgeliefert.
Der Preis der Freiheit
Februar 9, 2009Anmerkungen zur Aussprache:
Mandraz – Man-dras
Majezir – Ma-ʒä-sir
Deljezir – Del-ʒä-sir
Delnadraz – Del-na-dras
Delenti – De-len-ti
Caduim – Ka-dwiim
I
Blutrot versank die Sonne hinter den fernen Bergen. Rot vom Blut der Erschlagenen färbte sich die Küste des schäumenden Meeres. Mandraz beobachtete das Schauspiel aus der Ferne. Mit seinen engsten Vertrauen stand er auf einer Anhöhe in sicherer Entfernung. Niemand von ihnen wagte ein Wort zu sagen. Sie alle wussten, was auf dem Spiel stand. Nicht nur ihr eigenes Leben, auch das ihrer Angehörigen könnte von dieser Schlacht abhängen. Dort unten kämpfte jedoch keiner ihrer Leute. Doch würde dieser Stamm von der Küste nicht den Sieg davon tragen, so würden auch sie niemals frei sein. Hier in Delent kämpfte jeder gegen jeden und vor allem jeder gegen den verhassten Adel. Niemand wusste, was nach dem Sieg kommen würde, doch sie alle wollten die Freiheit. Freiheit und Macht. Seit vielen Jahren tobte der Krieg nun schon in Delent. Mandraz und seine Vertrauten träumten schon ebenso lange davon, ihren Kindern eine freie Welt zu zeigen.
Mandraz blickte zurück in Richtung der untergehenden Sonne. Sein Dorf lag dort im Schatten der schroffen Berge und wartete auf ihn. Er würde alles tun, um die Seinen zu beschützen. Als seine Begleiter unruhig wurden, sah er wieder zum Kampf. Dieser hatte sich nun entschieden; Tote lagen an der Küste, wie gefallenes Heu nach der Ernte. Sieger durchschritten ihre Reihen wie Raben auf der Suche nach Beute. Flüchtlinge wurden gejagt und niedergemacht, überlebende Verletzte wurden ertränkt. Und dann sah Mandraz, wer da gesiegt hatte. Und sie alle zusammen verfielen in einen Freudentaumel.
II
Endlich waren sie in den Schutz des Tales gelangt. Als ihr Gastgeber hieß es sie mit offenen Armen willkommen. Eines nach dem Anderen wurden die Wagengespanne von den Ochsen vorwärts gezogen in die wartende Sicherheit. Hier würde man sie nicht mehr so leicht entdecken können. Caduim blieb zurück und wartete, bis der letzte Wagen außer Sicht von Delenti war, bevor er einen abschließenden Blick zurück warf. In der weiten Ferne war Delenti nur noch an der schwarzen Rauchsäule zu erkennen, die von den lodernden Ruinen aufstieg. Es war früher Morgen eines schönen Frühjahrstages und das Jahr war 650.
Ein Krieger erschien am Eingang des Tales, sah Caduim, hielt auf ihn zu und begrüßte ihn.
„Halte dich nicht damit auf! Sprich, was gibt es zu berichten?“ fragte dieser ihn.
Der Krieger sah ihn düster an. Sein Wams war zerschlissen, seine Rüstung starrend vor Dreck und Blut, er selber nicht minder besudelt.
„Nichts Gutes, so fürchte ich“, hob er an, „zumindest nicht von dort hinten. Wir haben sie aufgehalten. Aber außer mir scheint es kaum jemand geschafft zu haben. Wenn noch jemand lebt und uns treu ist, wird er uns in Deljezir erwarten.“
Cadium blickte ihn traurig an. Seine Heimat war zerstört, die meisten seiner Leute und Freunde nun tot und der Rest auf der Flucht.
„Und du bist sicher, dass niemand unsere Flucht bemerkt hat?“
„Sehr sicher. Wir haben ihnen eine schöne Jagd mit abschließender Schlacht geboten.“
„Dann komm. Lass uns zu den Wagen aufschließen. Es ist eine weite Reise bis Deljezir und wir dürfen nicht trödeln.“
Es war noch nicht lange Frühjahr geworden. Die Lehmwege waren feucht und die Erde hatte sich in Schlamm verwandelt, der habgierig nach den Rädern ihrer Wagen griff. Immer wieder mussten sie Halt machen, immer wieder einen der fünf Dutzend Karren aus dem Dreck ziehen. Alle packten dabei an – die Krieger, die Adligen, die Handwerker, die Frauen, selbst die Kinder. Trotzdem kamen sie nur schleichend voran. Caduim und die Anderen berittenen Krieger erkundeten die Gegend vor, neben und hinter der Kolonne. Dies verhinderte aber nicht, dass sie am dritten Tage ihrer Reise angegriffen wurden. Es war Nacht. Kinder und Frauen schliefen auf den Wagen, die Männer unter ihnen. Zwei Wagen gingen in dem wilden Angriff verloren, doch konnten Caduim und die Anderen Schlimmeres verhindern. Im Dämmerlicht des jungen kühlen Frühjahrsmorgens erkannte man, dass die Angreifer nur Räuber gewesen waren. Die Kolonne musste sich eilen, sollte sie nichts Ärgerem begegnen. Manchmal ritt Caduim an den Reihen der Flüchtlingen vorbei. Dann sah er erschöpfte, leidende und doch hoffende Gesichter. Sie alle vertrauten auf den König und seine Männer. Und diese Hoffnung sollte nicht unvergolten bleiben.
Am nächsten Tag kreuzten sie einen Fluss, den die Schneeschmelze des Frühjahrs in einen reißenden kleinen Strom verwandelt hatte. Dies stellte sie vor ein schwerwiegendes Problem. Caduim wusste, was dieser Fluss verhieß: Das rettende Land des Königs an seinem anderen Ufer. Doch konnten die Wagen seine nun rauschenden Wogen nicht gefahrlos durchqueren. Caduim gab Befehl, Holz des umgebenden düsteren Waldes für Flöße zu fällen, da griff man sie erneut an. Aus dem Schutz der alten Bäume kamen sie brüllend wie die Fluten eines Bergstromes über sie her. Kinder schrien auf und wurden von ihren Müttern unter die Wagen gezerrt, wo sie sich in den Schlamm kauerten. Die Männer griffen nach allem, was man als Waffe nutzen konnte. Diese Angreifer aber waren keine Räuber und Caduims Männer wären ihnen unterlegen gewesen. Doch wie durch ein Wunder trafen zu dieser Zeit am anderen Ufer die Krieger des Königs ein. Pfeile stürzten wie Ungeziefer über die Feinde, die nun eiligst die Flucht ergriffen, ihr Leben zu retten. Jetzt war eine Überquerung des Flusses kein Problem mehr, denn die Männer hatten Flöße bereit. Auf wackligem, glitschigen Untergrund schafften es alle Wagen unbeschadet ans andere Ufer.
„Ihr habt uns gerettet!“ sprach Caduim froh zum Anführer der Krieger und als er diesen an seinem großen schwarzen Bart erkannte, umarmte er glücklich seinen Bruder.
Am Abend erreichten sie Deljezir. Die Stadt war die letzte Verbliebene, die dem König noch die Treue hielt, nun, da Delenti zerstört war. Ganz Deljezir brummte und pochte als ein Lebewesen, überquellend mit Flüchtlingen aus allen Himmelsrichtungen. Für die einfachen Menschen war hier das Ziel ihrer Reise. Caduim, seine Männer und die Adligen jedoch hatten noch eine Tagesreise vor sich.
„Seit einem Jahr erst ist die Burg Majezir vollendet“, wurde Caduim Abends in einer Schenke Deljezirs von seinem Bruder aufgeklärt, „draußen im Moor. Jede Armee aus dem Norden, die nach Deljezir will, müsste an ihr vorbei. Dort sind der König und die verbliebenen Adligen und Krieger. Sie erwarten euch bereits.“
Und so kamen sie am nächsten Tag zur Burg Majezir, der letzten Verteidigerin des Königreiches, Herrin ihrer aller Freiheit und Leben. Trutzig erbaut inmitten des bedrohlichen Moores war sie auf allen Seiten von Seen umgeben. Nur über knarrende Zugbrücken konnte man sie erreichen. Die einzige sichere Furt durch den Fluß lag in Sichtweite von Majezir. Wer immer nach Deljezir gelangen wollte, musste an der Burg vorbei. Wer immer an den König gelangen wollte, musste in die Burg hinein. Beides versuchten Frühjahr und Sommer hindurch immer wieder feindliche Armeen. Eine nach der Anderen verzweifelte an der unerreichbaren Burg. Niemandem gelang es, zu Deljezir oder dem König vorzudringen. Derweil eilten sich dessen Boten, die Hoffnung des Reiches, nach Verbündeten zu suchen, die Aufständischen des Nordens zu besiegen.
„Herr“, wurde Caduim eines Morgens von einem kleinen Knaben angesprochen, „was ist Frieden?“
„Wieso stellst du diese seltsame Frage?“ entgegnete Caduim verwundert.
„Meine Eltern sprechen immer davon, dass sie sich Frieden wünschen“, sprach der Knabe in kindlicher Scheuheit und Caduim beugte sich zu ihm herunter.
„Weißt du, sobald wir gesiegt haben oder die Aufständischen ihren Fehler bemerken, ab da wird es Frieden für uns geben und niemand muss mehr kämpfen.“
„Keine Kämpfe?“ sprach da der Knabe ungläubig.
Der Junge glaubte ihm nicht, lachte kurz sein kindliches Lachen und verschwand dann im Burghof, wo er mit anderen Kindern spielte. Caduim sah ihnen eine Weile traurig zu.
III
Sie hielten sich im Dickicht unweit des Flusses versteckt. Gefrorene Blätter krachten unter ihren Füßen. Ihr Atem kam in Rauchwolken. Mandraz stapfte durch den Schnee zurück zu den anderen Stammesführern. Sie alle waren hier gleich, trotzend jeglicher früherher Meinungsverschiedenheiten, und zitterten in der Kälte. Selbst die vielen Schichten Kleidung, Rüstung und Felle auf ihnen konnte die unnatürliche Strenge des Windes nicht beschwichtigen. Endlich hatte man sich geeint, endlich zog man zusammen gegen den Feind. Mandraz dachte daran, wie seine Familie Daheim in ihrer zugigen Hütte hausen musste, die schon etliche Male in diesen Kriegen zerstört worden war. Nun sollte sich dies ändern, bald könnte man sich Steinhäuser leisten wie der König. Das ganze Jahr über war man vergeblich immer und immer wieder gegen Majezir angebrandet, doch nie kam man auch nur über die Seen. Alle, die andere Wegen zu gehen versuchten, fanden ihr Schicksal auf dem Grund des Moores. Jetzt aber war dieses Schicksal auf ihrer Seite. Was zuvor noch ein unüberwindbares matschiges Hindernis gewesen war, bot sich nun als glitschig vereistes Feld an.
Es wurde Mitternacht und der weiße Mond beschien die weite weiße Winterlandschaft. Mandraz und die anderen gaben Zeichen und die Meute machte sich auf den Weg. Sie stürmten die Seen, umzingelten die Burg. Haken unter den Schuhen gaben ihnen Halt, andere rutschten einfach vorwärts. Etliche fielen im Pfeilhagel, doch konnte man ihre vordringenden Leitern nicht aufhalten. Wie Raubtiere erklommen sie mit ihnen die Mauern und strömten in die Burg hinein. Ein Krieger mit großem schwarzen Bart wollte Mandraz aufhalten, doch dieser hielt sich kaum auf, ihm die Kehle aufzuschlitzen. Vor niemandem machten die Angreifer Halt. Krieger, Diener, Adlige, Männer, Frauen und Kinder – sie machten keinen Unterschied, alle waren sie Teil des verhassten Königreiches, alle dienten sie dem König. Alle mussten sie sterben, sollte es jemals enden. Der König selber wurde von Mandraz gestellt, wie er gerade fliehen wollte. Und als kein Feind mehr in den Mauern von Majezir lebte, stimmten die Angreifer ihr Siegesgeheul an. Endlich hatten sie ihre Freiheit errungen, endlich hatten auch ihre Kinder eine Zukunft.
Doch dies war noch nicht das Ende der Geschichte. Nicht alle Adligen waren in Majezir gewesen. Einige hatten sich schon früher verkrochen, andere waren zufällig zur Zeit der Schlacht außer Haus. Wenige Jahre lang sollte man sie noch in ganz Delent wie Vogelfreien jagen und niedermachen. Einer der Überlebenden der Nacht des Überfalles war ein Mann namens Caduim. Ihm war es zu verdanken, dass letztlich Frieden herrschen sollte, die Adligen neben dem freien Volk leben durften. Doch bis dahin war viel zu tun.
Auf den kältesten Winter in der Erinnerung der Leute dieser Gegend folgte das mildeste Frühjahr. Die Burg Majezir wurde von der Natur erobert und für immer von ihr einbehalten. Das Frühjahr sah alles neu im Lande Delent.
ENDE
——–
Kommentar
Delent war einst eines der großen alten Juepenreiche. Mächtig war es und die Legenden erzählten von Wundern. Doch der Aufstieg Iotors im Norden traf es hart. Fast der gesamte Norden wurde erobert. Während es dem Osten gelang, sich bald wieder von Iotor freizukämpfen und als das Reich Sagaja noch für Jahrtausende bestand, verfiel der Süden immer mehr. Es gab einen Aufstand nach dem Anderen, das Land wurde zum düsteren Schreckensreich. Gut 50 Jahre sollten die Kriege in Delent gedauert haben und am Ende stand das Königshaus vor dem Nichts. Die Flucht zur Burg Majezir verlängerte ihr Leben nur um ein Jahr. Nie wieder sollte Delent mächtig werden. Der Preis der Freiheit war für das Volk von Delent ihr Niedergang.
Die Geschichte selber stammt aus der Feder eines unbekannten Schriftstellers und gibt die tatsächlichen Geschehnisse wieder, natürlich um einiges ausgeschmückt.
Tonn Onasi, Jagâharis von Raygadun
Raygadun, Aleca, 22.01.3995
Die Illusion der Liebe
November 1, 2008Was ist Liebe? das fragte sie sich oft
Werd ich lieben?
Ich liebe dich, sagte sie ihm.
Ja, sie liebte ihn. Er gab ihr Sicherheit, Geborgenheit, Nähe und die schönsten Gefühle beim Sex. Und ging seine eigenen Wege, wenn sie es brauchte.
Ich liebe dich, sagte auch er.
Und ab da war alles anders.
Warum nur ist er so klammernd? Warum will er dauernd bei mir sein?
Ich habe Angst vor seiner Nähe.
Da ist ein anderer. Bei ihm bekomme ich Sicherheit, Geborgenheit, Nähe und das Gefühl geliebt zu werden – beim Sex.
Er liebt mich nicht – doch ich ihn.
Soll ich es ihm sagen?
Ja, ich sage es ihm.
Ich liebe dich auch, sagte er ihr.
Das ist schön.
Aber ich brauche meine Freiheit, ich will nicht andauernd bei dir sein.
Er kommt immer näher.
Ich verstehe das nicht. Ich liebe ihn doch nicht.
Und er war weg.
Es kam ein Neuer. Er wohnte weit weg.
Solang er da war bekam sie Sicherheit, Geborgenheit, Nähe und Liebe und Sex.
Doch lange blieb er fern, da sie weit auseinander wohnten.
Sie vermisste ihn. Ich liebe dich, sagte sie.
Ich liebe dich auch, so sagte er.
Und es war schön.
Doch sie vermisste ihn immer häufiger.
Schließlich ertrug sie es nicht mehr, alleine zu sein.
Sie lernte noch jemanden kennen.
Er benutzte sie.
Wo bleibt der Mensch für mein Leben? fragte sie sich.
Immer wieder dachte sie, jemanden zu lieben. Doch es entpuppte sich als Enttäuschung.
Ich liebe dich, denn du gibst mir Geborgenheit.
Ich liebe dich nicht, ich wusste nicht, dass du ständig Nähe brauchst.
Lass mich doch weglaufen, so lösen sich Probleme auch.
Ich liebe dich, sagte er.
Doch er liebte sie nicht. Er liebte die Nähe, die Geborgenheit, den Sex.
Mein kleines Spielzeug.
Was, du hast auch Gefühle?
Das wusste ich nicht.
Du bist gar nicht so schlecht, wie ich dachte.
Geh nicht, ich liebe dich!
Verschwinde, sprach sie.
Nie hat mich jemand geliebt.
Alle finden mich hässlich, meiden mich wegen meines Äußeren.
Doch dabei kann ich für dich Sorgen, für den Rest deines Lebens.
Verschwinde, du machst dich doch auch nur lustig.
Ich liebe dich, sprach er.
Und schon hatte er sie im Bett.
Sehnte nicht auch sie sich nicht nur nach Liebe?
Doch er gab sie ihr nicht. Schnell war er weg.
Es geht nur um Sex, sagte er ihr.
Aber ich liebe dich doch!
Wir sind nur Freunde, bitte.
Würde sie diese Idee doch aufgeben, wir könnten wirklich Freunde sein.
Ich liebe dich, sagte auch er.
Ich liebe dich, denn du bist ein guter Mensch.
Würde die Welt untergehen, mit dir wäre das Ende erträglich.
Ich liebe auch andere, genau so wie dich.
Doch würdest du ja sagen, ich bliebe bei dir.
Er liebt mich, sagte sie sich.
Ich hab ihn lieb, doch das wird zuviel.
Bitte, melde dich nicht! Lass mich heute mal in Ruhe!
Er hat sich schon eine Woche nicht mehr gemeldet. Ich mache mir Sorgen.
Wie geht es dir?
Oh, es ist schön mit ihm.
Vielleicht liebe ich ihn doch?
Oder ihn?
Sie alle bieten mir dasselbe.
Doch wer würde daran arbeiten?
Ach nein, nicht so schwer. Wer ist schon von sich aus perfekt? Den nehme ich.
Allein blieb sie für immer. Nicht am Körper, doch in der Seele.
Ich will niemanden mehr. Ich warte auf die, die es mit mir aushält.
Du bist nicht perfekt, du hast deine Probleme, doch du arbeitest dran.
Arbeit ist schwer, doch ich helfe dir.
Lass uns das Leben teilen.
Und wenn jemand von uns alleine sein muss, ist das in Ordnung.
Und sie wurden glücklich – mit Problemen und sehnsüchten zwar, doch sagten sie es sich und arbeiteten zusammen daran, dass sie glücklich waren.
Liebe benötigt, dass man sich selber liebt.
Ich liebe mich, und das was ich mache.
Ich liebe es alleine zu sein, und einfach zu arbeiten.
Ich liebe es, die Natur zu beobachten.
Ich liebe es, mit Freunden unterwegs zu sein.
Du, wer bist du denn?
Du gefällst mir.
Du gefällst dir auch?
Lass uns doch ein Stück Weg gemeinsam gehen.
Und gucken, wohin es uns treibt.
Und wenn wir nicht mehr wollen, gehen wir nach Hause.
Denn wir lieben auch uns alleine und sehen uns dann morgen wieder.
Liebe deine Vorstellungen, Illusionen, wünsch – und du bleibst im Geiste und Herzen allein.
Liebe die Menschen wie sie sind, und du liebst viele.
Sei offen für die Wünsche und Probleme der anderen, und ihr werdet für einander leben.
Lauf weg vor Problemen und verschließe dein Herz – und nie wird jemand anders darinnen wohnen.
Oder gibt es die Liebe überhaupt nicht?
Zitate des Tages: Gustav Landauer
September 28, 2008hier eine kleine Sammlung von Zitaten von Gustav Landauer:
Sex
„wir Menschen sollten doch endlich dahinter gekommen sein, daß dieser vielgerühmte[..]Genuß nur ein schlauer Trick[..]der guten Natur ist, um für Nachkommenschaft zu sorgen.“
– G. Landauer: Zur Entwicklungsgeschichte des Individuums II. In: Sozialist.
„Und es ist ein Punkt[..]wo beide sich treffen: der Arme und der armselige Reiche. In der Geschlechtsnot kommen sie zusammen. Die allerärmsten sind die jungen Weiber, die nichts zu verkaufen haben als ihren Leib. Die allerarmseligsten sind die jungen Männer, die durch Straßen irren und nicht wissen, woher ihnen das Geschlecht kommt und wohin sie damit sollen.“
Gustav Landauer: Beschreibung unserer Zeit. In: Sozialist (1909)
Individualismus und Gemeinschaft:
„Individualisten“, die den momentanen,[..]oberflächlichen Genuß über alles stellen, versagen sich den Genuß, der mehr wert ist als alle[..]zusammen[..]: am Ende des Lebens zu wissen, daß man nicht umsonst gelebt hat, und daß etwas von uns weiter wirkt und weiter lebt.
– G. Landauer: Zur Entwicklungsgeschichte des Individuums II. In: Sozialist.
„Wir sind die Augenblicke der ewig lebenden Ahnengemeinde.“ (S.15) „Die individuellen Leiber, die von Anbeginn an auf der Erde gelebt haben, sind nicht bloß eine Summe von abgesonderten Individuen, sie alle zusammen bilden eine große, durchaus wirkliche Körpergemeinschaft, einen Organismus.“ Und „so stirbt auch der Mensch und stirbt doch wieder nicht; in seinen Kindern, in seinen Werken lebt er selbst verwandelt […] weiter.“ (S.16)
– Gustav Landauer: Skepsis & Mystik (1903 / 1905)
„denn ich will, dass Menschen mich hören, dass Menschen zu mir stehen, dass Menschen mit mir gehen, die es nicht mehr aushalten können gleich mir.“
– G. Landauer: Aufruf zum Sozialismus (1908)
Freiheit des Bodens:
„Frei sei der Mensch auf freier Erde!“
(G. Landauer, 1893)
„Die Erde, und damit die Möglichkeit des Wohnens, der Werkstatt, der Tätigkeit; die Erde und damit die Rohstoffe; die Erde und […] Arbeitsmittel sind im Besitze von Wenigen. Diese wenigen drängt es nach […] persönlicher Macht“
– G. Landauer: Aufruf zum Sozialismus (1908)
Bildung:
„Die Erziehung wird überall vernachlässigt, weil es überall im Interesse der privilegierten Klassen liegt, sie, soweit es sich um das Volk handelt, auf einem möglichst niedrigen Niveau zu erhalten.“
Gustav Landauer: Die Fortführung von Ferrers Werk. In: Sozialist (1909)
Die dystopische Utopia des Thomas Morus. Eine Kritik am besten Staat.
September 28, 2008Thomas Morus‘ Utopia (1516) gilt als Namensgeber und einer der ersten Vertreter der Utopie (nach Platon und Cicero). Eine Utopie ist ein wünschenswerter, besserer Zustand. Doch die Utopia des Morus zeigt totalitäre Züge. Sie beschwört einen kommunistisch-sozialistischen Staat mit Toleranz, aber auch jeder Menge Unfreiheit und Überwachung. Dieses möchte ich hier behandeln und aufzeigen, dass die Utopia im heutigen Sinne keine Utopie mehr ist, sondern vielmehr eine Dystopie. Weiterhin möchte ich hier überhaupt die Ideen der Utopier vorstellen.
Das Übel der Rechtschreibung
September 25, 2008Um hiermit mal etwas altbekanntes und schon oft behandeltes erneut anzusprechen: die Rechtschreibung.
Grundsätzlich eine der schädigensten Erfindungen der Menschheit, zwängt sie der Sprache doch ein unnatürliches Korsett auf, welches sie in eine ihrer freien Entfaltung beraubende Form presst. Doch die prinzipiell schädigende Einrichtung einer Regelung durch Menschen, die von Sprache keine Ahnung haben, soll hier nicht primär Thema sein.
Behandeln möchte ich hier nur kurz einige Unterschiede zwischen alter und neuer Rechtschreibung, soweit sie mir aufgefallen sind.
Rein prinzipiell scheint die neue Rechtschreibung der natürlichen Sprachausübung näher zu kommen und beseitigt einige alte Schäden, doch wirft dafür auch neue auf. So sind z.B. die freie Wahl von Groß- und Kleinschreibung bei einigen früher unnötigerweise groß geschriebenen Wörtern positiv hervorzuheben; wenngleich man, wie es in anderen Ländern schon lange Sitte ist, konsequent genug hätte sein müssen, um die Großschreibung Satzanfängen und Namen als Privileg zuzuschreiben.
Auch ist die Beseitigung zahlreicher unnötiger Kommataregeln sehr erfreulich, doch wurden auch unnötige neue eingeführt, so z.B. das setzen von Kommata nach wörtlicher Rede, selbst wenn in dieser ein emphatisches Satzzeichen enthalten ist. Weiterhin war man auch hier nicht konsequent genug, denn eigentlich sind Kommata nur erforderlich, wo eine Tonänderung im Sprechfluss entsteht.
Der Unterschied zwischen ss und ß ist wiederum erfreulich, da nun endlich zwei Grapheme für zwei Phoneme stehen, nicht wie ehedem noch ein Graphem für zwei Phoneme. Denn /s/ und /z/ sind deutlich verschieden, und dies sollte auch die Schrift relektieren. Dass man auch hier nicht weit genug ging, dürfte leicht ersichtlich sein, stehen doch weiterhin viele Grapheme für mehr als ein Phonem; doch steht die deutsche Schreibung hier wenigstens schon einmal wesentlich besser da als z.B. die französische oder die englische. Ich persönlich hätte ja nichts dagegen, wenn alles in IPA geschrieben wird. /natyɐliçɐ væʀǝ es/.
Wann Wörter auseinander und wann zusammen geschrieben werden, wurde zwar etwas verbessert, unnatürlich ist es aber trotzdem noch, vor allem, wenn Wörter getrennt werden, die eindeutig ein einzige phonologisches Wort darstellen und als dieses auch leichter zu identifizieren sind denn als Regelgebundendes grammatisches Wort.
An diesem letzten Satz sieht man einen weiteren Punkt, denn warum wird dieses doch so offensichtliche Adjektiv groß geschrieben? Ich sage hier nur: nieder mit der überflüssigen Großschreibung! Dies wird sogleich viele Unklarheiten und Unregelmäßigkeiten beseitigen.
Letztlich noch der Punkt, welcher mich als einziger absolut und klar an der Neuen Rechtschreibung stört. Auch wenn man diesen Punkt so oder so sehen kann, stellt er eine große linguistische Debatte dar, bei welcher sich die Rechtschreibung für eine Position entschieden hat. Ich fange mit einem Beispiel zur Verdeutlichung an:
1. Alt: „Die meisten hatten schlicht Angst.“
2. Neu: „Die Meisten hatten schlicht Angst.“
Hier sieht man folgendes:
-
nimmt an, dass sich in diesem Satz ein Substantiv befindet, welches als Begleiter das Adjektiv meist[en] hat. Das Substantiv wurde jedoch getilgt oder befindet sich in einem anderen Satz: a) die meisten Menschen hatten schlicht Angst. b) Menschen gingen dorthin. Die meisten Menschen hatten schlicht Angst.
-
nimmt an, dass sich hier kein Substantiv befindet, sich das [Meisten] auf kein anderes Substantiv bezieht, sondern selber eines ist.
Damit spricht es einen wichtigen Punkt in der Syntax an. Meine Intuition spricht dafür, dass 1. korrekt ist, denn beim Lesen oder Sprechen dieses Satzes muss man gedanklich ein lebendes Objekt hinzufügen, denn nur dieses kann Angst haben. „Die Meisten“ müssen ein Gesicht haben, sie müssen etwas sein. Doch so, als 2., haben sie dies nicht, sind vielmehr etwas abstraktes und fernes. Weiterhin befindet sich bei Sätzen dieser Art vor allem auch irgendwo im Kontext ein Substantiv, auf den sich dies bezieht, das aber in diesem Satz aufgrund von Ästhetik erstmal getilgt wird.
Hiermit schließe ich vorerst meine Ausführungen die Rechtschreibung betreffend mit dem emphatischen Aufruf, sie endlich zu zerstören oder zumindest so konsequent weiterzuführen, dass sie endlich doch die natürliche Sprache reflektiert und nicht mehr nur das Instrument einer elitären Klasse ist, die es als einziges beherrscht und damit andere Nicht-beherrschende denunzieren kann. Die Rechtschreibung presst etwas dynamisches ökonomisches in ein statisches Gerüst, dass es in seiner freien Entfaltung weiter behindert.Vermutlich kann man die geistige Freiheit einer Gesellschaft gar an den Regeln ihrer Rechtschreibung ablesen.
Zitate des Tages
September 3, 2008alle von:
Thomas Hobbes: Leviathan (1651)
„Lerne dich selbst kennen“:
„die Gesinnungen und Leidenschaften der Menschen, so verschiedenen sie auch immer sein mögen, haben dennoch eine so große Ähnlichkeit untereinander, daß jeder, sobald er über sich nachdenkt und findet, wie und aus welchen Gründen er selbst handelt […] auch anderen Menschen Gesinnungen und Leidenschaften kennenlernt.“
Wissen: „wer sich dabei nur auf andereverläßt, deren Urteil blindlings annimmt und nicht aus einzelnen Begriffen selbst entwickelt, der tut soviel als nichts, er weiß nichts, sondern glaubt nur.“
Macht ist „jede solche Eigenschaft, welche viel Liebe oder viel Furcht erweckt, ja schon den bloßen Ruf einer solchen Eigenschaft, ist Macht, weil uns dadurch viel Hilfe und Dienste verschafft werden.“
„Es mag jeder seinen eigenen Wert so hoch annehmen, wie er will; wirklich bestimmt wird er nur durch das Urteil anderer.“
der Naturzustand: „Hieraus ergibt sich, daß ohne eine einschränkende Macht der Zustand der Menschen ein solcher sei, […] nämlich ein Krieg aller gegen alle.“
„Freiheit begrift ihrer ursprünglichen Bedeutung nach die Abwesenheit aller äußeren Hindernisse in sich.“



 Veröffentlicht von kaltric
Veröffentlicht von kaltric