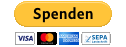II: Ungewöhnliche Absichten erfordern ungewöhnliche Mittel.
„Und ich sage dir – er hat ihn damals umgebracht!“
Crear Ataurass Elorm war wütend – so wütend, wie ich ihn seit Jahren nicht gesehen hatte. Immer wieder ging er von einem Ende des Raumes zum anderen, sein Gewand dabei ehrfurchtgebietend hinter sich herziehend.
„Das sind harte Worte – was macht dich da so sicher?“
Ich saß an meinem Tisch, vor mir mein Humpen, daneben seiner. Eigentlich hatten wir uns nur unterhalten wollen – nun das.
„Du weißt es doch selber! – du warst doch dabei!“ Er hielt an und sah mich eindrücklich an. „Zunächst einmal – du weißt, wie sie immer stritten. Du weißt, dass sie sich am liebsten die Kehlen aufgeschnitten hätten!“
„Das ist aber doch kein Beweis…“
„Nein, natürlich nicht – aber an diesem Tag – damals vor so vielen Jahren – als Shaen meinen Vater überzeugte, auf das Meer hinauszufahren – obwohl er wusste, dass ein Sturm kommen würde – das ist bis heute seine Entschuldigung – zu behaupten, das Wetter wäre es gewesen – Schicksal – Eingriff der Götter -“
„Ja! – Ja! – Ich verstehe ja, was du meinst; du meinst also, er hätte sich selbst in Lebensgefahr gebracht, um seinen eigenen Sohn zu töten? – Welchen Sinn soll das denn bitte machen?“ Und zu mir selber sagte ich: So verrückt kann selbst diese Familie nicht sein.
Nun kannte ich Crear bereits seit Jahren, doch verstand ihn trotzdem noch nicht. Meist führte ich es auf die anstrengenden Jahre der Mannwerdung sowie seinen Zorn auf Shaen und den ewig quälenden Verlust des Vaters zurück, doch manchmal schien dies nicht zu reichen. Es machte mir schon allein Sorgen, dass oftmals sein ganzes Leben, Streben und Handeln nur von Hass getrieben schien. Und dann, an anderen Tagen, seinem Großvater gegenüber, verhielt er sich plötzlich wieder gewöhnlich, wie der kleine Enkel von einst.
„Ich weiß – für dich und Asmyllis mag es keinen Sinn ergeben – doch ich weiß, es war so.“
„Und du weißt, dass bloße Anschuldigungen dir nicht viel bringen? Selbst mit Beweisen wäre es schwer – inmerhin ist er der Sohn des Gurass – der nächste Tereanv. Und was bist du? Du kommst nirgends in der Nachfolgereihe dran – also – beruhig‘ dich. Du kannst nichts tun.“
Meine Worte schienen ihn zum Überkochen zu bringen. Mit einem kräftigen Schlag seiner Faust traf er den Schild, welchen ich an die Wand gehängt hatte – und verbeulte ihn.
„Ah – was machst du da? Bringt dir das Befriedigung?“
Mit einem seltsamen Feuer in den Augen sah er mich an. „Ja – das tut es.“ Sodenn setzte er sich wieder mir gegenüber und sah mich auf einmal gelassen an. „Du wolltest mir von Asmyllis erzählen – wann kommt sie wieder?“
„Ah, Crear, wohin gehst du?“
Der Angesprochene blickte Shaen erschrocken an.
„Äh – Großvater – ich… – ich bin gerade auf dem Weg zu Großvater Gurass…“ Crear war es sichtlich unangenehm, seinem Verwandten hier in den Gängen der Burg zu begegnen.
„Ach ja, Vater – schon so alt und trotzdem versucht er noch das Geschick der Familie zu lenken. – Sag, was gefällt dir so bei ihm?“
Crear sah kurz düster zu Boden, dann hinüber zu mir, der ich selber unangenehm überrascht auf dem Balkon des Ganges saß, unfreiwilliger Zeuge dieser Begegnung werdend.
„Nun – er ist ehrlich.“ Sein Blick wurde durchdringend, als er Shaen in die Augen sah. „Er hat nie jemanden ermordet, der mir wichtig war.“
Shaen schien den vorhandenen Seitenhieb nicht zu bemerken; blieb erstaunlich ruhig – wirkte gar nachdenklich.
„Weißt du, als ich in deinem Alter war, hatte ich auch noch einen Großvater, der damals Tereanv war: Noroash. Hat dir dein Großvater je erzählt, wie er meinen Großvater die große Treppe des Eingangssaales hat hinab stolpern lassen? – Natürlich war es für alle bloß ein Unfall…“
Er verfiel in Schweigen, doch Crears Lippen zitterten. Ich kannte diese Art – und plötzlich war Crear verschwunden, seinen eigenen Weg verfolgend.
Nachdem Shaen kurz regungslos verharrt war, wurde er meiner gewahr. „Ah, Kammerherr – wie geht es euch?“ Humpelnd – wie er seit dem Unglück damals immer war – kam er zu mir.
„Herr – danke – gut.“
Und zu allem Überfluss setzte er sich dann auch noch neben mich.
„Ich habe ein paar Dinge mit euch zu bereden. – Mein Vater ist alt und wird nicht mehr lange leben – das wisst ihr. Es wäre klug, bereits für die Zeit danach zu sorgen, wenn ich der neue Tereanv bin. – Was meint ihr?“
Ich fühlte mich unter seinem ruhigen, doch herrischen Blick klein und machtlos. Hatte ich eine andere Wahl als ihm zu gehorchen?
Vielleicht ein Jahr später gab es ein folgenschweres Treffen. All die Zeit über war Crear bemüht gewesen, seinem Großvater aus dem Weg zu gehen. Wann immer er ihm begegnete, versuchte er sich zu beherrschen. Meist hatte er zuviel Angst um aufzubegehren, doch manchmal schimmerte sein Hass in seinen Reden oder Augen hindurch. Auch Shaen konnte das unmöglich entgangen sein. Dieser war stark damit beschäftigt, seine Macht auszubauen. Als ältester Sohn des Gurass stand ihm sowieso der Titel des Tereanv zu, sollte dieser sterben, doch hätte ihn noch der Ehrgeiz seines Bruders Chauss oder eines dessen Söhne in den Weg kommen können. Als die Familie Chauss jedoch von einem Ausflug in den Osten nicht wieder zurückkam, da Banditen sie überfallen hatten, war dieses Problem gelöst. Nun – ich will damit ganz sicher nicht behaupten, dass Shaen dafür verantwortlich war – ganz gewiss nicht, immerhin gab es keine Beweise in der Richtung – doch kam ihm dies gut gelegen. Was ich damals aber immer noch nicht verstand war, wie ihm der Tod des Ataurass hätte helfen können.
Zunächst aber zu besagtem Treffen: Sobald sie von dem Unglück Chauss betreffend erfahren hatte, verfiel die ganze Familie Elorm für eine Woche in Trauer. Bereits nach drei Tagen aber sollte es sich ereignen, dass Shaen seinen Sohn Maereth sowie seinen Enkel Crear einlud, mit ihm am Feuer des kleinen Ostsaales zu trinken und beisammen zu sein. Ich war natürlich nicht eingeladen, sollte aber als Crears Mundschenk werken – und ehrlich gesagt lauschte ich sooft es ging, was dort besprochen wurde. Nachdem sie bereits für eine Stunde über Belanglosigkeiten – Wetter, andere Adlige, Klatsch, Gerüchte, das Verhalten von Shaens Frau, Stadtgeschehen, das Geschehen am Hofe in Barga und so weiter – gesprochen hatten, wagte Maereth endlich die wichtige Frage.
„Jetzt sag schon, Vater – warum wolltest du dich wirklich mit uns treffen?“
Ich sah die Beteiligten zwar nicht, doch hörte ich Shaen seinen Becher abstellen – immer noch klang seine Stimme klar, derweil Maereth etwas lallte. „Ich will mit euch die Dinge besprechen, die da kommen, wenn ich Tereanv bin – Gurass liegt im Sterben. – Jetzt guck nicht so Crear, du weißt das doch ebenso gut wie ich. – Die Kräuterfrauen und Heilmänner sagen, dass sie nichts mehr tun können. Der natürliche Lauf der Welt geht seinen Weg und nimmt ihn mit sich.“
Maereth schien besorgt – aber nicht um Gurass. „Was – hast du dann vor mit uns zu tun?“
Shaens Stimme schwang um in Zorn. „Dummkopf! Ich werde dir schon nichts antun – sonst hätte ich das längst getan! – Nein, du törichter Junge! – Ich brauche euch. Ihr seid die Fähigsten aus der Familie, wenn auch nicht die Schlauesten. – Nein, sagt nichts, hört einfach zu! – Lange genug hat diese Familie, die Familie Elorm, am Rande des Reiches vor sich hingedümpelt. Es ist Zeit, uns endlich zu vergrößern; und zu nehmen, was uns gehören sollte.“
Maereth schien überrascht – wir anderen wussten schon lange um Shaens Ehrgeiz. „Was hast du vor?“
„Uns Land erkämpfen, das andere Familien uns wegschnappten – was sonst?“
Endlich mischte auch Crear sich ein. „Und wir sollen für dich dabei was sein? Feldherren oder Statthalter?“
„Ich werde euch für beides brauchen, meine Kleinen.“
Plötzlich musste ich erschrocken von meinem Horchposten auffahren.
„Was tust du? Lauscht du etwa?“
Lange hatte ich mich nicht mehr so ertappt und peinlich berührt gefühlt.
„Du weißt doch – das tut man nicht.“ Mit einem seltsam belustigt belehrenden Blick sah Caeryss mich an, während sie gleichzeitig einen halben Laib Brot aus dem Brotkorb nahm.
„Essen stehlen gehört sich aber ebensowenig – hab ich zumindest gehört. Und warum sollte eine Köchin das tun?“
Nun grinste sie. „Ich habe nichts gesehen – oder du etwa?“
Was blieb mir anderes übrig als den Kopf zu schütteln?
„Na also – aber sag mal, was gibt es denn so tolles zu belauschen?“ Neugierig schob sie eine Strähne braunen Haares beiseite und machte Anstalten ebenso zu lauschen.
„Das geht dich eigentlich nichts an. – Shaen betrinkt sich mit Maereth und Crear.“
Diese Neuigkeit schien sie zu enttäuschen. „Ah? – naja – sicher interessant – für dich. Nun – weißt du schon, dass Gurass es nicht mehr lange machen wird? – Und auch, dass behauptet wird, unsere Frau Asmyllis sei nach Tarle gegangen, weil sie meint, ihren Bruder dort zu finden? – Hm – nagut, ich seh‘ schon, mit dir macht das heute keinen Spaß – vielleicht geh ich lieber mal zur alten Gouma.“
Sobald sie endlich fort war, konnte ich mich wieder der Aufgabe des Lauschens widmen. Doch kaum wie ich mitbekommen hatte, dass sie sich bereits wieder über anderes unterhielten, da öffnete sich plötzlich die Tür zum Saal und Shaen kam zu mir in die Kammer. Ich konnte mich gerade noch rechtzeitig aufrichten.
„Heda – Kämmerer – wie war der Name? – Ach ja: Doubal. Also – Doubal. Ich werde jetzt in meine Gemächer gehen – sorge doch bitte dafür, dass da drinnen aufgeräumt wird, wenn die beiden fertig sind – und lass mir morgen zeitig genug mein Frühstück bringen, ich werde ausreiten wollen.“
„Ähm – natürlich, Herr.“
Ich hatte kaum Zeit mich zu verbeugen, da war er auch bereits ins Treppenhaus entschwunden. Nun letztlich doch zurück an meinem Horchposten, glaubte ich meinen Ohren nicht mehr trauen zu können.
„Du willst ihn umbringen? – Wieso?“ Crear klang ebenso ungläubig wie ich geklungen hätte.
„Wie er selber sagte, wird er bald Tereanv sein – würde er sein, wenn er weiter lebt. Und ich wäre dann sein Nachfolger. – Aber ich will nicht warten, bis ich alt und schrumplig bin sondern jetzt schon seine Nachfolge antreten! – Und du – du wirst mir helfen!“
Crear war mittlerweile kühler, überlegter geworden. „Warum sollte ich das tun?“
„Du weißt genau, dass ich keine Kinder bekommen kann. Nach mir würde der Titel dann an irgendwen anders aus der Familie fallen. Wenn du mir aber hilfst, mache ich dich zu meinem Sohn -“
„Aber er ist dein Vater – du willst deinen Vater ermorden?“
„Lass das meine Sorge sein – du hasst ihn doch auch – wir alle hassen ihn. Es wäre besser, würde Ataurass noch leben, aber so -“
Er ließ seinen Satz ausklingen, ohne dass ich verstand, worauf er anspielte. Crear dagegen schwieg, bis Maereth fortfuhr. Seine Stimme klang plötzlich dunkel und traurig.
„Weißt du, Crear – ich würde dich auch so zu meinen Nachfolger ernennen. Wen sonst gibt es denn in dieser Familie schon? Gasmys bringt nur Bastarde und Schwachköpfige zur Welt und Asmyllis könnte man sich niemals unzüchtig genug vorstellen. Da bleibst nur du. – Und, mein Lieber – du bist gefährlich. Zu schlau und zu unberechenbar. Bis heute konnte ich nicht feststellen, was du eigentlich anstrebst – außer meinen Vater zu töten. Also wirst du mir helfen.“
Ich hörte auf einmal einen Stuhl über den Boden schaben und dann Crears wütende Worte. „Aus dir spricht bloß der Wein! – Du bist ebenso erbärmlich wie dein Vater!“
Hastige Fußtritte entfernten sich gen anderes Ende der Halle, gefolgt von einem weiteren scharrenden Stuhl und anderen Schritten.
„Crear – warte doch!“
Und damit ward alles ruhig.
Da ich niemanden mehr fand, den ich mit Shaens Frühstück an meiner statt beauftragen konnte, musste ich mich am nächsten Morgen wirklich selber darum kümmern und trug es sogar noch eigenhändig hinauf in seine Gemächer. Ich richtete alles im Esszimmer her wie es sich gehörte, doch fehlte noch der Herr des Hauses. Auf mein Klopfen hin antwortete niemand, so streckte ich vorsichtig meinen Kopf in sein Schlafzimmer – doch Shaen war nicht da. Verwundert ging ich hinab zur Küche, doch wurde von Caeryss aufgehalten.
„Da bist du ja! – Schnell! – Man braucht dich – Gurass ist tot!“
Einen Moment lang war ich zu erschrocken, dann eilte ich zu den Gemächern des alten Tereanv, um dort bereits alle sich zur Zeit in der Burg befindlichen Familienangehörigen vorzufinden. Gurass war tot – tatsächlich tot – nach all diesen Jahren – und die versammelte Familie trauerte – oder tat zumindest so.
Am selben Tag noch wurde Shaen Gurass Elorm zum neuen Tereanv von Lurut ernannt und in der folgenden Nacht Gurass verbrannt, als hätte man Angst, er könne wieder auferstehen. Etwa eine Woche lang ging dann alles seinen gewohnten Gang. Shaen versuchte sich in allen Amtsgeschäften durchzusetzen. Maereth wurde sein vorbestimmter Nachfolger, derweil Crear den Titel eines Heerführers bekam. Gasmys Shaen, der jüngere Sohn, bekam die Grenzmark zugesprochen, die unter Gurass noch Shaen inne hatte. Das lockte natürlich Gerüchte hervor, was er wohl mit Maereth vorhätte.
Und eines Abends, als ich durch die dunklen Gänge der Burg striff, vernahm ich – wieder einmal unwillig – ein Gespräch. Ich holte gerade ein verstaubtes altes Banner für Shaen aus einer Abstellkammer, da kamen im Gang draußen Gestalten an der Tür vorbei. Klar und deutlich vernahm ich da für einen kurzen Augenblick die Stimme der alten Teule, Frau des Shaen und heimliche Herrscherin der Burg.
„… musst es endlich tun, Maereth! Sei kein Feigling!“
Zunächst dachte ich mir nichts dabei, doch am folgenden Tage bekamen diese Worte eine seltsame Schwere, denn am Morgen war die gesamte Burg erneut in Aufruhr: Shaen war tot! Der Mann, der erst seit wenigen Tagen Tereanv gewesen war – war nun selber nicht mehr.
„Was – was ist geschehen?“ Ich war fassungslos, als ich davon hörte.
Caeryss ging es kaum besser. „Ich weiß es nicht – ich fand ihn heute morgen – tot in seinem Bett – er atmete nicht mehr…“
Sie schien den Tränen nahe, warum auch immer, also drang ich nicht weiter in sie. Andere schienen nicht mehr zu wissen, doch trafen mich als Kämmerer einige drohende Aufgaben, so ging ich zu Teule.
„Mein Mann ist tot und du erwartest von mir Gründe für deine Aufgaben zu erfahren? – Ha! – Du bist ein wirklich guter Kämmerer. Ich weiß nicht, woran er gestorben ist – Schwaches Herz? Falsches Essen? Nicht genug Opfer dargebracht? – aber ich will, dass alles vorbereitet wird. Du weißt, dass Maereth nun neuer Tereanv ist, auch wenn sein Vater es nicht lange war, also bereite die Feierlichkeiten vor. Und heute Abend wird mein Gatte verbrannt, wie es Sitte ist – bis dahin haben die Kräuterfrauen und Heiler Zeit genug zu versuchen herauszufinden, woran er starb.“
Nach dem ‚Gespräch‘ mit Teule fühlte ich mich schlecht. Ich hatte den starken Verdacht, dass sie und Maereth am Tode Shaens zumindest mitverantwortlich waren. Dass Maereth später bei seiner Thronbesteigung Crear zu seinem Nachfolger ernannte, machte die Sache für mich kaum besser. Crear, den ich als unschuldigen Jungen gekannt hatte, gehörte nun ebenso zu den Ränkespielen dieser Familie wie alle anderen. Unter den wenigen noch anwesenden Familienmitgliedern entstand schnell misstrauisches Geraune.
„Der kleine Crear einst Tereanv? Na das wird Frau Asmyllis gefallen, sollte sie je wieder heimkehren.“ Caeryss, die neben mir stand, warf mir nach ihren Worten einen bedeutungsvoll spöttischen Blick zu und machte sich von dannen.
Mich beschlichen ungute Gefühle, wenn ich an die Zukunft dieser Stadt – dieser Familie – dachte. Und es schauderte mich, als ich Teule neben ihrem Sohn stehend lächelnd auf die Versammelten blicken sah.
Das ganze Buch kaufen:



 Veröffentlicht von kaltric
Veröffentlicht von kaltric