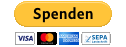Der schlimmste Tag
© 2012 – 2016 by Andre Schuchardt
Alle Rechte liegen beim Autor dieser Veröffentlichung. Der Inhalt diese Dokumentes ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Jede weitergehende Verwendung, insbesondere Veröffentlichungen, die Speicherung in Datenbanken, Vervielfältigung und jede Form der gewerblichen Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte – auch in Teilen oder in überarbeiteter Form – sind ohne meine schriftliche Zustimmung untersagt.
Inhalt
Buch 1: Der Morgen
I
Gong!
Und plötzlich war er wach, oder zumindest nicht mehr im Traum. Ach – der Traum! Wie wohlig schön. – Und langsam dämmerte er wieder davon und träumte weiter von Ruhe, Frieden und Glück.
Gong!
Ach – nicht doch – nur noch einen Augenblick lang dieses Gefühl genießen. Aber – war da nicht etwas – gab es da nicht etwas – zu tun? Was war es noch?
Gong!
Und dann fiel es ihm ein: Dass es läutete, konnte nur bedeuten, dass es Morgen war; dass er schnell aufzustehen hatte, wollte er nicht zu spät sein.
Gong!
Niemals durfte er zu spät sein. – Wann war er gestern aufgestanden? Ach ja – beim vorletzten Schlag. Wie jeden Tag.
Gong!
Mühsam raffte er sich auf. Durch sein Fenster fiel das Morgenlicht in den kahlen kleinen Raum, der zu dieser Jahreszeit morgens noch angenehm kühl war.
Gong!
Damit war die Nacht für ihn beendet und ein neuer Tag lag vor ihm. Wie jeden Morgen schlüpfte er als erstes in seine Sandalen, zuerst links, dann rechts. Gähnend erhob er sich, entledigte sich seines Nachthemdes und legte dieses gefaltet auf seine Schlafstatt, nachdem er diese gemacht hatte. Als nächstes käme die Morgenwäsche dran. Den linken Fuß auf das Bodenbrett mit der Flammenzeichnung, den rechten auf dessen Nachbarn. Acht Bretter waren es bis zur Waschschüssel. Schlaftrunken klatschte er sich etwas Wasser ins Gesicht, um wach zu werden. – Doch bringen tat dies wenig.
Ein wichtiger Einfluss im täglichen Ablauf des Lebens, den man selber nicht willentlich beeinflussen könne, so brachte man ihm bei, war der eigene Stoffwechsel. Um diesen in Schwung zu bringen sollte man Abends ein Kräutergemisch zu sich nehmen, um jeden Morgen zur selben Zeit bereit zu sein. Jetzt hätte es eigentlich soweit sein müssen, doch irgendwie – fühlte er sich nicht danach. War heute etwas anders? – Nein, das durfte nicht sein! Der plötzliche Schub von Angst ließ ihn doch noch wach werden. Was nun? Was konnte er jetzt machen? Der Ablauf durfte – konnte – nicht verändert werden. Bis Morgen warten?
In seiner Verzweiflung fiel ihm nur ein, beim nächsten Punkt seines Tagesablaufs weiter zu machen, doch – Halt. Etwas anderes wäre noch zuvor gekommen. Hätte er das vergessen können? Die drei Bretter zu seinem Kleiderschrank überquerend öffnete er den linken, dann den rechten Flügel und nahm sich seine heutige Kleidung, welche dieselbe war, wie an jedem Tag. Erleichtert über diese Vertrautheit ging er zurück zum Waschbecken.
Zwar gehörte er leider zu der Sorte, die Morgens nur langsam wach wurde, doch war es Gebot, sich sofort rasieren zu müssen – sofern man es überhaupt tat. Später würde er dafür keine Zeit haben. Im Halbschlaf vor dem Becken stehend rasierte es sich für ihn aber schlecht, weshalb er sich für die Lösung entschieden hatte, es nur schwach zu tun, statt sich jedem Morgen einer neuen Wunde auszusetzen. An diesem Tag aber verfiel er bei seiner Tätigkeit erneut ins Träumen und – schnitt zu tief. Es war nur ein feiner Schnitt, doch stürzte damit für ihn fast eine Welt in sich zusammen. Welch Unglück dies wohl nach ziehen würde, fürchtete er zu fragen.
Schließlich konnte er aber nicht anders, als weiter zu machen wie zuvor, denn jeder weitere Bruch mit der Gewohnheit würde mehr Unglück herbei beschwören. Heute war der Tag des sich alle dreißig Tage wiederholenden Mondfestes und damit der längste Tag dieser Zeit. – Mehr als genug davon also für sehr viel Unglück.
Nachdem er mit Aufstehen, Waschen, Anziehen und Rasur fertig war, galt es, hinaus in die Welt zu treten und sich auf den Weg zu machen. Sein Zimmer lag am Südende des Wohnbereichs, derweil sich Küchen und Speisesäle im Osten des Klosters befanden. Zuvor galt es aber, nach Westen, in die Gebetshallen zu gelangen. Immerhin war es früher Morgen und wie an einem jedem solchen galt es zuerst, der Predigt des Ältesten zu lauschen, auch wenn dieser nur immerzu dasselbe verkündete. Aber diesem Gedanken war noch nie jemand in der langen Geschichte des Klosters auf die Spur gekommen.
Andächtig – oder schläfrig – öffnete er seine Tür und wagte einen ersten Blick hinaus.
„Morgen, Fahach!“ Wie immer gut gelaunt – wie war das zu dieser Zeit nur jeden Morgen möglich? – ging da einer seiner Brüder an ihm vorbei, kaum auf die zu betretenden Bretter achtend, eilend gen heutiger Predigt.
Jeden Morgen dasselbe. – Warum hatte Fahach sein Zimmer ausgerechnet auf dem Weg des einzigen Morgens gut gelaunten Bruder nehmen müssen?
„Morgen“, murmelte er, als der Bruder schon halb wieder verschwunden war, und machte den ersten Schritt auf den Gang.
In seiner Schläfrigkeit hatte er wesentlich stärker auf seine Taten zu achten, als seine Brüder. Diese huschten teilweise an ihm vorbei, während er noch abzählte, auf welches Brett er als nächstes zu steigen hatte, um kein Unglück auf sich zu ziehen. Gang um Gang legte er so zurück, musste selten andere Ganggänger grüßen und noch seltener jemanden vorbeilassen oder gar auf ihn warten. Doch dann geschah etwas, das sowohl seine vollkommene Gewohnheit als auch seine nach dem unglücklichen Aufstehen wiedergewonnene Selbstsicherheit zerstörte.
„Sie können hier nicht lang gehen.“
Was? Wer hatte da gesprochen? Langsam erst verstand er, dass dort jemand vor ihm auf dem Boden kniete und er deshalb hatte halten müssen. Danach dauerte es noch weitere, quälend lange Augenblicke, bis er wirklich verstand, was das bedeuten würde.
„Wie? Das kann nicht sein. – Ich gehe immer hier lang auf dem Weg zum Morgengebet -“
„Möglich, aber heute geht das nicht. Ich muss den Stein hier neu verlegen.“
Erstaunt erkannte Fahach, dass die Platte, über die er täglich hinweg ging, nicht mehr an ihrem Ort lag, während ein schmutziges Loch im Boden klaffte. – Doch, dort lehnte sie, neben dem unverschämten jungen Kerl. Der musste aus der Stadt sein. – Schon öfter hatte Fahach bemerken müssen, dass es manchen Städtern an Umgangsformen mangelte.
„Junge, du verstehst nicht – ich gehe hier jeden Morgen lang – jeden – immer -“
„Na dann gehen sie doch einfach um mich ‚rum; hier ist viel Platz.“
„Das geht nicht -!“
„Warum? – Ach!“ Endlich schien der Kerl zu verstehen, wo er sich befand und begann dümmlich zu grinsen. „Ich verstehe. Sie müssen also jeden Tag zu dieser Zeit über genau diese Platte gehen.“ – Na endlich, dachte Fahach. – Doch dann verschwand das Grinsen wieder. „Aber heute nicht; ich habe den Auftrag, die Platte hier zu erneuern. Sehen sie? Sie ist gesplittert und könnte jederzeit brechen.“
„Ja können sie das denn nicht machen, nachdem ich weg bin?!“
Fahach befand sich nah des Verzweifelns. Wenn er nicht bald weitergehen könne, würde er viel zu spät zum Gebet kommen. Falschen Weg nehmen oder zu spät kommen? Die Wahl fiel nicht leicht.
„Tut mir leid, aber sie sehen doch, dass ich schon angefangen habe. Ihre Platte liegt hier sowieso nicht mehr. Aber sie können warten, in vielleicht einer Stunde dürfte ich fertig sein.
Seine Unverschämtheit war zu viel für Fahach. Wer hatte bloß diesen Kerl eingestellt? Doch mittlerweile herrschte vor allem die Angst in ihm. Was er auch tat, es wäre schädlich für ihn. Entweder warten und das Gebet verpassen oder seinen Weg ändern. Welches von beidem wog schwerer? Es bereitete fast körperliche und viele geistige Schmerzen, seinen Fuß in eine andere Richtung zu bewegen. Wenn er doch – aber nein, es ging einfach nicht. Kurzzeitig war er knapp davor, einfach weinend auf den Steinen zusammenzubrechen.
In all der Zeit, die er da verzweifelt stand, hatte er den Kerl vergessen. Erst als er einen Schlag in den Rücken bekam, erinnerte er sich seiner. Da war er aber bereits ein paar Schritte vor gestolpert, hinweg über die kleine Baustelle und auf eine der anderen Platten seines Weges.
„Jetzt gehen sie endlich, damit ich weiter machen kann“, sprach der Kerl und wandte sich seiner Arbeit zu, derweil Fahach ihn nur ungläubig begaffen konnte.
Hatte er es gewagt – ? Der Kerl beachtete ihn aber nicht weiter, doch Fahach benötigt noch eine Weile, bis er wirklich verstand, was ihm geschehen war und welche Auswirkungen das haben würde. Er stand nun tatsächlich wieder auf seinem eigenen Pfad und könnte den Weg also fortsetzen. Zwar hatte dieser eine ungewöhnliche Unterbrechung gehabt und er musste dabei einen neuartigen Umweg auf sich nehmen – doch war dies nicht seine Schuld, denn der Kerl hatte es verursacht und auch beseitigt. Das Gefühl der Angst ließ langsam nach. Es blieb ein milder Zorn auf den Kerl und seine kleine Baustelle. Dafür wuchs der Gedanke, dass die Messe nicht auf ihn warten würde, er sich also sputen müsse.
Hastig wandte er sich also um und folgte seinem restlichen, täglichen Gang, mal links, mal rechts abbiegend und selten im Kreis gehen, bis er endlich auf den westlichen Innenhof hinaus kam. Hier war es eine besondere Herausforderung, einen gleichbleibenden Pfad im Sand einzuhalten. Denn obwohl er es immer versuchte, vernichteten die Anwärter stets sein Werk, indem sie einmal am Tag ihrer Verpflichtung nachkamen, den Hof zu fegen. Hierfür galt aber noch die besondere Regelung, dass der genaue Weg für ihn unwichtig war, solange Beginn und Ziel stimmten und er sich immerhin grob an den Pfad halten konnte.
Für gewöhnlich hatte man vor der Gebetshalle zu warten. Die Ersten würden bereits hineingehen, derweil sich die Nächsten die Füße abtraten und der Rest hinter ihnen zusah oder seinen jeweiligen morgendlichen Halbschlaf-Träumen nachhing. Fahach gehörte – aufgrund seiner zeitraubenden Aufstehgewohnheiten – immerhin schon zu denen, die als letztes kamen und sich am längsten die Füße in den Bauch stehen durften. Doch heute kam er gerade noch rechtzeitig, den Platz hinter den sonst zuletzt stehenden einzunehmen.
„Du kommst spät“, sprach Man, als er hinter ihm stand.
Zum Glück gehörte ein morgendlicher kurzer Plausch mit zum Tagesablauf.
„Ein Kerl aus der Stadt – ein Handwerker oder so – hat mich aufgehalten.“
„Na, wenn es weiter nichts ist. Die Morgenandacht wird uns aufheitern.“
Damit war Man an der Reihe, sich vor dem Tor zu verbeugen, dem All zu danken, sich die Füße abzutreten und schließlich auch einzutreten, um zu seinem Platz in der Halle zu gehen. Fahach sah ihm dabei nur zu, fand langsam zu seiner alten Ruhe zurück und wartete nur darauf, folgen zu können. Als es soweit war, verbeugte auch er sich vor dem Tor und bat in seinem Geist inbrünstig darum, heute vor weiteren Unglücken geschützt zu werden, ohne daran zu denken, im Ausgleich dafür selber etwas zu versprechen. Danach säuberte er seine Sandalen auf der Matte vor dem Eingang, bevor er die Türschwelle übertrat.
Die Gebetshalle war einer der größten Räume des Klosters und konnte ohne Probleme alle hier Wohnenden fassen, ob Bruder oder Anwärter. Letztere mussten in der ersten Reihe knien, während jeder andere sich nach seiner Aufnahme einen freien Platz hatte suchen dürfen. Sein eigener befand sich links hinten in der Ecke. Schon immer war dieser Platz von Vorteil gewesen, da er als Letzter so nicht an allen zuvor Gekommenen vorbeigehen musste, auch wenn es durch das kaputte Fenster in seinem Rücken stets etwas zog.
An seinem Platz angelangt, kniete er sich auf den harten Steinboden und beobachtete wie immer das Treiben in der Halle. Alle Brüder – in Gelb – und Anwärter – in Weiß – waren anwesend, so wie auch die zwölf Oberen – in Rot. Diese nahmen als einzige ihre Holzstühle, gepolstert mit Kissen, droben auf der Bühne, schräg stehend und so zugleich zu Anwesenden und Bühnenmitte blickend, ein. Auf den Tischen vor ihnen standen Krüge dampfender Getränke, doch blickten sie noch ernst. In der Mitte ihrer Aufmerksamkeit stand ein einzelner, brusthoher kleiner Tisch.
Und in genau dem Augenblick, in dem Fahachs Augen diesen erblickten, fiel das Sonnenlicht durch die Ostfenster auf ihn und der Älteste trat ein. Seine Farbe war das Gold, was dazu führte, dass er in der Morgensonne blendend erstrahlte, wie der Sohn der Sonne selbst. An seinem Tisch angelangt, verharrte er, sich mit den Händen darauf abstützend, und sah sich die Versammelten musternd an. Scheinbar zufrieden fing er an.
„Heute ist der einhundert und elfte Tag des Jahres. Nachdem ihr jetzt alle wach seid, kann er beginnen. Die Sonne ist uns heute besonders wohlgesonnen und alles, was ihr heute richtig tut, wird euch doppelt gut getan; doch alles falsche erfährt doppeltes Unglück. Also lasst sie uns preisen.“ – Damit neigten alle kurz ihr Haupt. – „Aber unabhängig davon, ob unsere Herrin heute weiter auf uns herab strahlt oder nicht, werden wir unser Tagwerk verrichten. Mag die restliche Welt auch dem Irrsinn verfallen; wir bleiben eisern. Nun aber zur Verteilung der heutigen Aufgaben.“
Bisher hatte er fast dasselbe wie jeden Tag gesagt, nur verändert in den Anmerkungen. Auch die Aufgabenverteilung bot keine Überraschungen, unterlagen sie doch ebenso den Regelmäßigkeiten der Gewohnheit. Nacheinander ging er die Namen und Aufgaben der Anwesenden durch, während Fahach sich trotz schmerzender Knie kurz vorm Eindösen fand.
„Fahach“, sprach da der Älteste, „wird nach dem Frühstück die mit der Gartenarbeit beauftragten Anwärter einweisen. Danach wird er in die Stadt gehen. Die Einkaufsliste kannst du dir vorher bei mir abholen. Nachmittags kümmerst du dich weiter um die Anwärter.“
Nichts davon mochte Fahach. Die Anwärter bedeuteten immer wieder Probleme, da sie die Regeln noch nicht völlig verinnerlicht hatten, und die Stadt – oder eher ihre Bewohner – machten ihm Angst. Den Ältesten interessierte so etwas aber nicht.
„Lasst uns jetzt einen Augenblick des Schweigens einlegen und im Lichte unserer Herrin, der Sonne, baden.“ Nachdem dies geschehen war, fuhr er fort. „Heute gedenken wir auch der Tochter der Sonne, unserem weißen Mond. Wie immer wird das heute Abend auf der Hangwiese als Fest veranstaltet. Wir treffen uns dazu wie immer gemeinsam am Haupttor, wenn die Sonne schlafen geht, und werden alle mit uns feiernden Städter begrüßen.“
Diesen Teil mochte Fahach am wenigsten, bedeutete es doch mehr Zeit mit den Städtern, als ihm lieb war. Doch war es so Sitte und daher Vorschrift.
„Und nun werden wir noch einmal die Strahlen der Sonne genießen und uns erfreuen, dass sie uns alle heute hier behütet.“ Ein weiterer Augenblick der Andacht folgte. „Weiterhin wollte ich euch noch weniger erfreuliche Nachrichten mitteilen. Es betrifft die Angestellten und Helfer, die kein Teil unserer Gemeinschaft sind, jedoch von uns leben. Immer wieder vernehme ich Klagen, dass sie kein Verständnis für unser Leben, unsere Art und die Gebote der Herrin zeigen, obwohl die Stadt uns seit Urzeiten kennt. Solche Gestalten, um es einmal zu zeigen, gehören nicht hierher. Wenn ihr dem jedoch begegnet, sagt es mir oder den anderen,“ er machte eine kurze ausholende Bewegung, die Oberen umfassend, „sobald es an euch ist, mit uns zu sprechen. Denn mag es auch draußen in der Welt Sitte sein, in Unordnung, Ehrfurchtslosigkeit und kriegerischen Absichten zu leben, so sind wir ein Hort der Regelmäßigkeit. Zwar müssen wir mit ihnen leben und uns teils ihren Umständen anpassen, doch gilt das ebenso für sie, wenn sie unser Heim betreten. Drum meidet alle, die dies nicht verstehen können. Und nun – lasst uns baden in den Strahlen, welche die Herrin Sonne uns heute sendet.“ Ein letztes Mal wurde Andacht eingelegt, bevor es schließlich zu Ende ging. „Ihr seid jetzt entlassen. Und gedenkt allzeit der Sonne.“
Damit verließ der Älteste seinen Platz, um die Halle durch seinen eigenen Ausgang wieder zu verlassen. Auch die Oberen erhoben sich und strömten durch verschiedene Türen. Sie alle würden wohl in ihre Kammern oder an andere Orte einkehren, zur Arbeit oder zum Essen. Derweil strollten auch die restlichen Anwesenden davon, doch diese alle durch den Haupteingang. Zuerst die Brüder, danach die Anwärter. Sie alle hatten aber das selbe Ziel, welches bereits von etlichen knurrenden Mägen verlangt wurde: den Speisesaal.
II
„Wie fandest du die Ansprache?“ fragte Man, während er wie jeden Morgen neben Fahach ging.
„Es gefiel mir. Meinetwegen könnten wir diese Fremdlinge gerne alle raus werfen“
„Aber wer würde dann für uns arbeiten?“
„Machen wir nicht auch so schon alle wichtigen Arbeiten?“
„Nein, eigentlich nicht. Ich kann mich nicht erinnern, hier schon mal gekocht, den Abort gereinigt, Fliesen verlegt, Kleidung gewaschen und genäht oder den Ältesten bedient zu haben.“
„Ach – wir arbeiten doch auch im Garten und fegen den Hof. So schwer kann der Rest nun auch nicht sein.“
„Das sagst du jetzt…“
Während ihres Gespräches hatten sie den Innenhof gen Ost durchquert. Sie gingen durch den Tunnel, der durch das Kloster vom Westhof zum Haupthof führte. Zu Beginn ihrer Anwärterschaft vor vielen Jahren hatten sie sich beide für diesen Weg entschieden und mussten ihn seitdem jeden Tag zurücklegen. Damals, an diesem ersten Tag, war es sonnig und warm gewesen, gleich so wie heute. Doch an Tagen, die weniger gemütlich, gar stürmisch waren, bereuten sie ihre Entscheidung immer wieder – doch auch das gehörte dazu. Zum Glück aber würde das Kloster nicht da stehen, wo es stand, wäre es nicht ein meist sonniger Platz. Man war erst Jahre später als Fahach an diesen Ort gekommen, und doch hatten sie sich für den selben Pfad entschieden. Das hatte sie auch dazu verpflichtet, sich besser kennen zu lernen. Der gemeinsame Weg sollte sie bis zum Speisesaal führen.
Auf dem Haupthof beobachten sie kurz das schon beginnende Treiben. Aus der Stadt kamen die Lieferungen, zum Beispiel für das spätere Mittagessen. Jeden Morgen hatte ein anderer Bruder diese zu empfangen. – Heute waren Fahach und Man es zum Glück nicht. Einige der Waren wurden offenbar für das abendliche Fest benötigt. – Jedenfalls war es mehr als sonst. Zweimal bisher hatte Fahach eine solche Lieferung annehmen müssen. – Sein Rücken schmerzte bis heute bei dem Gedanken daran.
Nachdem sie genug gegafft hatten, überquerten sie den breiten Hof, der von Gehwegen aus Kies durchzogen und mit Grasflächen und Bäumen gesäumt waren. Dazu hatten sie sich einst nicht den geraden Weg auserkoren. Es galt, zunächst nach Rechts, gen Süd, zu drehen und auf das Hauptgebäude zuzugehen. Nach drei Schritten gab es da eine Abzweigung des Weges gen schräg links, durch zwei Grünflächen hindurch. Zunächst kamen sie so auf einen kleinen Zwischenplatz hinaus. Dieser war von einem kleinen Teich gekrönt, den sie einmal halb umrundeten und den Fischen zusahen. Auf der anderen Seite ging es wieder, die Abbiegung sehr scharf nehmend, in Richtung Südost. Am Ende dieses Weges mussten sie wieder einmal nach Links abbiegen und gen Nord zurück zum Haupttor gehen. Nach dem einhundertsten Schritt waren sie endlich am Tunnel zum Ostflügel angelangt, welcher nur etwa vierzig Schritt gegenüber des Westtunnels lag. Fahachs Magen beschwerte sich hier bereits knurrend.
Der Tunnel führte sie auf den Osthof. – Wäre da ein Hof gewesen. Tatsächlich aber nahm den Großteil dieses Hofes der Garten ein. Wenngleich Fahach erst nach dem Essen sich um ihn kümmern müsste, konnte er doch der Verlockung nicht widerstehen, nun schon einmal einen Blick darauf zu werfen. Aber noch war der Garten ruhig und leer. Sehr schön. In seiner Zufriedenheit vergaß er aber, auf den Weg zu achten. Man machte ihn darauf aufmerksam.
„Du hast deinen Schritt falsch gesetzt.“ Mit einem undeutbaren Ausdruck sah er ihn an, derweil sie beide wie immer weiter gingen. „Geht es dir gut? Wenn du krank bist, wäre das kein Bruch der Gewohnheiten…“
Fahach fiel nur ein Ausweg ein, derweil er sich plötzlich schweißgebadet fühlte. „Du musst dich irren. – Sieh! Ich gehe wie immer.“
„Ja, jetzt -“
„Nein, schon die ganze Zeit. Du hast dich versehen.“
Wenn du meinst.“ Aber Man schien durch die Erklärung nicht befriedigt, vielmehr wirkte er düster ernster.
Ob er wohl daran dachte, es einem Obersten zu berichten? Er musste sich schnell etwas einfallen lassen. Ihn mit der Sonne ablenken? Zu auffällig. Ihn nach dem heutigen Speiseplan fragen? Das hatte er noch nie gemacht. Verzweifelt dachte er nach, derweil sie den Garten bereits umrundet hatten und den südöstlichen Flügel betraten, um den Gang gen Speisesaal zu nehmen. – Ach, Man würde es sicherlich wieder vergessen, sagte er sich. Kurz warf er einen verstohlenen Seitenblick auf seinen Begleiter, doch der war damit beschäftigt, auf seine eigenen Fußtritte zu achten, um immer die richtigen Fliesen zu erwischen. Auch Fahach selber musste das machen, wollte er sich nicht aus versehen einen Fehltritt leisten. Immerhin hatte sein Körper sich in all den Jahren gut darauf eingestellt, stets demselben Pfad zu folgen, stets dieselben Dinge zu tun – stets dasselbe zu erwarten.
Auch im Speisesaal waren sie die letzten. Schon in seinem Leben, dass er vor dem Kloster geführt hatte, gewöhnte Fahach es sich an, Orte einzunehmen, an denen er weniger auffiel, Plätze zu wählen, der fern der Aufmerksamkeit waren – und ein gutes Mittel, dies zu erreichen, war, als letzter aufzutauchen. Das hatte auch den Vorteil, dass er nie lange bis zum Beginn warten musste. Hier im Speisesaal bedeutete es, dass die Schlange der sich Anstellenden sich schon fast aufgelöst hatte, ähnlich wie beim Frühgebet. Und da immer reichlich Angebot an Frühstück bereitgestellt wurde, brauchte man auch keinen Mangel zu fürchten.
Jeder in diesem Raum hatte seinen eigenen Plan, nach dem er entweder jeden Tag dasselbe nahm, nur an bestimmten Wochentagen etwas oder gar noch seltener. Da Fahach vieles auf dieser Tafel früher, beim Eintreffen im Kloster, nicht geschmeckt hatte, wechselte er nur jeden Tag zwischen einer von zwei Möglichkeiten. Heute wären dies Brot, Käse, eine kleine Schüssel Haferbrei, etwas Sonnenfrucht und Milch gewesen. Wie immer kam aber Man vor ihm dran und wie immer beobachtete er ihn bei seiner Wahl. Als er selber an der Reihe war, ergriff er einen großen Teller, nahm seine übliche Anzahl vorgeschnittener Brotscheiben, dazu ein größeres Stück Käse. Für den Haferbrei nahm er sich zunächst, mit der freien linken Hand, eine Schüssel, welche er vor den großen Topf mit Brei stellte. Drei Kellen voll davon – nicht mehr, nicht weniger. Die Schüssel vorwärts schubsen, noch eine Frucht auf den Teller legen. – Halt, wo waren die Früchte? Neben dem Breitopf stand, wie erwartet, die große flache Schale, in der sich immer die Fruchtauswahl befand. Aber – wo war das Obst selber? Hatte jemand anders sich bereits zu viele genommen? Aber dem könnte nicht sein; noch nie hatte Mangel geherrscht; zumindest, so lange kein Winter war. Möglich, dass es bloß noch nie dazu gekommen war, dass ausgerechnet heute auch alle anderen eine Frucht genommen hatten? – Für Fahach am wahrscheinlichsten aber war, dass einer der Städter, die hier in der Küche arbeiteten, grässlich geschlampt hatte.
Wo war seine Frucht? Einen Augenblick war er kurz vor einem Zornesanfall, dann aber erinnerten ihn Schweiß auf der Stirn und feuchte Hände daran, mit welcher Angst ihn der Umstand doch erfüllte. Was sollte er jetzt machen? Sich beschweren gehen kam nicht in Frage. Schon in diesem Augenblick bewegte sich Man auf das Ende des Essensangebotes zu und noch nie war Fahach mit dem Holen länger beschäftigt gewesen als er. Immer unruhiger wurden seine Gedanken, bis er sie kaum noch im Griff behielt. Sollte er etwas anderes statt der Frucht nehmen? Das wäre ein schwerer Bruch mit den Regeln, somit nicht machbar. Mehr aus Ahnung, denn aus Vernunft, ging er schließlich weiter, dachte aber noch an die Milch. Vollgepackt folgte er Man an ihren gewöhnlichen Platz an einem der Tische, zusammen mit vier anderen Brüdern, die bereits beim Essen waren.
„Wo ist deine Frucht?“ Man war es aufgefallen. „Müsstest du nicht heute eine nehmen?“
„Sprich es bitte nicht an.“ Kaum hatte Man gefragt, wollte er eigentlich nur noch flüchten und das Ganze vergessen.
Man besaß nicht genug Feingefühl. „Das bringt Unglück, wenn – „
Unbewusst bemerkte Fahach da eine Möglichkeit, seinen Zorn ein wenig zu entladen, ohne flüchten oder gänzlich ausrasten zu müssen. „Es bringt auch Unglück, wenn du jetzt nicht die Klappe hältst und wie gewohnt anfängst zu essen.“ Sofort aber tat ihm sein Ausbruch leid, vor allem beim Anblick von Mans Ausdruck und den leichten Seitenblicken ihrer Sitznachbarn. „Tut mir leid.“
Schweigend begannen sie zu essen. Mit dem Messer, dass er immer bei sich trug, regelmäßig geschärft und in der Stadt ersetzt, schnitt er das Brot in Scheiben; ebenso den Käse. Die Käsescheiben, alle auf dieselbe Dicke geschnitten, legte er nach und nach sauber angeordnet auf die Scheiben, jeweils bevor er anfing, sie zu essen. Den Brei löffelte er ebenso, immer, wenn er eine Pause mit den Scheiben einlegte, also alle vier Bisse. Die Milch dagegen nahm er nur zu sich, sobald er Interesse an einem Getränk verspürte.
Keiner im Saal sprach beim Essen, daher waren ihre Worte zu Beginn etwas höchst Ungewöhnliches gewesen. Fahach aber hatte Zeit, über all das mögliche Unglück nachzudenken, das sich bereits aus diesen wenigen Fehlern heute ergeben könnten. Nur selten waren ihm schon ähnliche Fehler oder Missgeschicke unterlaufen; nie hatten sie gute Folgen gehabt. Und ebenfalls noch nie waren es so viele Vorfälle auf einmal gewesen, wie an diesem einen Morgen bereits. Und der Tag lag noch vor ihm.
Draußen hörte er acht Glockenschläge.
Nach dem Essen geschah – zunächst – nichts Besonders mehr. Während Fahach während des Mahls aufgrund seiner Sorgen störende Kopfschmerzen entwickelte, machte sich danach eine gewisse Erschöpfung breit. Diese körperlichen Anfälligkeiten und Besonderheiten waren das Einzige, das nicht in Form einer Regel festgeschrieben war und daher trotz seiner Schrecklichkeit nicht – schlimm war. Unvorhergesehene Taten seiner Umwelt dagegen waren steuerbar, denn hier im Kloster sollten sie nicht vorkommen und in der Stadt kannte man sich mit den Brüdern aus. Warum es also immer wieder zu Fehlern der anderen, der Angeheuerten, der Kerle und Tagelöhner kam, war ihm ein Rätsel. Schon lange forderte er für jeden Städter eine Schulpflicht, in deren Rahmen die Lehren des Klosters Einfluss finden würden. Doch gesagt hatte er dies noch niemandem – eine Verwirklichung würde auch die Gewohnheiten stören.
Nach dem Essen gingen Fahach und Man getrennte Wege. Ersterer nahm denselben Pfad zurück, den sie gekommen waren, doch nur bis in den Garten, welcher den Osthof belegte. Die Anwärter warteten bereits auf ihn und seinen Unterricht vor dem östlichen Tor der Gartenumfriedung, aufgereiht wie Perlen auf einer Schnur. Er glaubte alle Gesichter schon mal gesehen zu haben, doch erinnerte sich nur an zwei der Namen; hier im Kloster hatte man sie für die Zeit ihrer Anwärterschaft mit den Namen Butterlöffel und Unfug versehen. Ersterer bekam seinen Namen aufgrund des ihm nicht auszutreibenden übertriebenen Naschens, zweiterer aufgrund der Art, seine liebsten Tätigkeiten auszuführen. Mit beiden hatte Fahach schon genug zu tun gehabt und es schien ihm zweifelhaft, dass Unfug je zu etwas Brauchbaren würde. Sollte er es dennoch jemals schaffen, seinen Unsinn in Gewohnheit zu verwandeln, würde Fahach lieber das Kloster verlassen. Nie könnte er mit dem Unsinn in wiederkehrender Form klar kommen.
Während er dies dachte, machte er seinen fünfzigsten Schritt und stand am Gartentor. Noch boten ihm Gebüsche teilweisen Schutz vor den Blicken der Jungen, doch mit der nächsten Fußbewegung musste er ganz in ihr Blickfeld treten. Das hasste er am meisten. Er mochte es nicht – nicht einmal annähernd – der Mittelpunkt des Geschehens zu sein, und doch gehörte es dazu. Nun gut, hier waren es nur die Knaben, welche weit unter ihm standen, doch wenn es galt, vor viele Gleichgestellte oder schlimmer gar – Höhergestellte zu treten -. Schon jetzt konnte er das Gefühl nicht leugnen, den nächsten Abtritt besuchen zu wollen. Die Gewohnheiten waren aber stärker als seine Angst – und der nächste Schritt gehörte dazu.
Zehn weitere Schritte, und er stand an seinem gewohnten Platz, vor zwei niedrigen Gemüsebüscheln. Er mochte die Arbeit mit den Anwärtern nicht und das nicht nur, weil er dafür im Mittelpunkt stehen musste. Er hasste es, wenn das Leben nicht den Gewohnheiten entsprechend verlief und doch war es sozusagen Regel, bei der Arbeit mit den Anwärtern gegen die Gewohnheiten zu verstoßen. Der Grund dafür war einfach: Die Anwärter hatten sich selbst noch nicht so klare Verhaltensmuster erworben wie die vollwertigen Brüder, so war es klar, dass ihnen immer wieder Fehler unterliefen, mit denen sie auch ihre Umgebung durcheinander bringen konnten. Allen voran galt das natürlich für Unfug. Als jemand, der Regelmäßigkeit in seinem Leben liebte, fand Fahach dies hassenswert. Zum Glück ging es heute nur um Gartenarbeit. – Schlimm genug.
„Preiset die Sonne“, grüßte er seine Schüler, auch wenn er nicht begeistert aussah.
Die Schüler blinzelten, um ihn im grellen Schein der Sonne zu erkennen. „Preiset den Lehrer“, grüßten sie zurück.
Doch Halt. – War da nicht noch etwas anderes gewesen?
„Unterlass das, Unfug!“ Doch dieser sah nur scheinheilig drein. „Heute soll ich euch Fünf etwas über Gartenarbeit beibringen. Wie ihr wisst, stellt der Garten einen wichtigen Beitrag zu unserer Ernährung, also muss jeder von uns diese Arbeit beherrschen.“
„Ja, das wissen wir“, kam es eintönig, hörten sie diese Ansprache doch immer wieder, wenngleich sich die Lehrer in der Wortwahl unterschieden.
„Da die Zeit des Säens bereits hinter uns liegt, widmen wir uns heute völlig der Entfernung von Unkraut und Stutzung des Grases. Habt ihr alle eure Sicheln dabei?“
Die Anwärter klopften kurz zur Bestätigung auf die kleinen Werkzeuge an ihren Hüften.
„Ja, haben wir“, sprach Unfug und legte ein seltsames Grinsen auf, was nicht zum gewohnten Ablauf gehörte und Fahach damit verunsicherte.
Angst brauchte er diesmal aber keine haben. – Er war es ja sehr wohl gewohnt, wie sehr diese Bälger den Ablauf durcheinander bringen können. „Halt dich an die Regeln, Unfug.“
„Tue ich doch. – Und sie?“
„Was? – Unfug -“
Doch bevor Fahach meckern konnte, klopfte Unfug nochmal mit einem nachdrücklichen Blick auf seine Sichel. Fahachs Verärgerung konnte nur noch steigen, doch kam ihm ein Geistesblitz: Schnell guckte er auf seine eigene Hüfte. – Verdammt! Fünf Schritte vor – unplanmäßig – dann stand er vor Unfug.
„Gib mir deine Sichel.“
„Was?“ Sein Grinsen erstarb.
„Wichtigste Regel der Anwärter – Widersprich nicht den Lehrern. Und jetzt gib mir deine Sichel. Oder willst du die nächsten Wochen über die Aborte reinigen?“
„Und wie soll ich dann -?“
Fahach konnte sich kaum noch halten. „Das ist dein Problem. – Sei still.“
Tatsächlich hielt Unfug den Mund, so dass Fahach auf seinen Platz zurückkehren konnte. – Mit Unfugs Sichel.
„Also. – Wo waren wir. – Ihr habt alle eure Sicheln -“ Ein wenig musste er überlegen, wo er stehengeblieben war. Wieder etwas, das nicht in den Plan passte. – Wenngleich man beim Umgang mit Anwärtern auf Unregelmäßigkeiten vorbereitet sein musste. – Er hasste die Arbeit nicht umsonst; noch nie hatte er sich gut darauf vorbereiten können. „Ach ja: Ihr alle wurdet über die hier angebauten Pflanzen sowie Schädlinge unterrichtet? Und ihr alle wurdet bereits im Einsatz der Sicheln unterrichtet? Dass ihr euch nicht schneidet und nicht den guten Pflanzen schadet?“ Mehrmals wurde ihm bejahend geantwortet. Kurz kam ihm die Frage in den Sinn, was er dann eigentlich mit dem nutzlosen Pack anfangen sollte. „Gut. – Dann bleibt uns nur übrig, das Unkraut zu entfernen.“ Da niemand etwas sagte, fuhr er fort. „Ihr zwei arbeitet dort hinten, ihr zwei auf der anderen Seite. Unfug, du kommst mit mir, auf dich muss ich aufpassen. Wenn ihr anderen Fragen habt, kommt ihr zu mir.“
Während alle ihren zugewiesenen Aufgaben nachgingen, folgte Unfug ihm. Die Stelle, welche Fahach ihnen beiden ausgesucht hatte, lag in der Nordostecke des Gartens. Niedrige Büschel von Kohlpflanzen wuchsen dort, in Nachbarschaft der Gewürze. Doch auch unerwünschte Pflanzen wollten Teil haben an der Fülle von Nährstoffen, welche geboten wurden. Das aber konnte man nicht erlauben.
„Entferne das Unkraut dort zwischen dem Kohl – ich sehe zu, ob du alles richtig machst.“
„Und wie soll ich das machen, ohne Sichel?“
„Hat man euch noch nicht beigebracht, dass ihr das mit der Sichel eh nicht machen könnt? Geh auf die Knie und reiße die Pflanzen mitsamt der Wurzeln aus. – Und achte auf die Kohlpflanzen.“
Unfug sah das Unkraut eine Weile nachdenklich an. „Muss man diese Blumen wirklich ausreißen? Seht doch, wie hübsch sie sind.“
Fahach spürte den Zorn. „Wir haben sie nicht angepflanzt und wollen sie nicht. Also reiß sie aus.“
„Und wenn ich sie sammle und beim Pfad zum Kloster anpflanze? Sie würden den Weg verschönern. Zum Beispiel heute zum Fest.“
„Was?“
Fahach konnte den Sinn des Vorschlags nicht ganz verstehen. Noch nie hatte der Pfad den Hügel hinauf anders ausgesehen. Das würde den Tagesablauf von wirklich jedem hier überraschend verändern. „Unmöglich!“
„Warum?
„Fragst du das jetzt wirklich? Dann, befürchte ich, wirst du noch für Jahre einfacher Anwärter bleiben. Du kannst nicht einfach so alles hier verändern. Das würde niemand von uns verkraften. – Auch du nicht, wenn es… einmal so weit ist. – Und wenn nicht, bist du hier falsch.“
Es sah aus, als wollte Unfug noch etwas sagen, doch schwieg er. Schließlich folgte er sogar den Anweisungen. Inmitten des Kohlfeldes kniete er sich auf die Erde und fing an, die gewachsenen Gräser aus dem Boden zu reißen.
„Du arbeitest nicht nach Plan. Fang hier an der Ecke an, folge der Reihe, wechsle zur nächsten und so weiter.“
Unfug ließ sich seinen Unmut anmerken. „Bald werde ich gar nicht mehr zum Arbeiten kommen. – Und ihr auch nicht.
„Ich werde schon mitmachen, sobald du es endlich verstanden hast.“
Der Anwärter schien zwar mit den Augen zu rollen, doch machte er weiter, sobald er die Ecke erreicht hatte. Etwas unvorsichtig zwar, doch er arbeitete.
„Wenn du dir diese Art aussuchst, wirst du bei deinen zukünftigen Gartenarbeiten genauso anstrengend weiter machen müssen.“
Plötzlich traf Fahach ein heraus gerupftes Unkraut. Unfugs Grinsen verschwand zwar schnell wieder, doch war es da gewesen.
„Wenn du dich nicht endlich zu benehmen und beherrschen lernst, werde ich es dem Herrn der Anwärter melden müssen, und dann schicken sie dich bald wieder Heim.“ Er musste zugeben, dieser Gedanke bereitete ihm Freude, denn es würde Ruhe und Sicherheit bringen.
„Das geht nicht; ich habe kein Zuhause.“
Fahach stutzte, doch wollte nicht noch mehr wissen. „Mach weiter; ich habe heute noch viel zu tun.“
Tatsächlich blieb Unfug dann ruhig. Er riss ein Unkraut nach dem anderen aus und warf sie achtlos zur Seite. Die richtige Beseitigung sollte ihm jemand anders beibringen müssen. Fahach selber suchte sich eins der Gewürzfelder aus und ging, nachdem er damit fertig war, zum nächsten. Plötzlich hörte er neun Gongschläge.
Neun? Das bedeutete – schnell erhob er sich, während er schon Man sich nähern sah. Er hatte tatsächlich die Zeit vergessen; zu diesem Augenblick wollte er bereits unterwegs zum Ältesten sein. Was war heute nur los mit ihm? Schnell machte er sich auf den Weg, seinen alten Pfad benutzend, aber bei doppelter Geschwindigkeit. Nur kurz grüßte er Man.
„Übernimm du!“
Die Anwärter dagegen vergaß er in seiner Eile.
III
Die Räume des Ältesten befanden sich neben der Gebetshalle; man konnte sie über zwei Wege erreichen: Durch die Wohnräume der Brüder sowie die Räume der Oberen – aber auch durch die Halle. Und obwohl er damit an der Hintertür klopfen musste, war Fahach der Weg durch die Halle bei seinem ersten Besuch beim Ältesten am liebsten gewesen. Tatsächlich hatte er damals aber einfach nur gesehen, wie der Älteste aus der Halle durch seine eigene Tür verschwunden war und dachte, das sei der einzige Weg. Der Älteste war zum Glück nicht erzürnt gewesen und sobald Fahach Bruder war, musste er diesen Weg in seinen Plan übernehmen. Der nächste Älteste hatte zu seinem Antritt sogar schon Kenntnis davon, war er doch zuvor selbst Oberster gewesen. Zwar hatte er Fahach nie darauf angesprochen, doch als er die neue Regel einführte, alle zukünftigen Anwärter über den genauen Weg in seine Räumlichkeiten aufzuklären, hatte Fahach fortan immer ein schlechtes Gefühl, wenn er seinen Vorgesetzten besuchen musste. Mittlerweile hoffte er sogar immer, überhaupt nicht hin zu müssen und hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, nach Ausweichmöglichkeiten und Ausreden zu suchen, warum er nicht zu ihm gehen müsse. Heute aber hatte der Älteste selber seinen Besuch angeordnet, weshalb er dem auch Folge leisten musste.
Sein Weg führte ihn aus dem Garten heraus, zurück durch dessen Osttor, dann nach Norden, Westen und Süden einmal um den Garten herum. Wie es seine Gewohnheit war, musste er während dieses Umganges den Garten beobachten,; wie dort alles am Wachsen war. Doch bei doppelter Geschwindigkeit, war das schwer, also bemerkte er kaum Einzelheiten. Schließlich gelangte er in den Osttunnel und durchquerte ihn. Auf dem Haupthof galt es diesmal, nach rechts abzubiegen, beim Haupttor dann nach links und letztlich nochmal nach links.
Doch was machte dieser Wagen dort in seinem Weg, mitten im Haupttor stehend? Noch hatte dieser ein paar Augenblicke Zeit, während Fahach sich ihm näherte. Er bemerkte die beiden daneben stehenden erst, als diese laut wurden.
„Ich bin mir sicher, ich sollte es heute bringen!“
„Wir haben aber keinen Platz!“
„Und was soll ich nun damit machen?“
Der Torwächter war ein Anwärter, der kaum Ahnung zu haben schien, während der Wagen einem Städter gehörte. Zum Glück bemerkte ersterer den sich nähernden Fahach und schien sogar zu wissen, was das bedeutete und was er zu tun hatte. Mit einem aufgeregten Blick sah er zwischen dem Bruder und dem Kerl hin und her, bevor er sich dann entschied.
„Bringen sie es in Lager Zwei, dort haben wir noch Platz für Notfälle. Kommen sie für die Bezahlung aber erst morgen wieder, wenn sie auch erwartet werden.“
Der Kerl grummelte zwar etwas vor sich hin, doch fuhr er seinen Wagen vor, gerade in dem Augenblick, in dem Fahach dessen vorher eingenommen Platz erreichte. Dem Anwärter warf er keinen Blick zu, doch in seinem Inneren machte sich ein starkes Gefühl der Dankbarkeit breit, das fast in Liebe umschwang. Wie gern hätte er doch den Knaben umarmt und ihm gedankt, doch das ging nicht. Also wünschte er ihm in Gedanken nur alles Gute, während er sein Torhäuschen kreuzte und Richtung Westtunnel ging.
Und da versperrte der Wagen den Tunnel. Sein Gefühl der Dankbarkeit schwang in Hass um, als er fürchten musste, dass der Tunnel für ihn nicht mehr begehbar sein würde. Gedanklich verfluchte er den Torwächter, welcher ein einfaches Hindernis in ein Unmögliches verwandelt hatte, und flehte dann voll Verzweiflung die Sonne an. Der Wagen aber, nachdem er kurz damit beschäftigt war, in den Tunnel zu passen, verschwand hindurch. Sofort erkannte Fahach seinen Fehler und bat in Gedanken den Anwärter um Vergebung für seine Flüche. Mit Scham und Erleichterung zugleich erfüllt, folgte er dem Wagen durch den Tunnel. Schließlich kam er über den Hof in die Kapelle und suchte dort die Tür zu den Räumen des Ältesten auf.
Die Tür war bereits schmucklos gewesen, der Gang dahinter wirkte kaum anders, als die in den restlichen Wohnbereichen. Dafür standen dem Ältesten aber mehr Räume zur Verfügung, allesamt vom restlichen Kloster, auch den Räumen der Obersten, abgegrenzt. Er hatte seinen eigenen kleinen Bücherraum, einen Arbeits- und einen Schlafraum sowie ein Lager. Noch nie aber hatte Fahach ihn außerhalb seines Arbeitsraumes angetroffen. Dies musste der Älteste natürlich auch wissen und da er es war, der ihn herbestellt hatte, würde es großes Unglück für sie beide bedeuten, wenn diese Gewohnheit geändert würde. Nun war Fahach aber etwas später dran, als er geplant hatte. – Doch andererseits – hatte er eine genaue Zeit genannt bekommen, zu der er sich melden sollte? – Aber wiederum – er ging doch immer, wenn die Aufgabe hatte, zu dieser Zeit.
Er fand den Ältesten im Arbeitszimmer vor, über ein Buch gebeugt. Die Tür war offen gewesen, sonst hätte Fahach geklopft. So aber blieb er auf der Türschwelle stehen und wartete, wie er es immer tat. Trotz seiner Jahre, die er im Kloster verbracht hatte, war er gegenüber Vorgesetzten immer noch nicht so frei, wie es viele andere waren. Um seine Angst zu vergessen warf er einen Blick durch den Raum, wie so oft zuvor, und betrachtete die Bücher in den Regalen, die schmucklosen Schränke, den feinen Teppich mit der aufgestickten Sonne, das schmale Schreibpult und das ebenso schmale Lesepult.
„Ah, da bist du ja. Ich werde es wohl nie lernen. – Irgendwann wirst du mich noch zu Tode erschrecken. Vermutlich kamen so meine Vorgänger ums Leben. In meinem nächsten werde ich mich daran erinnern, auf dich besser zu warten. – Naja, wie auch immer. Du bist ja nicht ohne Grund hier. Um es nicht zu sehr hinauszuzögern – hier hast du die Einkaufsliste. – Vergiss dort unten aber nicht, dass unsere Gewohnheiten außerhalb der Klostermauern nur teilweise Bestand haben. Und immer daran denken in die Sonne zu sehen!“
Die Besprechungen mit dem Ältesten waren schon immer so kurz gewesen. Wenn es mehr zu besprechen gab, musste Fahach auch öfter erscheinen.
Für den Rückweg musste Fahach den langen Weg durch die Bereiche der Obersten sowie der Wohnräume nehmen. Während er unbewusst darauf achtete, welche Fließen und Bretter er dabei betreten musste, hatte er Zeit zum Nachdenken und Durchlesen des Einkaufszettels. Der Einkaufsgang war dazu gedacht, kleinere Einzeldinge aus der Stadt zu besorgen, die nicht mit den großen Lieferungen gekommen waren. Gründe dafür gab es mehrere. Besorgungen, die man nicht rechtzeitig auf die großen Listen setzte, Dinge, die geheim bleiben sollten, einzelne Wünsche, frische Waren und ähnliches. Diesmal standen lauter Kleinigkeiten auf der Liste, die er selber aber noch aus der Stadt hoch tragen konnte, Dazu gehörten ein Hammer – warum auch immer der einzeln zu kaufen war -, ein bestimmtes Buch aus dem Buchladen, mehrere Kräuter aus dem Osten, eine einzelne mittelgroße Glasflasche vom Glasbläser, und – besonders seltsam – einen der bekannten Fischkuchen vom Bäcker am Hafen
Auf seinem Weg begegnete ihm kaum ein Bruder, die alle woanders Aufgaben zu haben schienen. Die wenigen, die ihm über den Weg liefen, beachtete er nicht. Grüße waren ihm teilweise bekannt, da sinnlos, wenn man sich sowieso andauernd sah. Teils war es für ihn überraschend, wenn er an einer bestimmten Stelle des Klosterganges einen Bruder erblickte, den er da noch nie zuvor gesehen hatte. Wann immer dies geschah, erschrak er kurz und sah dies auch beim Bruder; so grüßten sie sich. Danach tat man so, als hätte man niemanden erblickt und ging weiter. Auf diese Weise kam er durch die Wohnräume und genehmigte sich noch kurz einen ruhigen Augenblick. Danach konnte er den geraden Weg hinaus wählen.
Da er damals, als er das erste Mal in die Stadt musste, es einigermaßen eilig gehabt hatte, konnte er auch heute ohne Umwege zum Tor gehen, warf nur noch einen kurzen Blick auf den Brunnen. Von dort ging es gerade bis zum Tor. Hier galt es, ohne Ausnahme, den Torwächter zu grüßen, denn so war es Sitte beim Verlassen und Betreten des Klosters, auch wenn er vorhin den Anwärter nicht beachtet hatte. Wäre es eine weitere seiner Gewohnheiten, so hätte er ihm jetzt gerne zugelächelt, als Dank für seine Rettung. Doch so nickte er nur im Vorbeigehen, ohne wirklich hinzusehen, und merkte sich aus dem Augenwinkel das Gesicht des Knaben, um ihm später mal gute Behandlung zuteil werden zu lassen.
Dann aber kam der große Augenblick, der ihm immer wieder Angst einjagte und ihn wünschen ließ, sich im eigenen Bett verkriechen zu können: Der Gang hinaus in die Welt. Dabei setzte er doch bloß einen Fuß hinaus vom Klosterhof auf den Zugangsweg; etwas schreckliches gab es dort noch nicht. Aber am Ende des Weges, welcher im Bogen den Hang des Hügels hinunter führte, lauerte die Stadt, mit all ihren Einwohnern, die ihm nahe kommen, die nur teilweise auf seine Gewohnheiten achten, die seine Ängste nicht verstehen würden. Und dann stand er wirklich mitten in ihr und ihre Gebäude ragten rechts und links in die Höhe, säumten schmutzige Straßen und Tier wie höheres Lebewesen schnüffelte und eilte durch die Gassen.
Wie immer blieb er kurz stehen, während seine Angst ihn kaum atmen ließ. Die schiere Masse an fremden Wesen war ihm zu viel und ließ ihn gewahr werden, weshalb er damals überhaupt ins Kloster gewechselt war. Die Leute drängten sich immer wieder aneinander vorbei, nur teilweise unter Rücksicht, und auch er, kaum, dass er den Ort des Wuselns betreten hatte, musste schon Schritte zurück und zur Seite machen, konnte nicht ruhig da stehen und nachdenken. Letztlich schaffte er es dennoch, sich den Plan zu machen, in Richtung des am weitesten entfernten Geschäftes zu gehen, um dessen Besorgung als erstes zu erledigen. Danach würde er zurück in Richtung Kloster eilen und alles dort am Wegesrand liegende mitnehmen. Der fernste Laden war aber ausgerechnet der Bäcker am Hafen, bei dem es die feinen Fischkuchen gab. Also würde er die ganze Zeit auf diesen aufpassen müssen.
Er hatte den halben Weg zurückgelegt und gerade den Markt umgangen, über den er schon auf dem Rückweg sich quetschen müsse, da näherte sich ihm jemand aus einer der Seitengassen.
„Habt Mitleid mit einem alten Kämpfer“, sprach es da zerlumpt und einbeinig.
Ja wusste der denn nicht, dass man die Brüder nicht um Almosen anbettelte? Sich aus Versehen in den Weg stellen war für einen Städter ja noch möglich, doch diesen Kerl solle die Sonne verbrennen, wenn seine Worte absichtlich gesprochen waren. Also achtete Fahach nicht auf ihn, ging weiter und ließ seine Rückansicht sprechen. Doch der alte Lump ließ nicht locker.
„Heda! Das ist aber nicht fein! Möge euch der Blitz treffen!“
Fahach schauderte es und sein Schritt beschleunigte sich, während er nur auf helle Kopfsteinpflaster trat. Was der Alte tat, sah er nicht mehr.
Schritt für Schritt bewegte er sich vorwärts, vorbei an beschäftigten Geschäften und geschäftigen Beschäftigten, Mann und Maus. Immer wieder kamen ihm Leute, Tiere und Wagen in den Weg. Es war erlaubt, in diesen Fällen stehen zu bleiben oder sogar einen groben Umweg zu wählen. Oft erkannten die Städter sogar, was und wer er war, und gingen ihm von selbst aus dem Weg. Doch irgendwie schien dieses Wissen vor allem den Älteren gegeben zu sein, derweil die Jungen am meisten Unsinn trieben; einmal sogar wäre ein Knabe fast gegen ihn gestoßen. Doch letztlich schaffte er es, unbeschadet bis zum Hafen zu gelangen, wo er am Ende einer der alten Straßen auf ein unscheinbar aussehendes Haus zusteuerte, um dort den Fischkuchen zu kaufen.
Vermutlich konnte ein Bäcker am Hafen gelegen gar nicht auf eine andere Idee kommen. Der Laden war um diese Tageszeit recht ruhig; die meisten waren wohl schon früher einkaufen gewesen. Die Tür stand aber offen und lud ihn geradezu ein. Wie es seine Gewohnheit war, ging er aber erst einmal nur daran vorbei und warf einen verstohlenen Blick durchs Schaufenster, bevor er sicher war, dass er hineingehen konnte. Drinnen stellte er sich sofort, ohne sich weiter umzusehen, vor die Theke.
„Hallo. Was darf es sein?“ begrüßte ihn der Verkäufer und ließ sich nicht anmerken, ob er in Fahach den Bruder erkannte, der er war.
Dieser war aber zufrieden. „Einen Fischkuchen; einen ganzen.“
„’Nen Kuchen, gerne doch“, sprach der Mann und kurze Zeit überreicht er einen solchen an Fahach.
Bis hierhin war doch alles bestens gegangen. Nachdem er gezahlt hatte und das Geschäft wieder verließ um gen Markt zu gehen, diesmal eine andere Straße nehmend – kam ihm wieder der alte Goldbettler entgegen. Wie aus dem Nichts war er aus einer Seitenstraße aufgetaucht.
„Ihr da! Habt ihr nicht eine Münze? Oder etwas zu essen? Ich habe auch für euch im Krieg gekämpft!“
Hatte der Alte es immer noch nicht verstanden? Verfolgte er ihn etwa? Fahach versuchte nicht auf ihn zu achten, beschleunigte seinen Schritt und trat auf die nächsten hellen Pflaster.
„Habt ihr denn überhaupt kein Herz, Mann!“
Fahach überkamen Ahnungen von in den Rücken stechenden Messern und dergleichen mehr, weshalb er kaum noch auf die Pflaster achten konnte; nur noch fliehen wollte. Zum Glück setzte der Alte nicht weiter nach, und als Fahach nach mehreren Straßen endlich anhielt und sich umsah, war er verschwunden. Sein Herz raste, sein Körper fühlte sich schwach, sein Hirn war eigentlich nicht mehr anwesend. Immer dasselbe, wenn er in die Stadt musste. Er war kurz davor, den Ältesten zu verfluchen, doch galt es noch, Einkäufe zu erledigen.
Sein hastiger Gang hatte ihn sogar vor den nächsten Laden gebracht. Er befand sich in einer schmalen Seitengasse, die trotzdem gut belebt war, was ihm natürlich gar nicht gefiel. Grund für die Lebhaftigkeit war der hohe Anteil von Zugereisten, denen dieser Stadtteil als Umschlagplatz diente. Hier befand sich auch der Laden, in dem man allerlei Kräuter aus aller Welt bekam, von ganzen Pflanzen bis zu getrocknetem und gemahlenem Pulver. Erst zweimal war Fahach dort gewesen und jedes Mal hatte er es gehasst. Beliebt, wie das Geschäft war, drängten sich die Massen hinein, beschubsten einen, wenn man selber noch kurz überlegte und rückten sogar noch an der Kasse näher auf, als es jedem lieb sein könne. Und genau dort musste er hinein.
Alle seine Befürchtungen hießen sofort Wahrheit, war es an diesem Wochentag und zu dieser Uhrzeit doch besonders voll. Vorsichtig versuchte er zu dem gewünschten Regal zu kommen, ohne jemanden berühren zu müssen oder gar selber berührt zu werden. Nur wenige der Einkäufer wussten um die Brüder und ihre Bedeutung, weshalb er manch Unbill in Kauf nehmen musste. Letztlich warf er allen, die ihn ansahen, bloß noch giftige Blicke zu, wünschte sich, dass sie woanders hinsähen, ihn in Ruhe ließen. Der Fluchtgedanke war groß, doch blieb er mit dem gefundenen Beutelchen Pulver in der Kassenschlange, derweil sein Körper sich seiner Feuchtigkeit entledigen wollte.
Endlich wieder im Freien dann, suchte er sich ein verstecktes Plätzchen, um sich zu beruhigen und überlegte, wo er weiter machen müsse. Den Glasbläser und den Gemischtwarenladen fand man am alten Marktplatz, während sich der alte Buchhändler unweit des Aufstiegs zum Klosterhügel versteckt hielt. Sein nächstes Ziel würde also der Markt werden. Dies behagte ihm nicht, so überlegte er nach einer Möglichkeit, den stets überlaufenden Markt zu umgehen.
Die Tasche, in der er seine bisherigen Errungenschaften trug, fest an sich klammernd, näherte er sich dem Markt durch eine Seitengasse. Die Sonne, seine Herrin, stand mittlerweile schon hoch am wolkenlosen Himmel. Wie immer hatte er sich zu stark gekleidet. Obwohl ihn das für gewöhnlich wenig kümmerte, ließ es ihn doch zusammen mit der Angst stärker schwitzen, als es ihm lieb war. Und warum war ihm so, als würde sie gar Pfeile aussenden, ihn zu preisen? Wollte sie ihn strafen für seine Langsamkeit? Wollte sie ihn anspornen und Glück verheißen? – Warum eigentlich zweifelte er an ihr, seiner Herrin? – Oh Sonne, verzeih!
Der Markt war voll, wie erwartet, doch hatte er es auch schon schlimmer erlebt. Der Gemischtwarenladen lag nur zwei Häuser gen Links. Trotzdem musste er immer wieder anderen Einkäufern und Herumstrollenden ausweichen. Diesmal aber achtete einer nicht gut genug auf ihn und streifte seinen Arm. Ohne Entschuldigung ging derjenige weiter, derweil Fahach sich so erschrak, dass er auf das falsche Pflaster trat.
Sofort erstarrte er und sah hinab auf seinen Fuß und den Fehltritt. Wie konnte das nur geschehen? Und warum war es geschehen? Wollte die Sonne ihn strafen? Würde sie ihn denn strafen ob des Fehlers? Oh welch Unglück musste es doch bringen! Der wievielte Fehler war das schon an diesem Tag? – Doch halt, er war in der Stadt und ungewöhnliche Ereignisse waren dort an der Tagesordnung. – Und doch hätte er es verhindern müssen.
„Geht es ihnen gut?“ fragte plötzlich eine Frau, die ihn wohl schon länger beobachtet hatte.
Wie lange stand er dort schon so gebannt? Als sie sprach, erwachte er aus seiner Starre und sein Gemüt wechselte von dumpfer Niedergeschlagenheit zu sprunghaft aufweckendem Erschrecken.
„Äh – ja“, war alles, war er murmelte, bevor er schnell und ungeschickt seinen Weg fortsetzte, als würde ihn ein wildes Tier verfolgen, und in dem Gemischtwarenladen verschwand.
Ein Hammer dort immerhin schnell gekauft; seltsamerweise war kaum Kundschaft anwesend und der Verkäufer stellte auch keine Fragen. Wäre er weniger abweisend gewesen, hätte sich Fahach sogar zum Bleiben verleiten lassen. Zurück auf dem Markt nahm er sich nicht die Zeit, noch einmal nach der Frau zu sehen, sondern wählte die nächste Seitengasse, um die Gebäude des Marktes von hinten zu umgehen, bis er in der Nähe des Glasbläsers war. Dort einzukaufen brachte sogar überhaupt keine Schwierigkeiten mit sich, so dass er sich letztlich in Richtung des Klosters und des Buchladens aufmachen konnte. Doch als er durch eine weniger belebte kleine Straße ging und lediglich hin und wieder warten musste, bis ein Fußgänger das von ihm angewählte Pflaster verließ, kam wieder der alte Bettler vorbei.
„He – du da – dich kenn‘ ich doch!“ Wieder einmal musste Fahach seinen Schritt beschleunigen, während er sich schon wie in Schweiß gebadet fühlte.
„Jetzt bleib doch mal stehen!“ Und da stolperte Fahach. In der Zeit, die dieser sich zum Erholen benötigte, war der Alte bei ihm. „Ich weiß, du willst mir nichts geben, aber du hast das hier verloren!“ Damit gab er ihm den Hammer, den Fahach kurz zuvor erst erstanden hatte, und trottete wieder davon.
Fahach aber fühlte sich, als wäre er dem Tod entronnen – und gleichzeitig schämte er sich ein wenig. Diesmal hätte er einfach nur anhalten müssen, vielleicht lächeln, sich bedanken, sich entschuldigen für die frühere Unfreundlichkeit – doch der Mann hätte wissen müssen, dass man sie, die Brüder aus dem Kloster, in der Stadt nicht anspricht – aber Fahach hätte etwas sagen können, und wenn es nur ein Danke gewesen wäre. – Immer wieder gingen ihm die letzten Worte des Alten durch den Kopf und Möglichkeiten, wie er hätte antworten können. Spät erst fiel ihm wieder ein, dass er mitten auf der Straße stand, dort nicht stehen bleiben könne und noch etwas zu erledigen hatte. Etwas, nach dem er endlich heim und zum Mittagessen gehen könne. Wenig später war er im Buchladen angelangt.
„Ah, willkommen. Euch habe ich ja schon lange nicht mehr hier gesehen. Die Sonne zum Gruße!“
Ebenso wie der Mann, verbeugte auch Fahach sich kurz. „Die Sonne zum Gruße. Ja, ich hatte lange nicht mehr den Auftrag. Ihr kennt uns ja.“
Der Mann wusste um die Gebräuche, sowohl auf die Brüder im Allgemeinen als auch auf Fahach im Besonderen bezogen. Er konnte immer die richtigen Antworten geben und wusste, was man wollte, bevor man es selber sagte. Gleichzeitig vermittelte er noch eine Freundlichkeit, die nicht vorgetäuscht sein konnte, und die einem sich sofort wohl fühlen ließ. Fahach hielt sich immer gern im Laden auf, jedenfalls, wenn es keinen anderen Kunden gab, was fast immer zu traf. Manche der Brüder hatten gar versucht, den Mann zu überzeugen, selber ins Kloster zu gehen und sei es nur für einige Tage. Fahach aber war dagegen. Erstens würde er dann seinen Hafen der Ruhe in der Stadt verlieren, zweitens fand er alle, die er zu oft sehen musste, sehr schnell störend.
Eine Weile verbrachte er im Buchladen, durchstöberte die Regale, sprach dann und wann mit dem Händler und kaufte letztlich das Buch, wegen dem er gekommen war. Und manchmal vergaß er sogar kurz die eine oder andere Regel und Gewohnheit und bemerkte das nicht einmal. Aber schließlich musste er heim, durch eine kleine Menge in der Straße und achtete wieder genau darauf, wo er hin trat und dass er niemandem zu nahe kam.
In der Ferne hörte er bereits elf Glockenschläge.
Buch 2: Der Mittag
IV
Das Klostertor stand weit offen, doch der Fußgängereingang war geschlossen. Dem war nicht immer so, und trotzdem war Fahach es gewohnt. Langsam klopfte er dreimal an der Pforte. Kurz danach wurde sie ihm geöffnet und der Torwächter bot Eintritt. Fahach setzte erst den rechten Fuß über die Schwelle in den Hof, dann zog er den linken nach. Doch – was noch nie zuvor geschehen war – er blieb hängen und stolperte. Den Tormann an sich beachtete er nicht, doch wusste er um seine Nähe und fühlte sich plötzlich sehr beobachtete. Hastig ging er weiter, als wäre nichts geschehen, ohne Umwege zum Osttunnel, wo er sich wieder normaler fühlte, und über den Osthof, an dem nun leeren Garten vorbei.
Als er am Speisesaal vorbeikam, sah er bereits viele dort versammelt, doch ging er noch in einen Waschraum. Es waren jede Menge verpackte Seifenstücke vorrätig, so nahm er sich eine Packung, entkleidete sie und wusch sich. Die benutzte Seife entsorgend, ging auch er in den Saal. Man saß bereits an ihrem Stammtisch und grüßte ihn. Fahach nickte nur kurz, stellte seine Besorgungen des Morgens am Tisch ab und ging, um sich Nahrung zu verschaffen.
An diesem Tag war Fischtag, was für ihn die Befürchtung erhärtete, dass es ein Unglückstag war, denn er mochte Fisch nicht. Dass er schon die ganze Zeit über welchen mit sich rumschleppen musste, war eine schwere Beleidigung für seine Nase. An Fischtagen konnte er immer nur die Beilagen essen, da es keinen Ersatz im Angebot gab. Auch andere im Kloster betraf das, da viele mal das eine oder andere nicht mochten. So war es Gewohnheit, dass immer wieder jemand einen Fastentag hatte. Einige betrachteten das als Unglück, andere als gute Gelegenheit. Erstere hatten es sich mittlerweile teilweise zur Gewohnheit gemacht, sich über die Umstände zu beschweren, doch den alten Klosterregeln folgend, änderte sich daran nichts. Fahach hielt sich grundsätzlich lieber aus Ärgerreien raus und musste sich daher an Fischtagen weiter mit den Beilagen begnügen. Heute waren es eine Getreideart, Soße und etwas Gemüse. Mit seiner mageren Beute begab er sich zurück zu Man an den Tisch.
„Fischtag heute“, stellte dieser fest und Fahach verzog das Gesicht.
„Wann die Leute es wohl mal verstehen werden, dass Fisch nicht zum Essen gedacht ist.“
„Wie war es in der Stadt?“ wechselte Man nach einem Bissen plötzlich die Richtung.
„Ach – du weißt schon – ich bin froh, da raus zu sein. Aber nach dem Essen muss ich gleich meine Einkäufe abliefern. Danach kann ich mich endlich mal erholen.“
„Wie immer also“
„Ja, wie immer. Und wie war es bei den Büchern?“
„Mmh! Ach ja! Ich wollte dir etwas erzählen. Ich habe einen Band über die Geschichte des Klosters entdeckt. Dafür interessierst du dich doch. Warte, ich beschreib‘ dir den Weg da hin…“
Während Man das machte, versuchte Fahach sich an seinem Essen. Es war annehmbar, doch fehlte so etwas wie eine Hauptzutat. Trotzdem mampfte er vor sich hin, wie es seine Gewohnheit war, ohne groß darauf zu achten, was er gerade aß. Und plötzlich biss er auf etwas hartes. Ein Stück Gemüse? Kurz hörte er mit dem Essen auf. Sein Gefühl verlangte, das Stück herauszuholen, doch müsste er es dann auf den Teller vor sich legen und diesen hatte er noch nie so abgegeben, dass er nicht völlig leer war. Blieb die Möglichkeit, das Stück unter den Tisch fallen zu lassen, doch erstens wusste jeder, dass er immer an dieser Stelle saß und zweitens könnte ihn auch noch jemand bei der Tat beobachten. Kurz überkam ihn ein Würgereiz, welchem nachzugeben am schlimmsten gewesen wäre – so schluckte er einfach, ohne groß nachzudenken, seinen Mundinhalt hinunter.
Man, der immer noch fleißig erzählte, bemerkte nichts, selbst, als Fahach kurz aussah, als müsse er sich wirklich übergeben, er erbleichte und Schweißperlen auf seine Stirn traten. Kurz darauf hatte Fahach sich gefasst, wobei es besonders geholfen hatte, etwas zu trinken. Danach verspürte er zwar eigentlich keinen Hunger mehr, musste aber dennoch weiter essen. Widerwillig schob er sich einen Bissen nach dem anderen in den Mund, während Man weiter munter von Dingen erzählte, die er erlebt oder über die er nachgedacht hatte. Sobald er endlich mit Essen fertig war, musste Fahach noch kurz warten, bis auch Man sein Mahl beendete.
Danach verabschiedeten sie sich voneinander; Man wollte seine jetzige Freizeit bei einem Spaziergang verbringen, während Fahach mit den Einkäufen ins Lager musste. Wer auch immer die einzelnen Gegenstände bestellt hatte, würde sie sich dann dort abholen. Dieses eine besondere Lager war aber nicht das große im Westflügel, sondern ein kleines auf der genau gegenüber liegenden Seite im Ostflügel. Bei seinem ersten Gang dorthin hatte es geregnet, weshalb er es sich als Weg angewöhnt hatte, durch den Bereich der Küchen, Krankenzimmer, Wintergärten und dergleichen zu gehen, also einmal durch den ganzen Ostteil des Ostflügels. Immer, wenn es regnete, freute er sich über diese ursprüngliche Entscheidung bei diesem Gang – und verfluchte sich zum Beispiel morgens zwischen Gebetshalle und Speisesaal, denn er hatte es nie geschafft, sich für Regen andere Gewohnheiten zuzulegen.
In den Gängen begegnete er herumwandernden Brüdern, denen aus dem Weg zu gehen er nicht schwer fand, da alle es sich angewöhnt hatte, auf der ihren rechten Seite zu gehen, so dass Entgegenkommende links waren. Schwieriger dagegen war es, wenn man den zu benutzenden Gang durch einen zu langsam Vorausgehenden versperrt vorfand. Hierfür hatte sich jeder der Brüder einen Ausweg einfallen lassen müssen. Da Fahach sowieso nur auf Fliesen und Brettern mit bestimmten Größen, Farben und Abständen zueinander ging, konnte er solche Fälle einfach überholen, doch durfte dann natürlich niemand entgegen kommen. Seltsam dagegen fand er, dass immer noch Städter damit beschäftigt waren, Fußböden und Wände zu reinigen und abzustauben. War er so lange schon nicht mehr in diese Gegend gekommen, dass er dies nicht wusste? Oder nur noch nie zu diesem einen Zeitpunkt an diesem einen Wochentag? Eigentlich war es ja egal, dachte er, bis er plötzlich mit einer Frau zusammenstieße, die den Boden wischend aus einem Seitengang kam und nicht auf ihn achtete. Überrascht stolperte er zurück und wusste nicht, was er machen sollte.Doch die Frau übernahm.
„Verzeiht mir, Herr!“ sprach sie, blickte unterwürfig und wehleidig zugleich.
Das milderte seinen Zorn. „Was – was macht ihr hier? Warum achtet ihr nicht auf euren Weg? Wisst ihr überhaupt, wo ihr seid?“
Die Frau wich ein wenig von ihm fort. „Verzeiht mir – es ist mein erster Tag hier.“
„Ihr müsst doch wissen, auf was ihr hier im Kloster zu achten habt. – Ich werde euch melden.“
Jetzt schlich Entsetzen in der Frau Gesicht. „Nein. – Bitte. – Meine Kinder! -“
Doch Fahach hörte nicht, denn etwas anderes kam ihm in den Sinn. „Oh nein – wisst ihr, was für Unglück ihr hier verursacht? Das Lager – ich muss – ich komme zu spät!“
Damit presste er sich an ihr vorbei. Sie wich immerhin zurück, doch stolperte er und wäre fast auf die falsche Fliese getreten. Er fing sich noch, wenn auch seine Haltung lächerlich wirkte. Danach beschleunigte er seinen Schritt, um noch in seinem Zeitplan zu bleiben. Der weitere Weg zum Lager blieb ohne Probleme, und wie er dort hörte, wurde der Fischkuchen bereits sehnsüchtig erwartet. Das Buch aber sollte er selber in die Bücherei bringen, denn da er dort noch hingehen wollte, bot er sich dafür an.
„Ich werde es aber erst später hinbringen können, weil gleich meine Mittagsruhe beginnt und -“
„Schon in Ordnung“ sagte der das Lager überwachende Bruder bloß, ohne groß auf ihn zu achten.
Fahach wanderte zurück in Richtung seines eigenen Zimmers, um endlich Ruhe genießen zu können. Als er diesen Weg das erste Mal gegangen war, war er leider in Spazierganglaune gewesen. So kam es, dass er weiter dem großen Hauptgang folgen musste, der einmal rund um den Ostflügel führte. Die Brüder des Klosters hatten zwei verschiedene Wohnbereiche zur Verfügung; einmal den nördlichen sowie den südlichen. Man konnte sich sein Zimmer beim Einzug aussuchen, je nachdem, ob man tagsüber Sonne haben mochte oder nicht. Fahach wollte keine haben, ebenso, wie ihn die Klippe unter den Fenstern der Südzimmer stets schwindeln ließ, doch hatte er das Pech gehabt, dass zu dieser Zeit die Nordräume alle belegt gewesen waren. Jetzt war es zu spät für ihn, sich noch einmal umzuentscheiden, denn das würde sein ganzes Leben durcheinander bringen. Auf seinem Weg kam er jetzt aber an den nördlichen Zimmern vorbei, durchschritt die kühlen schattigen Hallen und musste, wie jedes mal, alle Anwohner beneiden.
Im nächsten Bereich, dem zwischen den nördlichen Zimmern der Brüder und den südlichen Zimmern der Anwärter lag, beherbergte Abstellkammern, Studierzimmer, Werkstätten und ähnlichen Kram, für den man im Laufe der Jahre Platz benötigt hatte, aber keinen anderen fand. Wie es in der Natur der Sache lag, unterbrach diesen Weg natürlich irgendwann der Osttunnel. Auf diesem ersten Gang damals hier entlang war Fahach faul gewesen und nahm nicht den Umweg, die Treppe hoch in den ersten Stock und auf der anderen Seite wieder hinab, sondern ging einfach durch die Tür, hinaus in den Tunnel und auf der anderen Seite wieder hinein. Dort ging es weiter an wahllos benutzten Räumen vorbei, bevor er in den Bereich der Anwärter kam. Er begegnete nur wenigen, und die zeugten stets die ihm gebürtige Ehrfurcht und räumten erforderlich den Weg. An einer Tür aber bemerkte er den dicken Butterlöffel, wie er davor stand, dagegen klopfte und Dinge rief.
„Heda! – Was machst du da?“ wollte er wissen, im Rahmen seines heutigen Lehrerdaseins für diesen Knaben.
Butterlöffel sah ihn erschrocken an, grüßte und erklärte: „Unfug lässt mich nicht in mein Zimmer; er hat abgeschlossen.“
„Unfug!“ rief Fahach, „wenn du nicht öffnest, werde ich dem Ältesten von dir berichten!“
Doch es kam keine Antwort, drum wandte er sich an Butterlöffel: „Geh zum Hausmeister und lass dir das Schloss öffnen; der Kerl hier bekommt später genug Ärger.“
Denn länger konnte Fahach nicht bleiben; er war bereits wieder fast zu spät für sein eigenes Zimmer. Als er dieses endlich erreichte, machte er sich nicht viel Mühe. Er ging die fünf Schritte von der Tür zum Waschbecken, wusch sich und nahm dann die acht Bretter zum Bett, wo er sich die Sandalen auszog und sich rücklings aufs Bett sinken ließ. Trotz seiner ihn immer beherrschenden Mattigkeit hatte er es noch nie geschafft, zu dieser Zeit auch wirklich einzuschlafen, doch wollte er sich einfach ausruhen, wie er es immer tat, bis der nächste Gongschlag käme. Er hatte nur wenig freie Zeit für sich zur Verfügung, doch die wollte er auskosten.
Als er so da lag, lauschte er den Geräuschen der Natur außerhalb seines Fensters und dachte über den bisher vergangenen Tag nach. Vor allem über alles, was dabei schief gelaufen war, wie den Kerl vom frühen Morgen, aber auch das, was ihm selber schrecklich peinlich war, wie der Begegnung mit dem Alten in der Stadt. Dagegen fiel ihm überhaupt nichts Gutes des Tages ein, was ihn ein wenig traurig werden ließ.
Plötzlich hörte er ein Geräusch. War es – ? – Tatsächlich, es klang, als würde sich seine Tür öffnen. Erschrocken richtete er sich auf, bis er kerzengrade saß und mitansehen musste, wie die Tür in sein Zimmer geöffnet wurde. Ein älterer Mann trat, mit einem Besen bewaffnet, ein. Es dauerte nicht lange, bis er Fahach bemerkte.
„Oh – ich wusste nicht – ich -“
„Was machst du hier?“
„Ich putze die Zimmer, wie ich es jeden Tag mache.“
„Und ich erhole mich hier, ebenfalls, wie ich es jeden Tag mache. Aber du bist hier noch niemals vorher aufgetaucht!“
„Oh – womöglich liegt es daran, dass ich ein wenig zu spät bin – für gewöhnlich putze ich morgens -“
„Und dir ist noch nie erklärt worden, dass du unsere Gewohnheiten nicht so einfach unterbrechen oder behindern darfst?“
„Oh – doch – aber – „
„Weißt du eigentlich, wie viel Unglück du mir damit bringst?“
„Verzeiht – ich wollte doch nur -“
„Jetzt verschwinde hier endlich, bevor ich dich noch dem Ältesten melden muss.“
Daraufhin sagte der Mann nichts mehr, sondern trat nur eilig den Rückweg an.
„Und wage es nicht, mich nochmal zu stören!“ rief Fahach ihm nach, als der Kerl die Tür schloss.
Sich entspannen war daraufhin eigentlich unmöglich, und doch versuchte er es noch einmal. Nach einer Weile vernahm er aber Gezwitscher und als er die Augen öffnete, saß da ein kleiner Vogel an seinem Fenster. So etwas war noch nie geschehen, weshalb er auf Anhieb nicht wusste, wie er damit umzugehen hatte. Zunächst versuchte er es mit fortgesetzter Entspannung, doch das ebenso fortgesetzte Gezwitscher hielt ihn davon ab. Letztlich entschied er sich dazu, aufzustehen und den Vogel aus der Nähe zu beobachten. Welch strenger Bruch mit den Gewohnheiten das darstellte, fiel ihm erst später ein.
Denn bevor er sich Sorgen machen konnte, ertönten dreizehn Glockenschläge.
V
Nachdem sein Erholungsversuch misslungen war, nahm Fahach den nächsten Punkt seines Planes in Angriff. Diese Zeit des Tages – wenngleich es auch nur eine Stunde war – verbrachte er immer mit dem Lesen. Dafür musste er aber erst mal zu den Büchern kommen. Es gab im Kloster mehrere Räume und gar Hallen mit von solchen gefüllten Regale. Wann immer er eines durchgelesen hatte, wechselte er in einen der anderen Räume um dort ein neues anzufangen. Einen Tag zuvor erst hatte er ein Werk über die Schifffahrt zu Ende gebracht, weshalb er nun in Richtung der größten Halle ging, in welcher sich laut Man dieses eine besonders interessante Stück befinden sollte. Das am Morgen besorgte Buch nahm er mit.
Weit war der Weg nicht, da die Halle sich genau zwischen dem südlichen Wohnbereich und den Räumen der Oberen sowie des Ältesten befand. Dabei musste er wieder an der Stelle vorbei, an welcher ihn am Morgen dieser unverschämte Kerl aufgehalten hatte. Die Arbeit schien nicht lange gedauert zu haben, denn das Loch war verschwunden und die neue Steinplatte gut an ihrer helleren Färbung erkennbar. Während er sich ihr näherte, musste er darüber nachdenken, wie er sich ihr gegenüber verhalten sollte. Im Grunde genommen hatte sich hier immerhin sein Weg verändert. Wäre es weiser, diesen neu anzugehen oder sollte er so tun, als wäre nichts geschehen? Die neue Platte war nicht wie die alten, weshalb er sie kaum benutzen könnte. Doch um über sie hinwegzuspringen besaß er nicht die nötige Tüchtigkeit. Was also sollte er tun? Da er aber auch nicht anhalten und überlegen konnte, entschied sein Körper für ihn. Die neue Platte zu benutzen tat nach allem Widerwillen doch nicht weh und zumindest unmittelbar traf ihn auch kein Blitz. Aber Unglücke kamen selten sofort.
Genau hinter dem Ausgang, der ihn morgens immer auf den Hof und zur Gebetshalle brachte, lag der Eingang zur großen Halle der Bücher. Die beiden Flügel des Tores waren geschlossen, aber nicht abgesperrt. Fahach ergriff die Klinke des rechten und zog ihn auf. Schon beim Eintritt musste man sich durch einen kleinen Irrgarten aus Regalen zurechtfinden, doch diesen kannte er bestens. Rechts, links, links und rechts und schon hatte er den Lesesaal erreicht. Dieser machte die Mitte der Halle aus, welche neben dem Erdgeschoss noch zwei weitere Stockwerke einnahm. Rund um den Lesesaal, sowie allen drei Ebenen, bildeten Regale kleine Irrgärten und umschlossen noch so manche ruhige Ecke, fern des offen einsehbaren und umschlossenen Lesesaals.
Es hatte zwar mal eine eine Ordnung in der Abteilung der Bücher gegeben, doch war diese schon lange zerstört, da viele Leser die Angewohnheit hatten, ihre gelesenen Bände nicht wieder einzusortieren, sondern irgendwo anders unterzubringen oder gar einfach rumliegen zu lassen. So waren die zum Lesen gedachten Tische und Pulte überseht von verlorenen Büchern. Fahach selbst gehörte nicht zu dieser Sorte; er liebte Ordnung und fand sich ohne sie nicht zurecht, so dass es schon Gewohnheit war, statt nur zu Lesen auch viel zu suchen. Nun musste er sogar erst einmal einen Platz für den Band finden, welchen er seit der Stadt mit sich rumschleppte, und der laut Einband „Allerlei Geschichten des Aufbaus und der Heiterkeit“ versprach. Er interessierte sich nicht sonderlich für Erzählungen ohne wahren Hintergrund, doch glaubte er zu wissen, wo sich die entsprechenden Regale befanden.
Hier in der Halle musste er ebenso auf seine Schritte und Handgriffe achten, wie anderswo, auch wenn er auf der Suche war. Er glaubte zwar zu wissen, wo er hin musste, doch sicher war er sich nicht. Sein Suchmuster ließ ihn die Regale der Reihe nach abschreiten. Geschichte, Gedichte, Legenden, Baukunst, Lehranweisungen, Gartenanbau – die Bücher waren kaum sinnvoll in ein Ganzes gepackt, nur jeweils untereinander halbwegs in loser Ordnung. – Doch Halt. Geschichte? Das war doch die Abteilung, in die Man ihn geschickt hatte – wegen dem Buch. Jetzt war er aber schon an dem Regal vorbei. Zurück gehen konnte er nicht, denn das entsprach nicht seiner Gewohnheit. Auch wenn es Gewohnheit gewesen wäre, das gesuchte Buch sofort mitzunehmen. Doch zu spät. Was konnte er also schon anderes tun, als weiter zu gehen, als später wegen dem Buch noch einmal zurück zu kommen?
Sich selber verfluchend machte er weiter, kam vorbei an Regalen mit Anleitungen zur Herstellung geistiger Getränke, der Waffentechnik, Nähkunst, Kochbüchern und vielerlei ähnlichem dergleichen. Und dann stieß er beim Umrunden eines Regales mit dem Zeh gegen die Kante des Holzes – und konnte einen Schmerzensschrei nur knapp unterdrücken. Schlimmer aber wurde es, stehen zu bleiben, nicht hinzufallen oder sich zu setzen, denn das widersprach der Gewohnheit – genauso, wie es sich verletzten tat. Trotzend den Schmerzen versuchte er weiter zu gehen, nahm ein Regal nach dem anderen – doch schlich mehr, als dass er wirklich ging, humpelte und schämte sich. Wie hatte er nur so dumm sein können, so etwas zuzulassen? Warum hatte er nicht besser aufpassen können? Es fiel schwer, noch zu bemerken, an was für Regalen er vorbei ging, so sehr ärgerte er sich.
Was suchte er eigentlich noch mal? Erschrocken blieb er stehen und las den Titel des Einbandes. – ach ja. Es geschah ihm oft, dass er vergaß, was er gerade hatte machen wollen, auch wenn er sich längst abgewöhnen wollte, so dass es trotzdem zu seinen Gewohnheiten gehörte, immer wieder zu überprüfen, was er vergessen hatte oder glaubte vergessen zu haben. Sobald er sich wieder erinnerte und auch der Schmerz seines Zehs nachließ, ging er weiter. An einem Tisch, an dem er vorbeikam, saß ein Bruder beim Lesen, doch sie beachteten sich nicht. Kunstgeschichte, Staatsgeschäfte, Predigten, gut hundert Bücher über Fischfang – doch immer noch nicht das richtige Regal. So langsam zweifelte Fahach, dass es richtig gewesen war, das Buch selber herzubringen, da stand er plötzlich vor einem Regal mit Märchen. Ob das passen würde?
Schnell schlug er das Buch auf, überflog Inhaltsverzeichnis und einzelne Geschichten – so richtig schien es nicht zu stimmen, doch einige der Erzählungen waren wohl auch Märchen. Während er sich immer sicherer wurde, dass die Aufgabe zu übernehmen eine schlechte Entscheidung gewesen war, haderte er gleichzeitig mit sich selbst, ob er das Buch hier lassen sollte. Es passte immerhin ein wenig – und wenn er es nicht täte, würde er wohl ewig suchen und sofern er nichts fand, seine Lesestunde und damit seine Gewohnheiten stören. – Schnell stellte er das Buch ins Regal und versuchte es sofort zu vergessen. – Auf zu dem Geschichtswerk.
Er konnte nicht sofort zu dem Regal zurückgehen, das verbot ihm die Gewohnheit. Zuerst musste er seinen Gang die Reihen entlang fortsetzen, bis er an einer richtigen Wand ankam. Dort hatte man für Brüder wie ihn ein Waschbecken angebracht; daneben stand ein Schrank mit Seifestücken. Vorsichtig nahm er sich ein frisches Stück, entledigte es seiner Schutzkleidung und missbrauchte es mit Wasser über dem Becken. Sobald er sich reinlicher fühlte, entsorgte er die Seife im nahestehenden Behälter.
Für den weiteren Weg gab es einen kleinen Trick, dessen er sich behelfen konnte: weiter an der Wand entlang ging er zurück zum Ausgang und von dort erneut die Regale entlang. Leider hatte er sich nicht genau gemerkt, wo die richtige Abteilung gewesen war, weshalb er erneut alle durchgehen musste. Waffenkunst, Nähkunst – irgendwie kam ihm das bekannt vor. Kunstgeschichte, Staatsgeschäfte, Predigten – so langsam wurde ihm voll Schreck gewahr, dass er alles schon mal gelesen hatte. Er musste die Geschichte übersprungen haben. – Doch wie? War er so in Gedanken versunken gewesen? Sich verfluchend eilte er weiter, ging die Reihen entlang, bis er wieder an der Wand angelangt war. Von dort zurück zum Ausgang und erneut von Vorne anfangen, diesmal aufmerksamer.
Und endlich gelangte er an das als Geschichte bezeichnete Regal. – Doch es war nicht das richtige. Es dauerte natürlich, bis er dies bemerkte. Nachdem er die Titel der Bücher gelesen hatte, glaubte er zuerst, das richtige nur überlesen zu haben. Nachdem er sie zweimal durchgegangen war, zweifelte er an seiner Fähigkeit, das Buch zu bemerken, und befürchtete gleichzeitig bereits das Schlimmste. Beim dritten Mal las er jeden einzelnen Titel gründlich, bis auf das letzte Zeichen. – Und konnte sich sicher sein, dass das Gesuchte nicht darunter war.
Hatte er etwas falsch gemacht? Leider erinnerte er sich nicht mehr allzu gut an Mans Beschreibung. Zwischen einem Buch für allgemeine Geschichte und einem für Frühgeschichte. – Das wusste er noch. Beider Arten von Buch fand er auch. – Aber dazwischen war nichts, nicht einmal eine Lücke. Hatte jemand anders das Buch genommen und die Spuren verwischt? Irgendwie klang das nicht wahrscheinlich. War er hier am völlig falschen Regal und würde umsonst suchen? Immerhin möglich, erinnerte er sich doch nicht mehr an die genaue Wegbeschreibung. Wollte sein Freund Man ihn reinlegen und hatte ihn an eine falsche Stelle gelotst, wo er ewig suchen könnte? Nein, so etwas hatte er noch nie getan. Aber andererseits – konnte er Man überhaupt einen Freund nennen? Er hatte es schon oft erleben müssen, wie wenig man sich auf andere verlassen konnte, wie leicht man sich täuschen konnte und sie einen in gewissen Augenblicken im Stich ließen.
Aber wie dem auch sei, er entschloss sich, der Suche einen zweiten Versuch zu gestatten. Diese weitere Suche führte ihn erneut die Reihen entlang, die er kannte, zurück zum Ausgang. Von dort wollte er die andere Seite der Halle durchgehen, danach in die oberen Stockwerke. Doch sobald er sich dem Ausgang näherte, begegnete ihm ein Bruder.
„Hallo, Fahach!“ sprach dieser nur kurz und verschwand sofort.
Das Erschreckende war nicht er selber, sondern seine Bedeutung. Wenn er jetzt hier war, hieß das – da begannen die vierzehn Glockenschläge. Konnte es – wie lange hatte er mit der Suche verbracht? Wieder einmal musste er sich eilen.
VI
Diesmal müsste er wenigstens nicht weit gehen. Da er zu Räumen musste, die nur von Innen zu besuchen waren, hatte er sich einst den Weg durch die inneren Gänge gewählt. Im Grunde genommen musste er nur um die Ecke gehen, in den Flügel mit dem Westtunnel. In diesem Teil hatte man sich für ein seltsames Schwarz-Weiß-Muster der Fliesen entschieden. Weiße Steine meidend und auf schwarze tretend gelangte er in den Schulbereich des Klosters. Natürlich gab es nur wenige Unterrichtsräume, da das Kloster auch nur eine begrenzte Zahl von Anwärtern hatte. Doch da die Zahl über die Jahre schwankte, und es derzeit eher wenige gab, standen viele Räume einfach leer. Außerdem gab es noch unterstützende Räume, wie kleine Abstellräume, Aufenthaltsräume für Lehrer und Schüler, Räume mit Unterrichtsbüchern, Räume für Versuche an Tier, Pflanze und Flüssigkeit und was man noch alles benötigt hatte. Das Angebot war wesentlich größer als in jeder Schule, die Fahach in seiner eigenen Kindheit gesehen hatte und allen Anwärtern offen, mit welchen Alter sie auch immer ins Kloster gekommen waren.
Im Gang begegnete er niemanden und seiner Gewohnheit folgend, begab er sich gleich in das Zimmer, in dem er später unterrichten würde. Zuvor ging er in das kleine Waschzimmer, welches sich am Ende des Raumes befand Neben dem Waschbecken stand ein kleines Schränkchen mit verpackten Seifenstücken. Er nahm sich eines, packte es aus, wusch sich damit und entsorgte es. Auch wenn bis zum Unterricht noch gut eine Stunde Zeit war – er bereitete sich halt gerne gründlich vor.
Das Zimmer lag an der Westseite, so dass man aus den Fenstern einen Blick auf Hof und Gebetshalle hatte, doch zu dieser Zeit noch keine Sonne herein schien. Der Raum war dunkel, was ihn immer wieder ärgerte, wenn Unfug zu seinen Schülern gehörte und dieser versteckt in der Ecke schlief, statt ihm zuzuhören. Heute würde es wohl wieder so sein. Die Einrichtung war einfach: Ihm zur Verfügung stand sein eigenes Schreibpult. Jeder Schüler hatte natürlich auch eines, aufgestellt in Reihen zwischen der Südwand und seinem eigenen Pult. Ansonsten war der Raum leer, denn nichts sollte sie ablenken. Welche Bücher jeweils notwendig waren, verkündete der Lehrer am Ende des Unterrichts. Mitzubringen waren sie von den Anwärtern selber aus den benachbarten Räumen. Da öfter einer dies aber vergaß oder das falsche nahm, musste der Lehrer dem häufig nachhelfen. Der heutige Unterricht sah – und irgendwie wirkte es wie ein schmerzhafter Hohn auf ihn – die jüngere Geschichte der Stadt vor. Das meiste würde er die Schüler sich selbst erarbeiten lassen, derweil er lesen könnte.
Nachdem er dies beschlossen hatte, blieben ihm noch gut die Hälfte der Stunde, bevor seine zwei Stunden Unterricht beginnen würden. Zeit, um den Aufenthaltsraum der Lehrer aufzusuchen. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass alles im Unterrichtsraum in Ordnung war, verließ er ihn mit einem zufriedenen Gefühl und folgte den schwarzen Fliesen einmal schräg auf die andere Seite. Man erwartete ihn bereits.
„Pünktlich wie immer. Hast du das Buch gefunden, dass ich dir empfohlen hatte?“
Sofort sank Fahachs Stimmung. „Ach, erinnre mich bloß nicht an das blöde Ding. – Bist du dir überhaupt sicher, dass es so ein Buch gibt?“
Man schien überrascht. „Natürlich.“
„Dann musst du mir nochmal genau den Weg dorthin erklären. – haarklein – ich habe nämlich nichts gefunden.“
„Das ist merkwürdig.“
„Mag sein.“
„Aber es muss da sein.“
„Aber es war nicht da; egal, was du jetzt behauptest.“
„Glaubst du etwa, ich hätte dich in die Irre führen wollen?“
„Nein, vermutlich hab‘ ich mich nur verirrt.“ Da fiel ihm etwas auf, wie jedes Mal, und ihm wurde unwohl. „Lass uns hineingehen, ja? Ich mag nicht hier im Weg stehen.“
Damit betraten sie den Aufenthaltsraum. Gut die Hälfte der Anwärter des Klosters würden gleichzeitig Unterricht haben, wofür auch eine entsprechende Anzahl Lehrer benötigt wurde. Zwei ihrer Brüder warteten also schon und saßen, vertieft in ein Gespräch, an einem kleinen Tisch in der Ecke. Der Raum war insgesamt recht klein. Die wenigen Fenster gingen nach Osten, auf den Haupthof hinaus. Eine Tür in der Ecke führte in eine Abstellkammer. Vier kleine Tische standen an freien Plätzen, umstellt von zwei bis drei Stühlen. Schließlich befand sich an einer Wand noch ein Regal, in dem Bücher standen. In diesen wurde jeweils festgehalten, wer von wann bis wann mit wem wo was gemacht hatte. Man und Fahach nahmen sich ihre, trugen sie zu einem Tisch und sahen sie durch, die Eintragungen des Tages beginnend.
„Was ist bei dir heute eigentlich dran?“ fragte Man.
„Jüngere Geschichte der Stadt.“
„Oh – da hätte dir das Buch ja geholfen.“
„Ja, das hätte es. – Und bei dir?“
„Ich muss ihnen mal wieder zeigen, welche Pflanzen welche Wirkung haben. So richtig verstehen sie das immer noch nicht. Du hast bestimmt gehört, wie einer von ihnen Schlafwurz für einen Glücklichmacher hielt.“
„Ja – meiner Meinung nach sind die Anwärter eh für nichts zu gebrauchen.“
„Sie sind immerhin unsere Zukunft – ohne sie wird es das Kloster nicht mehr lange geben. – Und wir waren auch mal welche, erinnerst du dich?“
„Oh, das würde ich lieber vergessen. Und Anwärter wie diesen Unfug ebenso. Mit dem werde ich mich heute wieder herumplagen müssen. Als wüsste ich nichts besseres mit meiner Zeit anzufangen.“
Während Man nur grinste, drehte sich einer der anderen Brüder zu ihnen um. „Habe ich richtig gehört? Du musst dich um Unfug kümmern?“
Fahach runzelte die Stirn. Jetzt brachte ihn dieser Unhold sogar schon in Abwesenheit unangenehme Augenblicke.
„Ja, heute bin ich damit dran. – Aber warum?“
„Oh, dann solltest du lieber mal nach deinem Schützling sehen. Ich habe gehört, er soll verschwunden sein.“
Sofort stürzte Fahach in ein tiefes Loch. Was hatte der Kerl denn jetzt wieder angestellt? Aber wichtiger: Wie sollte er damit umgehen? Sollte er nicht darauf achten und im Unterricht weitermachen. Oder seiner Pflicht nachkommen, die da hieß, auf die Schüler aufpassen; also nach dem Jungen sehen und damit den Ablauf des Unterrichts aufs Spiel setzen? War das das Unglück, welches schon den ganzen Tag drohend über ihm schwebte oder nur ein weiterer Schritt in die Richtung dorthin? Unfug hatte schon oft Schwierigkeiten gemacht, doch tatsächlich hatten weder er noch andere Anwärter je den Unterricht geschwänzt oder selbst wegen Krankheit gefehlt. Wenn er diesen heute verpassen würde – nicht auszudenken. Er müsste alles nachholen, doch das wäre nicht möglich, und –
„Fahach?“
„Was?“ Verwirrt sah er sich um: Man stand neben ihm, während die anderen Brüder ihn beobachteten.
„Geht es dir gut? Bist du noch da?“
Die Unsinnigkeit der Frage ließ Fahach zu Sinnen kommen und die Stirn runzeln. „Das siehst du doch. Wo sollte ich denn sonst sein?“ Dann fiel es ihm wieder ein und er blickte den Bruder der Unglücksnachricht an. „Was sagtest du? Was ist mit Unfug?“
„Ich habe nur gehört, dass er verschwunden ist und man schon nach ihm sucht. Du solltest jemanden fragen, der ihm näher kommt.“
Damit wandten sich die beiden wieder ihrem Gespräch zu.
„Und?“ fragte Man, nachdem Fahach wieder eine Zeitlang nichts gesagt hatte.
Dass dieser sich seine Verzweiflung versuchte nicht anmerken zu lassen, machte sie umso deutlicher. Schließlich antwortete er.
„Man, ich hatte noch nie beim Unterricht einen Fehlenden; selbst Unfug war immer da. Was soll ich nur tun?“
Man blickte verstehend. „Hast du den Unterricht denn schon einmal für alle ausfallen lassen?“
„Äh – oh – ja – als ich krank war.“
„Hat es dir damals Unglück gebracht?“
„Oh ja; ziemlich viel Ärger mit dem Obersten; dem Herrn der Anwärter. Er sagte, selbst bei Krankheit -“
„Gut, dann hast du das schon durch. Du bist dem Jungen verpflichtet, also kannst du keinen Ärger bekommen.“
„Du meinst, ich soll den Unterricht ausfallen lassen?“
„Welche andere Wahl hast du?“
„Ich weiß nicht -“
„Komm schon, bevor noch mehr Zeit verloren geht und du wirkliche Probleme bekommst.“
Fahach überlegte noch kurz, dann nickte er. „Ich werde den Anwärtern Bescheid geben und nach Unfug suchen.“
Kurz verharrte er, als warte er auf ein weiteres Wort von Man oder gar dessen Angebot, zu helfen. Doch natürlich nickte dieser nur. So tat auch Fahach, gefolgt von seinem Verlassen des Raumes. Die Glocke hatte noch nicht zur vollen Stunde geschlagen und Fahach fühlte sich unwohl. Noch nie zuvor hatte er den Aufenthaltsraum zu früh verlassen. Entsprechend überrascht sahen auch die Schüler aus, als er plötzlich den Unterrichtsraum betrat. Doch ihn wiederum überraschte es auch, dass die meisten der Schüler schon anwesend waren – und vor allem brav auf ihren Sitzen saßen. Aus seiner eigenen Schulzeit kannte er nur das Herumgealbert und Herum schubsen von Schwächeren, doch war das auch nicht im Kloster gewesen.
Seiner Gewohnheit folgend trat er vor sie an das eigene Pult.
„Hallo“, begann er unsicher.
Doch schien das Eis bei den Schülern gebrochen. „Herr Lehrer – sie sind zu früh – ist etwas passiert?“ fragte einer.
Kurz warf Fahach einen Blick auf Unfugs Platz und vergewisserte sich, dort wirklich niemanden sitzen zu sehen. „Das – das wollte ich euch fragen. – Wann habt ihr Unfug das letzte Mal gesehen?“
Einige Schüler sahen sich kurz an, andere schienen überlegen zu müssen, wen er damit eigentlich meinte.
Endlich dann sprach einer. „Unfug? Der hatte sich vorhin in ein Zimmer eingeschlossen; sprach, er wolle nich‘ mehr, alle würden ihn hassen, und so Unsinn.“
„Wann lernst du nur endlich, ordentlich zu sprechen. – Das mit dem Einschließen wusste ich schon; es war im Zimmer von Butterlöffel und ich hatte ihn zum Hausmeister geschickt, um – ja, wo steckt der eigentlich?“
„Der sucht nach Unfug“, meinte einer.
Unwillkürlich musste sich Fahach ärgern. „Und was genau ist nun mit Unfug?“
Wieder sprach ein anderer. „Nachdem er sich eingeschlossen hatte, holte der Dicke den Hausmeister, Der hat dann die Tür aufgebrochen. – In dem Zimmer kann der Dicke heute nicht schlafen“, erklärte er grinsend, „doch Unfug war verschwunden. Der Hausmeister hat dem Oberen Bescheid gegeben und jetzt suchen ein paar nach ihm.“
Fahach war wirklich zornig. „Warum hat mir niemand Bescheid gesagt?“ Doch mehr als ein Achselzucken konnte er nicht erwarten. „Und welchem Oberen wurde Bescheid gegeben?“ Diesmal sahen sich die Anwärter an, bevor sie mit den Achseln zuckten. „Na gut. Dann hört mal her. Ich habe eine Pflicht, dafür zu sorgen, dass euch nichts geschieht, solange ihr Unterricht bei mir habt. Auch wenn Unfug nicht hier ist, müsste er es sein. Deshalb muss ich nach seinem Wohlbefinden sehen. Und wenn ich nicht hier sein kann, werde ich euch natürlich nicht unterrichten können.“
Wieder sahen sich einige kurz an, als könnten sie ohne Worte miteinander sprachen. Eine Erwartung schien sich anzuspannen.
„Müsstet ihr denn nicht auch auf uns aufpassen?“ fragte ein besonders Wagemutiger.
Doch Fahach hörte nur halb zu. „Ihr werdet alle in eure Zimmer gehen. Der Unterricht fällt für heute aus. Sollte ich Unfug früh genug finden, werde ich euch Bescheid geben, dass wir weitermachen können. Habt ihr verstanden?“
Ein mehrstimmiges „Ja!“ ertönte.
„Gut, dann geht.“
Und während sie das Zimmer verließen, schlug die Glocke.
Buch 3: Der Nachmittag
VII
Fahach war äußerst unruhig, da seine Gewohnheiten durch den törichten Unfug völlig gestört waren. Er hatte keinen Plan für eine solche Begebenheit; wusste sich nicht zu helfen. Ein Teil von ihm überlegte, was zu tun sei, derweil der andere sich fragte, ob dies das große Unglück sei, oder ob es noch kommen würde – und warum er eigentlich noch am Leben war, denn das Unglück stellte er sich immer auch als sein eigenes Ende vor. Zwar wusste er nicht aus Erfahrung, was im Ganzen zu tun war, doch konnten seine Gewohnheiten im Einzelnen helfen. So war es das erste Mal, dass er diesen einen Weg gehen musste, doch entschied er sich unbewusst für einen ohne Umwege: Einfach geradeaus an den Unterrichtsräumen vorbei, nach rechts, hinauf in den Westtunnel und auf den Haupthof, hinüber zu den Werkstätten. Er hatte sich vorgenommen, den Weg, den die Benachrichtigungen genommen hatten, zu verfolgen. Deshalb ging er als erstes zum Hausmeister, um von diesem zu erfahren, welchen Obersten er benachrichtigt hatte – auch wenn Fahach vermutete, dass es wohl der Herr der Anwärter sein dürfte. Die Wohnung des Hausmeisters war ein Zimmer im Dachstuhl über den Werkstätten.
Doch als Fahach den Westtunnel verließ und gerade einen Fuß auf den Hof gesetzt hatte, wurde er angesprochen. „Bruder Fahach! – Wartet!“
Es war der Anwärter, der heute Torwächter war. Fahachs Verwirrung wuchs, nun in seinem Tun auch noch unterbrochen zu werden, was gewiss nicht zur Gewohnheit gehörte. Auch der Wächter schien verwirrt, denn trotz seines Halterufs winkte er Fahach nur zu sich, statt seinen Posten zu verlassen und selbst zu ihm zu gehen.
„Was ist?“ fragte da Fahach auch noch mit verkniffenem Gesicht, doch der Kerl ließ nicht ab. Vorsichtig bewegte Fahach sich Schritt für Schritt auf ihn zu, mit jedem Fußtritt sich dabei in unbekanntes Land wagend. Erst als er nur noch fünf Fußlängen von dem Torhüter entfernt war, fuhr dieser fort – in mildem Tonfall, schien er doch nicht rufen zu wollen.
„Bruder Fahach – ich störe nur ungern – aber beabsichtigt ihr im Moment zufällig, den Hausmeister aufzusuchen?“
Kurz verdächtigte Fahach ihn in Gedanken der Verfolgung. Woher wusste er das?
„Woher wisst ihr das?“
„Ah – gut“, schien er erleichtert, „er hat mir gesagt, dass ihr ihn wohl suchen werdet. Aber er ist nicht mehr in seinem Zimmer; er musste ausgehen, zu einem Auftrag.“
Nicht das auch noch. „Und?“ fragte Fahach recht ruppig, „hat er auch gesagt, wohin er musste?“
Der Kerl wirkte nicht mal verletzt über den Tonfall, nahm Fahach erst rückblickend war, schien alles hinzunehmen.
„Ja, er muss wohl etwas im Nordostlager machen, ihr wisst, wo das – ?“
Doch mehr hörte Fahach nicht mehr, denn schon war er auf seinem Weg, gerade durch den Osttunnel und nicht hinauf zu den Werkstätten, sondern über den Osthof am Garten vorbei. Erst spät viel ihm ein, dass er dem Wächter nicht gedankt, nicht mal zu Ende hat reden lassen. Wieder beschlich ihn dieses Gefühl der Reue, als er in Gedanken mit sich selber durchspielte, was er hätte sagen, was er hätte richtig machen können. Dann fiel ihm auf, wie er sich selber hassen würde, sollte er so mit sicher selber umgehen. Hasste man ihn etwa? Wie könnte er das gut machen? Dem Wächter Blumen schenken?
Dann stand er vor der Tür zum Lager – und hatte vergessen, den Garten zu beobachten.
„Bruder Fahach?“ fragte der im Lager arbeitende Bruder erstaunt, als dieser eintrat, denn erwartet wurde er nicht.
„Der bin ich“, sprach Fahach und blickte sich um, den Hausmeister suchend.
„Habt ihr etwas vergessen? Kann ich euch helfen? Die gewohnte Arbeitsweise brachte den Bruder durch die Überraschung.
„Hat er euch denn nichts gesagt?“ stutzte Fahach.
Warum sollte der Hausmeister dem Wächter, aber nicht im Lager selbst Bescheid geben?
„Von wem sprecht ihr?“
„Na der Hausmeister – man sagte mir, er wäre hier.“
„Oh, der! – Ja, der war hier.“
Langsam bekam Fahach Lust, dem Bruder Gewalt anzutun. „War? – Und wo ist er nun? Mann, sprich!“
Der Bruder wirkte kurz beleidigt. „Er wurde abgerufen. – Irgendwas in der Küche, soweit ich -“
Fahach war bereits unterwegs, bevor der Mann ausgesprochen hatte. Der Weg vom Lager zur Küche war zum Glück nicht weit. Das Lager befand sich im Nordosten, die Küche dagegen im Südosten. Auf seinem Weg kam er dabei wiederum an den verschiedensten Räumen vorbei, die er teils auch früher am Tag schon gesehen hatte, so den Wohnräumen von im Kloster arbeitenden Städtern, die auch dort schliefen. Zum Glück begegnete er diesen diesmal aber nicht. Stattdessen kam er ohne Probleme in die Küche. Dort wurde abwechselnd am Tag geputzt und gekocht, heute aber vor allem alles für den Festabend vorbereitet.
„He, du da“, sprach ihn da plötzlich jemand an.
Der Sprecher schien ein Bruder zu sein und hier wirklich etwas zu sagen zu haben. – Sehr gut.
„Ah – gut – ich suche den Hausmeister. Er soll sich hier aufhalten.“
„Davon weiß ich nichts“, sprach der Kerl barsch.
„Was? – Ja habt ihr ihn denn nicht wenigstens gesehen?“
„Warum sollte ich ihn gesehen haben?“
„Weil er hierher kommen wollte!“
„Hört mal, wenn ihr euren Ton nicht mäßigt -“
Da kam ein weiter Bruder dazu und unterbrach sie.
„Bruder Fahach! Da bist du ja!“
„Was?“ Der Angesprochene war mittlerweile sehr verwirrt und auch der Küchenbruder starrte sie abwechselnd an.
„Der Hausmeister schickt mich. – Er konnte noch nicht herkommen, meint aber, dass du ihn wohl suchen wirst. Ist dem so?“
„… ja.“
„Gut, dann komm einfach mit mir; ich führe dich zu ihm.“
Fahach antworte nicht, sondern folgte einfach, wie gefordert, derweil der Küchenbruder ihnen nach sah und letztlich schlicht wieder an die Arbeit ging.
Sie sprachen den ganzen Weg über nicht. Von der Küche aus ging es am Speisesaal vorbei und eine schmale Wendeltreppe hinauf. Hier oben gab es kaum Steinplatten als Fußbelag, vielmehr hatte man sich für Holzbretter entschieden. Wie es mit diesen nun einmal so ist, konnten sie nicht übermäßig breit sein, doch hatte man beim Bau des Klosters genug an seine Bewohner gedacht, um sie Fußbreit zu gestalten. Trotzdem verlangsamte sich durch sie die Geschwindigkeit für Fahach, der jeden Schritt auf ein einzelnes neues Brett machte, derweil sein Führer weit ausholen musste, um jedes Mal ein Brett auszulassen. Dann war er auch noch stets in der Verlegenheit, immer wieder auf Fahach warten zu müssen. Glücklicherweise wenigstens sollte ihr Weg nicht weit führen, denn sie gingen bloß bis in den oberen Bereich des Wohnabschnittes, der genau über den südlichen Zimmern lag. Das Zimmer, an dem sie hielten, müsste wohl auch genau über seinem eigenen liegen, wunderte sich Fahach. Das Zimmer sah auch kaum anders als sein eigenes aus – sah kaum anders, als die meisten Zimmer.
„Was wollen wir hier?“ fragte Fahach, als er in das leere fremde Zimmer sah.
„Aber -“ Der Bruder drängelte sich vorbei, um auch etwas sehen zu können. „Vorhin war er doch noch hier – sollte sich um Wasserschäden kümmern.“
„Wasserschäden?“ Lag das Zimmer über seinem eigenen oder nicht?
„Ach, nichts schlimmes, glaube ich. – Wenn er ihn behoben hat. – Aber so schnell dürfte das nicht gehen. – Würd‘ ich es machen, würde es Jahre dauern. – Ich glaube, ich überprüfe das mal. -“
Während der Bruder für Fahach Unverständliches immer wieder plappernd von sich gab, schlich er selber sich von dem Zimmer fort. Eigentlich konnte es doch nicht genau über dem seinem liegen, denn er hatte schließlich nicht genau gegenüber ein Fenster in die Welt – und sogar eine hinaus führende Tür. Eine Tür? Das verwarf den Gedanken, dass man durch die Fenster auf den Hof hinaus gucken könnte. Wann war er bloß das letzte Mal hier oben gewesen? Hatte er denn je auf seine Umgebung geachtet? Dann erkannte er, dass die Tür auf einen Balkon führte. Neugierig öffnete er sie und stieg hinaus. Die Plattform als Balkon zu bezeichnen war aber übertrieben, schien es sich hier doch um eine offene Fläche über die gesamte halbe Breite des Stockwerks zu handeln. Warum nur war ihm das nie aufgefallen, selbst vom Hof gesehen aus nicht? War er so unaufmerksam? Ein wenig fühlte er sich, als wäre er in die falsche Welt geraten. Und dann erreichte er das Geländer der Plattform und sah in den Hof hinab, wo gerade der Hausmeister von Süd gen Osttunnel eilte. – Vielleicht heim?
Sofort und eilig machte sich auch Fahach auf den Weg, wieder ins Gebäude und nach links. Kurz hörte er noch den Bruder, der weiter ohne Zuhörer erzählte. Dann war er auch schon erneut nach links abgebogen. Während er sich, so schnell es ging, vorwärts eilte, ohne dabei auf die falschen Bretter zu treten, überlegte er eifrig, was er machen würde, wenn der Hausmeister nicht in sein Zimmer zurückkehrte. Warum hatte er auch nicht noch kurz warten können, zu sehen, wo genau die Gestalt sich hinbewegte, ob er den Osttunnel auch wirklich betrat? Doch selbst wenn dem so war, könnte er genauso gut auch ins Erdgeschoss gehen, nach Norden oder Süden, oder gar in den Garten. Und warum hatte er auch nicht daran gedacht, dem Hausmeister von der Brüstung aus zuzurufen? Aber vermutlich hätte er sich das auch gar nicht getraut.
Schließlich stand er vor dem Zimmer des zu Erwartenden und war fest entschlossen, nur einige Augenblicke zu verharren. War der Mann bis dahin nicht erschienen, so konnte er nur woanders hin sein. Unruhig ging er auf und ab, klopfte sogar einmal an der Tür, sollte der Mann wie durch ein Wunder schneller als er gewesen sein. Doch sie öffnete nicht, ebenso wenig wie der Mann irgendwo erschien und auf ihn zu kam. War er also doch woanders? Seine Unruhe wuchs in Besorgnis, stand kurz vor dem Schlimmsten. Sollte er warten? Oder doch lieber gehen? Gedulden? Oder seinen Füßen folgen?
Letztlich waren es diese, die gewannen, während er innerlich noch haderte und zank und sich nicht entscheiden konnte. Bevor er’s so recht bemerken konnte, trugen sie ihn bereits weiter voran und eilig die Treppe ins Erdgeschoss hinab. Unten stürmte er in den Osttunnel und sah sich dort verzweifelt um. Links war der Hof, doch erkannte er dort nichts. Gegenüber befand sich nur die Tür in der Wand. Rechts war der Garten, der den Großteil des Blickes versperrte. Doch da – dort hinten – ging doch gerade jemand ins Kloster hinein? Da er selber sich keinen guten Rat mehr wusste, folgte er seinem Gefühl und dieser Spur. Wenn jemand aus dem Osttunnel in den Garten ging, gab es nur drei Möglichkeiten, zu denen er gehen könnte: Die Küche im Süden, der Ostflügel oder in den Nordflügel. – Und genau dort hatte er die Gestalt hingehen sehen. Ob es der Hausmeister war oder nicht – er folgte dieser Spur.
Schreitend in den Osthof, am Garten vorbei – in dem gerade ein anderer Bruder seine Anwärter unterrichtete – und durch die Tür. Dort stand er zwischen dem nördlichen Wohnbereich und dem nordöstlichen Lager und gerade schwang die Tür zu letzterem zu. Sollte es so einfach sein? War der Mann einfach nur zurückgekehrt? Geschwind betrat auch er das Lager – und sah vor sich einen Kerl, wohl Städter, der im Hintergrund des Lagers verschwand. Kein Hausmeister.
„Bruder Fahach?“ Wieder der Lagerbruder – und diesmal hatte er Fahach äußerst erschrocken. „Kann ich euch helfen?“
„Ihr schon wieder – erschreckt ihr immer so eure Besucher?“
„Oh – das tut mir leid. Aber kann ich euch helfen?“
Hatte er wirklich vergessen, weshalb Fahach hier gewesen war? Das war doch noch lange keine Stunde her. Oder waren seine Gedankengänge derart, immer dasselbe zu fragen? – Da hatte Fahach seine Antwort. Manchmal war das Leben im Kloster auch ein Fluch.
„Ich war wegen dem Hausmeister hier. Ich habe ihn jetzt durch das halbe Kloster verfolgt und war immer zu spät und das, obwohl ich jetzt eigentlich Unterricht und damit ganz anderes zu tun hätte und jetzt, wo mich die Spur wieder hierher führte, nachdem ich zuvor nie gesehene Bereiche des Klostergebäudes entdeckte – war da nur dieser Städter und ihr, mit euren stets eintönigen und gleich bleibenden Fragen und – ach!“
„Ihr sucht den Hausmeister?“
Fahach glaubte nicht recht zu hören. Er stand kurz vor einem Aus- oder Zusammenbruch.
Doch dann sagte der Bruder: „Der ist doch gerade angekommen, knapp vor euch. Er wird sich wohl hinten endlich um die kaputte Tür kümmern.“
Zu fassungslos, um sofort loszugehen, starrte Fahach den Bruder an und konnte dessen Äußerung kaum glauben, derweil dieser unverständlich zurück blickte. Endlich, als er sich zusammenreißen konnte, ging Fahach in die ausgewiesene Richtung. Im Hinterteil des Lagers befanden sich kleinere Räume, einer davon schien eine verklemmte Tür zu haben. Der Städter, den er bei seiner Ankunft bemerkt hatte, machte sich gerade mit den Händen daran zu schaffen. Doch das war kein Städter, das war – der Hausmeister. Von oben hatte er nicht wie ein Städter ausgesehen. Kurz wusste Fahach nichts zu sagen, da er den Namen des Mannes nicht kannte, doch dieser bemerkte ihn glücklicherweise.
„Ah, Bruder Fahach! Ich dachte, ihr wärt schon bei dem Obersten. Tut mir leid, dass ich hier von Auftrag zu Auftrag hasten muss, aber ihr kennt das sicher.“ Nein, bisher kannte er das nicht. „Ach, dieser schreckliche Unfug -“
„Ja – äh – wisst ihr, ich hätte jetzt Unterricht und müsste mich daher sehr beeilen. Ich habe einfach keine Zeit für lange Gespräche oder Versteckspiele. Könnt ihr mir bitte einfach den Namen nennen?“ Fahach konnte sich kaum zwischen Ehrerbietung und Zorn entscheiden.
„Oh, ja, natürlich – Also -“
Und während Fahach zuhörte, schlug siebzehn mal die Glocke. – Er war zu spät.
VIII
Vorsichtig betrat Fahach wieder den Flur. Ihm verblieb nur noch gut eine Stunde, bevor sein Feierabend angefangen hätte, und dann noch ein oder zwei, bis die Sonne unterging und das Fest anfinge. Nicht viel Zeit. Er fühlte sich, als säße ihm etwas im Nacken, dass ihn mit rasender und stetig steigender Geschwindigkeit verfolgte. Wie sollte er all das, was er geplant hatte, noch erledigen? Nie zuvor war es geschehen, dass ihm immer wieder etwas dazwischen kam, dass eine Störung die andere jagte. Dieser ganze Tag war ein einziges Unglück, soviel war klar, und fraglich nur noch, wie es abzuschwächen sei. Nun konnte er aber nicht anders, als so fortzufahren, wie er begonnen hatte.
Der Weg führte ihn nach Rechts, an den nördlichen Wohnzimmern vorbei und schließlich gen Links, in den Bereich der Werkstätten, wo er hin und wieder einen Hammer schlagen oder eine Säge ratschen hörte. Schließlich gelangte er in den Osttunnel hinaus und bog auf den Haupthof ein, da er nicht durch das Wohngebiet der Anwärter gehen wollte.
Gegenüber, auf der anderen Seite des Hofes aber, sah er einige der Fenster, welche zu den Unterrichtsräumen gehörten. Was seine Brüder und – wichtiger noch – Schüler gerade wohl trieben? Ob sie ohne ihn es wohl schaffen konnten, keinen Unsinn anzustellen? Welch schlechtes Vorbild er durch seine Unfähigkeit doch war. Rechts wiederum würde der Wächter am Tor stehen, doch an diesen dachte er nicht, als er sich nach links wandte und an der Mauer entlang gen südlichen Wohnbereich ging. Und tatsächlich, dort droben, über dem Erdgeschoss, erkannte er zum ersten Mal den Balkon. Es war ein merkwürdiges Gefühl, etwas zu sehen, das ihn trotz all seiner Jahre nie zuvor aufgefallen war und das selbst jetzt noch wenig auffällig war, denn konnte es sich gut an das Gesamtbild des Daches angleichen. Darum kümmerte ihn das auch nicht weiter, bis er ihn aus dem Blick verlor und schließlich durch die Haupttür in den südlichen Wohnbereich trat, unweit seines eigenen Zimmers.
Kurz verspürte er den Drang, mal nachzusehen, sicherzugehen, dass alles dort in Ordnung war, dass es keinen Wasserschaden gäbe. Doch hatte er dafür keine Zeit, auch wenn eine schreckliche Lockung es verlangte, ihn förmlich gen Süd zerrte, derweil sein Verstand mit ihm nach Westen ging. Doch sobald er den Wohnbereich hinter sich hatte und an der Halle der Bücher vorbei ging, ließ das Gefühl auch wieder nach. Stattdessen wuchs die Aufregung. Selten nur hatte er viel mit den Oberen zu tun. Für ihn waren sie immer noch die unerreichbaren Ehrgestalten, von denen man raunen, mit denen man aber nicht sprechen konnte; die immer alles besser und – richtig wussten. Er selber war im Vergleich zu ihnen unwichtig, unerfahren, unwissend. Der Gedanke, sie anzusprechen, machte ihn unruhig; fast noch mehr, als beim Ältesten, den er mittlerweile gewissermaßen hatte kennenlernen können.
Nach einer Weile stand er vor der – so weit er wusste – richtigen Tür und klopfte an.
Tatsächlich ertönte es: „Herein!“
Auch sein Herz klopfte, doch schnell und lautlos. Sein Atem war ebenso schnell, doch flach und verschaffte ihm kaum Luft. Er wollte sicher nicht eintreten, doch musste er es tun. Fliehen wollte sein Körper, ausschalten sein Geist – und seine Hand öffnete die Tür. Vorsichtig trat er ein, verneigte sich leicht und schloss die Tür wieder hinter sich.
„Verzeiht – darf ich stören?“
Der Oberste, der an seinem Pult über einem Buch gesessen hatte, kniff kurz die Augen zusammen und musterte ihn, bevor sich sein Blick aufhellte, als er ihn erkannte. „Ah, ihr seit doch Bruder Fahach, oder?“ Unruhig stand er auf und warf einen Blick zum Fenster hinaus, derweil Fahach versuchte, eine Antwort zu Stande zu bekommen.
„Äh – ja – ich -“
„Ihr habt euch ganz schön Zeit gelassen. – Ich habe euch schon vor einer Stunde erwartet.“
„Nun – ja – der Hausmeister -“
„Ich weiß, der Hausmeister schickt euch.“ Dann sah er ihn plötzlich mit leichtem Zorn an. „Was habt ihr euch nur dabei gedacht, so unvorsichtig mit euren Schülern umzugehen? Ihr habt die Verantwortung für sie und dann lasst ihr sie solchen Unsinn machen.“ Seine Miene klärte sich aber wieder. „Aber gut, dieser Knabe – wie nennt ihr ihn? Ach ja – Unfug – wie passend! – ja, dieser Knabe bereitet uns schon seit seiner Aufnahme bei uns Schwierigkeiten. Immer wieder beschweren sich seine Lehrer und immer wieder gibt es Neuigkeiten über ihn. Es scheint so, als wäre er nun fortgelaufen.“ Er setzte sich auf das Fensterbrett und blickte leicht traurig seine Hände an, während sie miteinander spielten. „Jedenfalls hoffe ich das für ihn, denn wenn nicht, droht ihm der Rauswurf. Zumindest, wenn es nach mir geht. Er ging eine schwere Verpflichtung ein, als er ins Kloster kam und scheint diese nicht beherzigen zu wollen. Wenn die Sucher ihn nicht finden, melden wir es den Behörden in der Stadt. Und wenn sie ihn dann finden -“ Endlich schien ihm etwas aufzufallen. „Aber ihr seid sicher nicht hier, um mir zuzuhören. Leider weiß ich auch nicht, wo die Sucher jetzt sind, aber wird es wohl irgendwo hier im Kloster sein. Und jetzt geht – ich habe euch lange genug aufgehalten.“
Fahach war einen Augenblick zu verwirrt, um zu antworten. Da der Obere ihn aber ungeduldig ansah, nicke er, sich leicht verbeugend, öffnete die Tür, verschwand hastig aus dem Zimmer und schloss sie hinter sich wieder. Erst dann beruhigte er sich langsam wieder und ihm fiel etwas auf. Die Sucher finden? Welche Sucher? Hätte er ihm nicht etwas mehr sagen können? Wie wäre es mit Namen – wer suchte denn? Brüder, Anwärter, Kerle aus der Stadt -? Wie sollte er jemanden finden, von dem er nicht mal wusste, wer er war? Da würde es wohl leichter werden, Unfug selbst zu suchen. Seine einzige Möglichkeit wäre es, auf eine Gruppe zu achten, die seltsam unter Steine und in dunkle Ecken spähte und immer wieder nach Unfug rief. Aber wo sollte er anfangen? Und so langsam, da seine Angst verflogen war, die Atmung sich verbesserte und sein Körper keinen Grund mehr sah, fliehen zu wollen, setzte eine unglaubliche Mattigkeit ein, gefolgt von dem ihn ewig verfolgenden Kopfschmerzen. Am liebsten hätte er sich hingelegt, doch war das so nicht möglich. Stattdessen fing er an zu wandern, wusste er doch nichts besseres zu tun.
Sein Weg führte ihn gen West, und bevor er es selber wusste, fing er auch schon an, einem regelrechten Plan zu folgen, der ihm bei der Suche helfen sollte. Er musste einfach nur jeden der beiden Hauptflügel im Kreis umgehen und anschließend nochmal in höhere Stockwerke wechseln. Es war eine unglaubliche Strecke zu bewältigen und schon beschwerten sich seine Füße, doch gab es keinen Weg darum herum. Das Streifen durch den Wohnbereich der Oberen war nicht verboten, aber trotzdem würde man ihn seltsam ansehen, wenn man ihn entdeckte, weshalb ihm unwohl wurde. Zum Glück suchte er nicht nach Unfug, für den allein er wohl in jeden Wandschrank hätte sehen müssen, sondern nach einer Gruppe. So eilte er durch die Gänge, nur die großen nehmend und wann immer er konnte, hielt er sogar kurz inne und lauschte. Oberen begegnete er zum Glück nicht, doch hörte er einmal mehrere Stimmen reden hinter einer Tür und lauschte kurz. Sich wie ein Verbrecher und Verräter fühlend, als er feststellte, dass es nicht die Gesuchten waren, machte er sich wieder davon.
Kurz darauf kam er an den Ausgang, durch welche die Oberen immer die Gebetshalle betraten. Es war ein seltsames Gefühl, diese Tür selbst zu benutzen, doch musste er es tun. Er kam so auf den Hinterbereich der Bühne und war froh, dass kaum jemand in der Halle anwesend war und diese Handvoll mit ihren Gebeten beschäftigt war. – Hier waren die Sucher also auch nicht. Auf der anderen Seite führte eine Tür weiter, diesmal durch schmale Gänge mit kleinen Räumen weiter in das Hauptlager. Dieses zu durchsuchen war schwerer, nahm es doch fast den ganzen nordwestlichen Flügel ein und war zudem unübersichtlich eingerichtet. Das meiste machte dabei aber eine einzige große Halle aus, die wahllos mit Regalen und Kisten vollgestopft war. Eine Handvoll Lagerarbeiter lief ständig etwas suchend durch die Gänge, kletterte Leitern hoch und runter und schrie sich Dinge zu. Das große Tor zum westlichen Hof stand offen und ließ das Sonnenlicht ein, doch der Hof selber war leer. Immer, wenn ein Regalgang nicht einsehbar war, musste Fahach dort kurz nachsehen, auch in die seltsamen kleinen Hallen, die man in die große Halle hinein gebaut hatte. Doch im Lager schienen auch keine Sucher zu sein.
Ungeduldig verließ er es, um durch den Unterrichtsbereich gen Süden zu gehen. Hier hielt er an jeder Tür, um kurz zu lauschen. Hin und wieder vernahm er auch Stimmen, aber meist nur eine einzeln, die den anderen etwas erklärte. In die Räume hinein wollte er lieber nicht sehen, da immer noch Unterricht war und ihm eine Störung schrecklich peinlich gewesen wäre. Wieder im Süden angekommen, warf er noch einen Blick in die Halle der Bücher, doch verhielt sich dort niemand ungewöhnlicher, als er es sonst auch getan hätte. Östlich folgte er südliche Wohnbereich, in dem es keine weiteren Überraschungen gab. Den Drang, in sein Zimmer zu sehen, hatte er zum Glück vergessen.
Am Beginn des Anwärterbereichs aber hatte er kurz zu überlegen, in welche Richtung er gehen solle. Letztlich entschied er sich, zuerst durch Speisesaal, Küchen und Vorratskammern zu stapfen. Dort herrschte zwar reger Betrieb, doch schien niemand etwas zu suchen. Im Wohnbereich der Auswärtigen musste er sich vorsehen, deren Unvorsichtigkeit zu entgehen, doch gab es plötzlich, da sein großer Plan zerstört war, scheinbar keine kleinen Überraschungen und Unfälle mehr. Es hätte ihn gewundert, wären die Sucher im Nordostlager, doch warf er vorsichtshalber auch dort einen Blick hinein.
„Ah – Bruder Fahach – kann ich -“
Schnell verließ er die Tür wieder, als ihm der Lagermeister zu nah kommen wollte.
Der nördliche Wohnbereich schien ausgestorben, was ihn wunderte. Die Werkstätten und Krimskramszimmer hielten ihn wieder auf, da es so viele von ihnen gab und er in viele hineinsehen musste. Manches Mal musste er sich wieder verziehen, als er jemanden beim Arbeiten störte, was ihm schrecklich peinlich wurde. Bald würde er wohl das Gespräch des Tages werden, lautete seine größte Befürchtung.
Im Osttunnel warf er kurze Blicke auf den Ost- und Haupthof. Im Garten glaubte er sie schon fast gefunden zu haben, doch waren es nur ein paar Schüler mit ihrem Lehrer – immer noch dieselben sogar. Zuletzt kamen noch die Zimmer der Anwärter, die er zwar hätte durchsuchen dürfen, doch schien ihm dies nicht nötig. Als er auch dort keiner Gruppe begegnete, wechselte er im südlichen Wohnbereich in das Stockwerk darüber. Dieser Bereich beherbergte allerlei unterstützende Räume, wie Waschküchen, Trockenräume, Kleiderlager, Nähzimmer. Und in der großen Waschküche war es, wo er sie endlich fand.
Als er den Raum betrat, erkannte er zunächst gar nichts. Die Waschbecken wurden durch den Dampf der darunter liegenden Küche angeheizt und jetzt, da das Abendessen vorbereitet wurde, war der große Raum voller Qualm und einige Wäscher bei der Arbeit beschäftigt. Fertige Wäsche hing bereits zum Abtropfen über Abführrinnen an Leinen und bildete teils unübersichtliche Gänge. Verwirrt ob der schlechten Sicht im Raum, in dem er noch nie zuvor gewesen war, irrte Fahach nach seinem Eintritt umher. Nachdem er einige Male fast in nasse Wäsche gelaufen oder einen Bottich gefallen wäre, lief er fast in einen ihm nur wenig bekannten Bruder, doch konnte noch vor seinem Rücken halten. Während er versuchte, sich von dem Schreck zu erholen, gab der Bruder ein Wort von sich.
„Unfug!“ rief er und einige Wäscher starrten ihn verwirrt an.
Doch Fahach war fast außer sich vor Freude. „Ihr sucht Unfug?“
Nun war der Bruder der Überraschte. Schnell drehte er sich um; sein Gesicht wurde freundlich. „Ah, Bruder Fahach – ihr seid’s. Wir fragten uns schon, wann ihr kommt.“
„Ich musste euch im ganzen Kloster suchen, weil niemand wusste, wo ihr steckt.“
„Oh – ja, wir suchen schon eine Weile.“
„Und ihr habt ihn noch immer nicht gefunden?“
Die Frage war unsinnig, und der Bruder schüttelte nur den Kopf.
„Wo sind die anderen?“
„Kommt, ich bringe euch zu ihnen.“
Die Suchergruppe schien wie Fahach selbst immer die Gänge abgeschritten zu sein. An einzelnen Punkten trennten sie sich dann stets, um nahe größere Räume zu überprüfen und kamen danach wieder zusammen. Die Sucher waren fünf Brüder, die Fahach allesamt nur flüchtig kannte. Ein wenig überraschte es ihn aber schon, das sie alle Zeit hatten, nach dem unnützen Anwärter zu suchen.
„Wir übernehmen die Suche in solchen Fällen immer“, erklärte einer. „Soll die anderen Brüder entlasten und vor Verwirrung schützen. Es tut mir leid, dass ihr nichts davon wusstet.“
Wichtiger war für Fahach aber: Warum hatte ihm auch der Oberste nichts gesagt? „Und wie lautet der Plan?“ Langsam wurde er ungeduldig; die letzte Stunde vor dem Abend näherte sich mit riesigen Schritten.
„Naja, wir werden das Stockwerk weiter durchsuchen.“
„Und wenn er gar nicht hier ist? Wir haben nicht ewig Zeit.“
„Ja, das meinte dieser Knabe auch – also das mit dem nicht hier sein.“
„Was – welcher Knabe?“
„Wie heißt der? – der Dicke – der Freund von -“
„Butterlöffel?“
„Genau der – blöder Name -“
„Was ist mit ihm? Er kennt Unfug!“
„Das sagte er auch – und dass der Kerl sich wohl nicht im Kloster verstecken würde -“
„Und warum sucht ihr dann hier?“
„Der Dicke sucht mit zwei anderen Anwärtern den Hügel ab. – Wir überprüfen das Kloster. – Was ist daran falsch?“ Nun schien der Bruder beleidigt.
„Ach – nichts. Aber vermutlich werdet ihr keinen Erfolg haben. Ich werde nach Butterlöffel suchen, ihr macht hier weiter und wenn ihr Unfug dann doch findet, schickt jemanden zu uns.“
Ohne weitere Bestätigungen abzuwarten, machte sich Fahach wieder auf den Weg. Diesmal suchte er nicht nach Umwegen; sein Ziel war klar und der Weg dorthin sollte keine Zeitverschwendung mehr beinhalten. Eilig ging er zurück zur Treppe und stieg hinab ins Erdgeschoss. Die letzte Stufe wollte ihn bei sich behalten und er stolperte voran. Erschrocken blickte er sich um, ob es jemand bemerkt hätte – so etwas war noch nie zuvor geschehen. Langsam machte ihn der Tag vollkommen mürbe; wie lange er das wohl noch ertragen könne? Es war Zeit, dass er endete oder wieder zur Gewöhnung zurückkehrte.
Schnell war er wieder sicher auf den Füßen, ging weiter geradeaus und schließlich durch den Osttunnel auf den Hauptplatz. Hier war sein Augenmerk das Klostertor und die Weite des Hügels dahinter. – Der Torwächter. Hätte der nicht Unfug bemerken müssen? Ausnahmsweise ging er genau auf ihn zu.
„Hallo – wachst du hier schon den ganzen Tag?“
Der Wächter nahm eine ehrfurchtsvolle Haltung an. „Ja, das tue ich.“
„Du hast mich vorhin zum Hausmeister geschickt.“
„Ja, das habe ich.“
„Weißt du, warum du das tun solltest?“
„Nein, tut mir leid.“
„Hast du zufällig in den letzten Stunden einen Anwärter durch dieses Tor gehen sehen?“
„Oh, nicht nur einen.“
„Wen alles?“ Fahach ahnte schlimmes.
„Vor ’ner Weile Unfug; eben Butterlöffel und -“
Seine Befürchtungen hatten sich erfüllt. Warum hatte dieser – aber gut, vielleicht wusste der Wächter auch einfach nichts von dem Problem. Bevor er ihn hätte beleidigen können, ging er lieber, ohne ein Wort zu sagen.
Er fand Butterlöffel am Festplatz, wo er gerade auf Unfug einzureden versuchte. „Jetzt komm wieder mit, du weißt ja nicht, wie viel Aufregung du du verursacht hast. Das wird Ärger geben!“ An der Stelle bemerkte er Fahach und hielt erschrocken ein.
„Hier steckt ihr also!“
Unfug, den schon das Verhalten seines Freundes vorbereitet hatte, drehte sich um.
Es war Butterlöffel, der sprach. „Bruder Fahach! – Oh! – Ihr – wir wollten gerade zu euch kommen.“
„Wisst ihr beiden eigentlich, wie viel ihr durcheinander gebracht habt?“
„Es war nur meine Schuld; der Dicke hier kam grad erst und wollte sogar versuchen mich zu überreden mitzukommen.“
„Trotzdem wart ihr beide nicht beim Unterricht. Und wegen dir ist mein ganzer Tag ein Schutthaufen!“
„Es ist doch nichts ungewöhnliches, dass ihr mit mir unzufrieden seid. Habt ihr euch immer noch nicht daran gewöhnt?“
Kurz war Fahach sprachlos. Er beschloss, diese Aussage nicht zu beachten.
„Ihr seid hier in einem Kloster, in dem es Regeln zu befolgen gibt. Tut ihr das nicht, könnt ihr verstoßen werden. Und so weit ich weiß, hat keiner von euch Familie oder Freunde außerhalb; deshalb seid ihr hierher gekommen und auf uns angewiesen.“
„Meine Gewohnheit ist es, überraschendes zu tun. Warum sollte das ein Regelverstoß sein?“
Wieder war Fahach kurzzeitig zu erstaunt. „Warum – weil du damit die Gewohnheiten von uns allen gefährdest! Darum!“
„Habt ihr jetzt vor, mich zu verstoßen?“ Klang da etwas Furcht mit?
„Also ich würde gerne mal wissen wollen, warum du heute so durchgedreht bist.“
„Ich glaube, weil ich es hier nicht mehr aushalte. Dem Aufbau hier zuzusehen macht mehr Spaß.“
„Gut – wir sollten am besten mal zurückgehen. Ich schätze, ein Oberer wird dich heute noch sehen wollen. Aber vorher sollten wir endlich zum Abendessen gehen.“
Kaum, dass sie das Kloster wieder betreten, läuteten auch schon neunzehn Schläge.
IX
Diese Glocken läuteten zum Essen und riefen alle herbei in den Speisesaal, was Fahach sich nicht entgehen lassen wollte. Die Jungen wie Gefangene vor sich herlaufen lassend, machte er sich auf den Weg, vom Tor schräg über den Haupthof, durch den Osttunnel zum Gartenhof, daran vorbei und im Süden eintretend. Ab hier konnte jeder die Jungen sehen und sie daher keinen Unsinn mehr anstellen, weshalb er sie alleine in den Speisesaal gehen ließ, während er einen Waschraum aufsuchte. Wasser – neues Seifenstück nehmen – waschen – die Seife wegwerfen.
Zurück im Speisesaal saßen die Knaben tatsächlich an ihrem Tisch. Einige schon anwesende Anwärter bedrängten sie mit Fragen, während von den Brüdern andere lauschten. Auch als Fahach eintrat, drehten sich kurz einige Köpfe zu ihm um. Er, dem das peinlich war, trat schnell ein und ging zur Essensschlange. Erst dort sah er sich nach Man um, der an ihrem Tisch gewartet hatte und jetzt kam, sich vor ihn zu stellen.
„Ich sehe, du hattest Erfolg“, sprach er.
„Wie man’s nimmt. Unfug ist wieder da, bereitet aber Ärger und meinen Unterricht musste ich ausfallen lassen. Jetzt heißt es essen und dann in aller Eile versuchen, wieder zu meinem Ablauf zurückzufinden.“
Dann standen sie auch schon am Essen. Den ganzen Tag hatte er kaum etwas zu sich nehmen können und so wäre er nur zu froh gewesen, hätte sich ihm eine überfüllige Auswahl geboten. Doch trotzdem es warme Suppe, Brotscheiben und Obst gab, fand er nur wenig, dass ihn zufriedenstellen würde. Außerdem sollte ihn Man vermehrt vom Essen abhalten.
„Was wird jetzt mit dem Knaben geschehen?“
„Naja, er will seine Fehler nicht einsehen; nichts besser machen. Habe ich eine andere Wahl, als ihn zu einem Oberen zu bringen? So lauten immerhin die Regeln.“ Vor allem aber wollte Fahach die Aufgabe, sich um den Knaben kümmern zu müssen, möglichst bald wieder abgeben.
„Das gab es lange nicht, dass jemand aus dem Kloster verstoßen werden könnte.“
„Aus irgendeinem Grund scheint er es selber zu wollen.“ Fahach war nicht nach Reden zumute, so ebbte das Gespräch nach und nach ab.
Nach dem Essen nahm er sich die beiden Knaben, die überraschenderweise brav gewartet hatten, und ging mit ihnen zu den Oberen. Ihr Weg war gerade und ohne Umwege, da Fahach diesen noch nie gegangen war, vorbei am Wohnbereich und gleich in den Flügel der Obersten. Als erstes versuchte er sein Glück bei dem, der die Suche nach Unfug angeordnet hatte.
Unruhig klopfte er dort an die Tür und erhielt ein „Herein!“
„Tut mir leid, wenn ich störe – wir haben Unfug gefunden.“
„Sehr gut“, sprach der Mann von seinem Pult aus. „Und wer ist da bei ihm?“
„Das ist Butterlöffel, ein Freund von ihm; er hat ihn gefunden.“
„Ah, sehr gut. – Dann ist jetzt alles wieder in Ordnung, ja?“
„Nun – nicht ganz – Unfug will sich nicht den Regeln beugen, und -“
„Was? Warum das nicht?“
„Er sagt, seine Unberechenbarkeit sei seine Regelmäßigkeit, weshalb er sich dem Kloster nicht beugen müsste.“
Mit dieser Antwort schien der Mann nichts anfangen zu können. „Geh damit lieber mal zum Herrn der Anwärter; ich kann euch da nicht helfen.“
Sollte das bedeuten – schon wieder weiter in der Gegend herumlaufen? Fahach hatte seine eigenen Gewohnheiten, denen er nachkommen wollte: Baden, ausruhen und sich für den Abend fertig machen. Immerhin war heute der schreckliche Tag der Feier, und bis zur Eröffnung war es weniger als eine Stunde. Selbst der Oberste, den er verließ, schien sich bereits vorzubereiten. Immerhin hatten die Oberen zusammen mit dem Ältesten auch die Aufgabe, die Feier zu eröffnen. Die Knaben dagegen schienen sich nur zu langweilen oder unwohl zu fühlen. Aber immer noch folgten sie ihm brav, als er sie zu dem Oberen brachte, der die undankbare Aufgabe hatte, über die Anwärter wachen zu müssen. Dieser hatte seine Tür geöffnet und kam ohne Umwege zur Sache, als er die Drei in seinem Türrahmen erscheinen sah.
„Unfug! – Bruder Fahach, ihr habt ihn gefunden? Ich habe mir schon Sorgen gemacht, als ich davon hörte -“
Der Obere war jemand, den man sofort mögen musste. Gleichzeitig konnte Fahach ihn nicht wirklich als Vorgesetzten ansehen. So wagte er es, gleich dazwischen zu sprechen, da er bei ihm auch kaum Angst verspürte.
„Werter Oberster – ich habe ein Problem mit diesen Knaben, bei dem ihr mir vielleicht helfen könnt.“
„Oh?“ Der Mann sah sie besorgt an. „Um was handelt es sich denn?“
„Dieser Junge hier versteht es nicht, sich den Regeln zu beugen, da er meint, dieses Verhalten sei für ihn selber oberste Gewohnheit und damit doch zu unseren Regeln passend. Gleichzeitig richtet er aber schreckliches Unheil an, wie ihr auch selbst so trefflich bemerkt haben solltet. Was also soll ich mit diesem Knaben anstellen?
Eine Weile lang hüllte sich der Mann in Schweigen, während er sich das Kinn rieb und abwechselnd Unfug an- und ins Leere starrte. „So ein Fall ist noch nie vorgekommen, glaube ich. Aufsässige Anwärter – ja. Anwärter, die bestraft werden mussten – ja. Selbst dass Anwärter verstoßen werden mussten – ja. Davon hatte ich selber aber erst einmal einen Fall, sieht man mal von denen ab, die es einfach nicht schaffen und freiwillig gehen. Ich befürchte, da muss der Älteste entscheiden.“
„Das bedeutet – wir müssen zu ihm?“
Kurz darauf ging Fahach mit den Knaben zum Ältesten. Vom Zimmer des Oberen aus hätten sie nur ein paar Schritte gen West machen müssen. Aber noch nie war er auf diesem Wege gegangen und trotz des Zeitmangels konnte er sich nicht dazu bringen, jetzt diese Gewohnheit aufzugeben. Die Jungen murrten zwar, doch verstanden sie und folgten, als er ein gutes Stück zurück ging, mit ihnen den immer noch schwach von der Sonne beleuchteten Hof durchquerte und die Halle der Gebete betrat. Hier waren gerade ein paar Brüder mehr als nach dem Frühstück, und gedachten der schwindenden Sonne. Für gewöhnlich fände in Kürze sogar eine Ansprache des Ältesten aus diesem Grunde statt, doch würde sie heute durch die Mondfeierlichkeiten ersetzt werden. Für Fahach selbst war das mehr als gut, stand doch so niemand auf der Bühne, als sie drei diese betraten und auch kaum ein Gesicht wendete sich ihnen zu. An normalen Tagen hätte ihn dagegen alle angestarrt und vor Scham wäre er fast zerflossen. Doch so konnten sie unbehelligt die Tür zum Gang des Ältesten durchqueren.
Dort ließ er die Jungen kurz warten, während er den Ältesten suchte und ihn sofort in seiner Arbeitskammer fand, wo er einzelne Schriftstücke zusammen suchte, wohl in Vorbereitung auf den Abend. Fahach war froh, dass er nicht in einem anderen Raum war, erhielt sich doch so für ihn noch ein Hauch von Gewohnheit. Ängstlich und in Eile zugleich blieb er in der Türschwelle der offenen Tür stehen. Da der Älteste ihm den Rücken zu wandte und er es sich nicht traute, ihn sich erschrecken zu sehen, klopfte er an den Rahmen.
Der Älteste drehte sich neugierig um und sah ihn überrascht an. „Fahach? Was machst du denn hier?“
Hatte er überhaupt schon mal selbst zum Ältesten gesprochen? Hatte dieser das nicht immer selbst gemacht? Jetzt musste er es; musste etwas zu dem Mann sagen.
„Ähm -“, glorreiche erste Worte, „der Oberste – der Herr der Anwärter – schickt mich – äh – vielleicht habt ihr es schon gehört, dass einer der Anwärter, mein Schüler, heute die Gewohnheiten verwirrt hat -“, kurz wartete er auf Antwort, doch erhielt keine, „- nun – ich musste meinen Unterricht ausfallen lassen – das habe ich noch nie gemacht! – und den halben Nachmittag nach ihm suchen. Er wartet jetzt draußen, falls sie ihn sehen wollen. Jedenfalls – er meint, sich unseren Regeln nicht beugen zu müssen. – Wenn er sich selber unberechenbar verhält, so meint er, sei das schon seine Gewohnheit, und – naja, der Herr der Anwärter wusste keinen Rat – was man mit dem Knaben machen soll – er meinte, ich solle euch fragen… – ja….“ Kurz überlegte er noch, ob er mehr sagen sollte, doch sein Kopf schwirrte, sein Herz raste und sein Geist suchte sich angenehmere Orte.
Da begann der Älteste zu sprechen. „Eigentlich habe ich für solche Angelegenheiten keine Zeit. Wie ihr wisst, muss ich gleich das Fest eröffnen. Aber es klingt als wäre es dringend. Am Ende läuft der Junge vielleicht sonst noch ganz weg. Es wäre wohl am besten, wenn ihr ihn mal zu mir bringt, damit ich mich mit ihm kurz unterhalten kann.“
Fahach nickte noch, dann eilte er sich, Unfug zu holen.
„Er will mit dir sprechen“, sagte er nur, bevor er den Knaben vor sich her in das Zimmer des Ältesten schob.
„Gut“, sprach dieser dann, „Fahach, du darfst gehen. Es ist nicht mehr lang bis zum Fest und du musst dich sicher noch fertig machen, wenn du schon den halben Nachmittag mit diesem Jungen verbracht hast.“
„Sehr wohl“, sprach Fahach erleichtert, bevor er sich frohgemuts aus dem Staub machte.
Zusammen mit Butterlöffel verließ er die Räume des Ältesten und ging durch die Gebetshalle hinaus auf den Hof. Dort trennten sich ihre Wege. Während Butterlöffel nach Süden in den Wohnbereich ging, um zu seinem Zimmer zu gehen, bewegte sich Fahach gen Ost, durch den Westtunnel, über den Haupthof und durch den Osttunnel. Dort ging er wieder ins Gebäude hinein und wechselte in das nächste Stockwerk. Erst unterwegs fiel ihm auf, wie wenig Zeit er doch noch hatte und fragte sich kurz, ob das überhaupt zum Baden reichen würde. Seine eigene Antwort lautete nein, denn bis zum Erhitzen und Einfüllen des Wassers, baden, abtrocknen und anziehen könnten mehr als eine halbe Stunde vergehen. Doch wirklich sehen würde er das erst, wenn es so weit war.
Im oberen Stockwerk gab es einen ganzen Flügel allein für Bäder, Schwitzräume, Erholungszimmer und dergleichen, während die Sporträume nicht fern waren. Er selber nahm nie am Sport teil, doch suchte er öfter die Bäder auf. Da er nicht zusammen mit anderen baden wollte, musste er aber auch manchmal darauf warten, dass eine Kammer frei wurde. Dem war auch heute wieder so. Scheinbar hatten viele Brüder das Bedürfnis gehabt, sich vor dem Fest noch einmal sauber machen zu müssen. Alle Kammern waren verschlossen und aus den Gemeinschaftsräumen hörte er Stimmen. Um dem Bedürfnis nach Reinheit doch schon mal nachzukommen und sich gleichzeitig die Zeit zu vertreiben, bewegte er sich an eines der Waschbecken, die allesamt frei waren. Aus dem Beistellschränkchen nahm er sich ein frisches Stück Seife, entkleidete es, wusch sich Hände und Gesicht und warf danach die Seife in den bereitgestellten Eimer.
Kurze Zeit später öffnete sich auch bereits eine der Kabinen und einer der Brüder kam heraus. Fahach tat noch kurz so, als würde er sich weiter waschen, bis der Mann den Raum verlassen hatte. Danach ging er an die Wasserstelle. – Wie vermutet: kalt. Das Wasser aufzuwärmen würde aber zu lange dauern. Er war einfach zu spät erschienen. Was jetzt – kalt baden oder ganz verzichten? Er entschied sich für ersteres und nahm sich einen Eimer voll Wasser. Damit ging er in die Kammer. Der Bruder hatte sie erstaunlich sauber zurückgelassen, trotzdem wollte er sie nicht einfach so benutzen. Nachdem er sich noch ein Stück Seife geholt hatte, wusch Fahach die Wanne mehrfach damit und mit Wasser aus, bevor er es endlich wagte, sie mit Wasser aufzufüllen.
Das Wasser war kalt und kaum wagte er es, auch nur die Hand hineinzustecken, doch gehörte es dazu, sich zu waschen. Also wagte er es, nachdem er sich endlich entkleidet hatte, einen Fuß hineinzustecken. Es war nicht so, dass dieser ihm auf der Stelle abfror, doch musste er trotzdem erschauern. Wollte er sich das wirklich antun? Kurz versuchte er sich mit dem Wasser anzufreunden, sich an die Kühle zu gewöhnen, doch entschied er sich schnell anders und setzte sich einfach ganz rein. Kurzzeitig dachte er, er müsse sterben, wollte aufspringen und weglaufen. – Doch war er damit noch nicht fertig. Also griff er nach der Seife, welche er sich schon neben der Wanne zurecht gelegt hatte, und fing an sich zu waschen. Mit den Füßen anfangend, arbeitete er sich dabei immer weiter hinauf.
Draußen, außerhalb der Kammer, hörte er immer wieder Geräusche, wie andere sich öffnende Kammern sowie die Brüder, sowohl beim Verlassen, als auch beim sich miteinander unterhalten. Auch wenn er selbst an diesem Ort so niemals recht vergessen konnte, dass er keine Möglichkeit allein zu sein hatte, fühlte er sich dennoch irgendwie in Sicherheit. So kam es dann auch, dass er darüber völlig die Zeit vergaß und einmal sogar kurz vorm Einnicken war. Doch bevor es soweit kam, hörte es, weit am Rande seiner Wahrnehmung, die Glocken.
Was? Jetzt schon! – Er hatte viel zu viel Zeit im kalten Wasser vertrödelt. Eilig stand er auf, trocknete sich oberflächlich ab, ließ dabei das Wasser ablaufen und zog sich an. Da er der letzte sein dürfte, könnten sich um die restliche Reinigung der Wanne auch gut die angestellten Städter kümmern. Er selber aber verließ hastig die Bäder und eilte los, um zum Fest zu kommen.
Buch 4: Der Abend
X
Von den Bädern aus hatte Fahach eigentlich noch einmal in sein Zimmer gehen wollen, doch blieb ihm dafür jetzt keine Zeit mehr. Stattdessen strollte er den Gang entlang und die Treppe hinab, betrat im Erdgeschoss den Osttunnel und wandte sich auf den Haupthof hinaus. Der Wächter am Tor war ein anderer. Schon hatte dieser kaum noch etwas zu tun, da außer Fahach selber nur noch eine Handvoll Nachzügler zum Festplatz eilte. Das Kloster selbst würde den Abend über größtenteils leer stehen; eine gute Gelegenheit für die angestellten Städter, einiges zu säubern. Fahach achtete kaum auf den Wächter oder die anderen Brüder, doch folgte er ihnen. Die Sonne war bereits dabei, sie für diesen Tag zu verlassen, was bedeutete, dass der Älteste in Kürze seine Ansprache beginnen würde.
Kaum, dass Fahach den Klosterhof verlassen hatte, sah er auch schon den Festplatz, der am Hügel auf einer kleinen Hangwiese lag. Am Ostende, dem Westen zugewandt, hatte man eine kleine Bühne errichtet. Diese stellte eine Nachbildung der Bühne des Gebetsraumes dar, sogar mit Stühlen und Pulten. Einige Gestalten saßen bereits da, welches die Oberen sein mussten. Vor der Bühne war eine große Freifläche, auf der bereits Brüder, Städter und Anwärter versammelt standen und sich teils unterhielten. Am Rande dieser Fläche aber hatte man Städtern erlaubt, einige Stände aufzustellen, an denen es später noch geistige Getränke und Nahrung geben würde; kostenfrei für die Brüder, zu überzogenen Preisen für die Städter. Diese schienen sich aber nicht darum zu scheren, denn schon jetzt pilgerten viele zu diesen kleinen Tempeln, wenngleich sie noch abgewiesen wurden mit dem Hinweis auf die Brüder, da es Essen erst nach der Ansprache des Ältesten geben würde.
Die meisten der Städter schienen sich mit den Regeln abzufinden, einige wenige gaben ihren Ärger von sich – doch die schlimmsten, so fand Fahach, waren die, welche die Regeln von Anfang an missachteten und ihr eigenes Essen mitgebracht hatten und jetzt beim Warten in der Menge herumknusperten und -knausten. Schlimm war neben den geradezu ekelhaften Geräuschen vor allem auch all die Duftnoten, die schon von weitem in seine Nase stiegen und seinen Magen zum Knurren anregten. Etliche der Leute quatschten und tratschten miteinander und unterhielten dabei ihre ganze Umwelt, ob diese all dies wissen wollten oder nicht. Aber auch manche der Brüder waren in dieser Hinsicht kaum besser; einige unterhielten sich sogar gut gelaunt mit den Städtern. Fahach selbst hatte dieses Verhalten nie verstehen können; Städter und das Leben im Kloster passten einfach nicht zueinander. Einst hatte er das Leben von Städten wie diese gesucht, später aber hat er sie geflohen und Schutz im Kloster gesucht. Zu Zeiten wie diesen aber kam die Stadt zu ihm, als dickes, fressendes und quatschendes Ungeheuer, das ihn über Jahre verfolgt hatte und alles beherrschen wollte. Wenn er so Brüder und Städter beisammen sah, wirkte es wie eine Niederlage auf ihn.
Man entdeckte er nirgends, weder im Getümmel der Städter, noch bei den wenigen Brüdern, die sich wie Fahach selbst von den anderen abgrenzen wollten. Vermutlich erkannte er ihn aber auch nur nicht, weil von Hinten alle gleich aussahen. Außerdem war es auch egal, da sie außer manchen Wegen und dem Essen eigentlich nur selten zusammen waren, vor allem aber noch nie zusammen eine Ansprache des Ältesten gehört hatten. So war es immerhin mal wieder ein Stück Gewohnheit, als sich Fahach weit außerhalb des Festplatzes hinstellen konnte, mit dem Rücken an einen Baum. Von dort aus war die Bühne nicht greif- und die Oberen kaum erkennbar, doch sprach der Älteste schon immer laut genug, dass er auch so etwas verstehen würde.
Und dann sah er ihn. Der Älteste musste kurz nach Fahach aus dem Kloster gekommen und im großen Bogen um die Menge gegangen sein. Jetzt näherte er sich vom Klosterweg aus der Bühne. Im Anhang, und das wunderte Fahach doch sehr, kam Unfug. Dieser nahm kurz vor der Bühne seinen eigenen Weg und stellte sich zu den anderen Anwärtern, während der Älteste die Bühne betrat. Wie immer zu solchen Anlässen, war er in seine goldene Robe gekleidet, welche die letzten Sonnenstrahlen einfing und zurückwarf. Sein Pult war eine genaue Nachahmung des Tisches aus der Gebetshalle, und auch die Oberen saßen da, wie sie es immer taten, teils mit Getränken vor sich stehend. Am Pult stehend wartete das Oberhaupt des Klosters kurz. Wie auf Befehl verstummten jetzt auch die hartnäckigsten Klatschtreibenden und sahen zu ihm auf. Er machte, wie es seine Art war, noch einmal einen Blick durch die Runde, als würde er sich jeden einzelnen Besucher ansehen. Dann fing er an.
„Heute ist der einhundert und elfte Tag des Jahres und es ist das vierhundert und neunundachtzigste Mal, dass wir dieses Fest begehen wollen. Nachdem ihr nun alle hier seid, können wir beginnen. Die Sonne war uns heute besonders wohl gesonnen. Sie leuchtete uns den gesamten Tag lang, doch muss jetzt zur Ruhe kommen. Seht, wie sie dort im Westen verschwindet, um uns morgen wieder Licht und Leben zu bringen.“ – Damit blickten alle Brüder und viele der Städter gen West und neigten ihr Haupt, während die letzten Strahlen in Gelb und Rot für diesen Tag endgültig verschwanden. Kurz glühte es noch, dann ward es dunkel, doch hoch oben über ihnen leuchtete ein weißer Mond. – „Aber egal, ob unserer Herrin morgen so sehr erstrahlt wie heute oder uns hinter Wolken Schatten gibt, werden wir auch morgen leben und unser Tagwerk verrichten. Mag die restliche Welt auch dem Irrsinn verfallen; wir hier bleiben eisern. – Nun aber zu dem, weshalb wir alle hier an diesem Abend zusammen gekommen sind. Denn heute gedenken wir auch der Tochter der Sonne, dem weißen Mond, welche dort so schön über uns steht und uns Licht noch im Dunkel gibt. So lasst uns auch die Tochter der Sonne preisen.“ – Und wieder sahen die Brüder und mittlerweile fast alle Besucher in die selbe Richtung, hoch zum strahlend weiß und voll leuchtenden Mond. – „Dieser Abend gehört allein dem Mond, welchen wir feiern wollen. Darum sind wir, die Brüder des Klosters der Sonne, wie jedes Jahr seit so vielen vergangenen Jahren hier zusammen gekommen. Doch ihr anderen, die ihr aus der Stadt oder sogar von weiter her gekommen seid, allein um mit uns zu feiern – seid willkommen. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Da dies ein Fest der Freude und nicht nur der Andacht ist, werden, sobald wir endlich hier die Bühne frei machen,“ – ein paar der Zuschauer grinsten und glucksten verstohlen. – „Musiker zu eurer Unterhaltung auftreten.“ – Ein paar der Städter konnten die Regeln der Ruhe hier nicht mehr einhalten und machten ihrem Wohlwollen lautstark Luft. – „Und auch für euer leibliches Wohl soll gesorgt sein. Aber vorher lasst mich noch etwas zur Stadt und zum Kloster sagen. Seit undenkbar langer Zeit schon sind diese beiden zusammen, haben gutes und schlechtes erlebt. Einige von euch arbeiten vielleicht bei uns, andere haben Angehörige oder Freunde hinter den Mauern. Schon immer kauften wir bei euch ein und stellten anderes für euch her. Früher boten wir auch Lehrer und Berater, waren häufiger bei euch. Früher hatte man auch vollstes Verständnis für unsere Art zu leben, heute aber bemerken wir immer häufiger, wie entfremdet man in der Stadt gegenüber unseren Regeln ist. Wir wissen, dass ihr anders lebt als wird, doch ist es für uns wichtig, dass ihr uns versteht. Nach Beratung mit dem Stadtrat wurde daher beschlossen, die Beziehungen wieder zu verstärken. Wir werden sowohl in der Stadt als auch bei uns häufiger Veranstaltungen abhalten, bei denen wir euch von unserem Leben erzählen wollen. Alle, die mehr wissen wollen, sind herzlich eingeladen. Ebenso eingeladen sind alle, die noch eine Arbeit suchen, denn Helfer brauchen wir immer wieder. Deshalb haben wir einen Stand hier drüben errichtet, an dem ihr euch sowohl über unser Leben, als auch über Arbeitsmöglichkeiten bei uns beraten lassen könnt. Jetzt sei aber genug der zahlreichen Worte; lasst uns endlich dem Fest zuwenden.“ – Nachdem die Menge vorerst still gewesen war, als würden sie allesamt selbst öffentlich angeprangert, wagten wenige nun wieder zustimmende Rufe. – „Darum entzündet die Lichter, damit wir sehen können!“ – Sowohl rund um den Festplatz, als auch an Ständen und Bühne wurden daraufhin Fackeln entzündet und in Erde und Halterungen gesteckt. – „Und habt viel Spaß; solange ihr für diesen Abend wollt!“
Diesmal jubelten viele, sowohl Städter als auch Brüder, derweil der Älteste die Bühne zusammen mit den Oberen verließ. Sowohl der Älteste selber als auch viele Obere kehrten wohl jetzt schon heim ins Kloster und überließen die Arbeit des Festes den Brüdern. Die Anwärter dagegen hatten die Aufgabe gehabt, die Pulte von der Bühne zu holen, was sie in fantastisch schneller Zeit erledigten. Da kamen auch schon bunt zusammengewürfelte Musiker, wurden erfreut begrüßt und luden zum Tanze. Während Fahach wieder nichts mit sich anzufangen wusste, entdeckte er endlich Man am Rande der Massen und hielt auf ihn zu. Wie vermutet war dieser in der Menge der Brüder versteckt gewesen. Jetzt aber sah auch er Fahach und kam ihm entgegen. Außerhalb der Festfläche, abseits der Fackeln, begegneten sie sich, während die Menge – hauptsächlich Städter – zwischen den Fackeln zu tanzen und zu feiern begann. Andere, darunter viele Brüder, gingen zu den Ständen, um sich etwas zu essen oder trinken zu besorgen.
„Na -“, begrüßte Man, „wie gefiel dir die Ansprache?“
„Ganz gut, doch gefiel mir der Schlussteil nicht. – Wir haben so schon genug Probleme mit diesen Städtern, da sollte er sie nicht auch noch anlocken.“
„Ah – aber das hatten wir doch schon. – Willst du etwa selber putzen und kochen?“
„Wenn jeder sich um das selber kümmert, was er braucht und verursacht – dann dürfte es nicht so schwer werden.“
„Und wann kommen wir dann noch zu den wirklich wichtigen Aufgaben? Der Sonne dienen, studieren, Werke schreiben, die Anwärter lehren, -“
„Mit solchen Anwärtern wie Unfug kann ich das doch schon jetzt nicht mehr. – Die Auswahl der Anwärter wird immer schlechter. – Aber wir könnten auch die Jungen die Arbeit der Städter übernehmen lassen; sie haben sowieso zu viel Freizeit. – Lass uns mal weiter weg gehen, hier versteh ich mich selber ja kaum noch.“
Und sie gingen, ein wenig ziellos, vom Tanzbereich weg.
„Damit wären wir dann aber auch wieder am Anfang. – Wenn der Älteste nicht für uns wirbt, werden kaum neue Anwärter kommen. Am Ende wird die Bruderschaft immer kleiner und irgendwann wäre sie Geschichte.“
„Gibt es denn keine andere Lösung?“
„Ich fürchte nicht.“
Mittlerweile waren sie unfern des Endes einer Schlange zu einem der Stände angelangt.
„Wie wär’s,“ fragte Man, „wollen wir uns etwas zu essen holen?“
Jetzt fiel auch Fahach auf, wie wenig er an diesem Tag bisher doch gegessen hatte.
Oh – ja – das dürfte nicht schlecht sein.“
Sie stellten sich in der Schlange an. Wie es Fahach gewöhnt war, stellte er den Schlusspunkt der Reihe dar, die nur langsam vorrückte. Doch war er so eine öffentliche nicht gewohnt und sollte es auch sehr schnell bereuen, sich überhaupt erst angestellt zu haben. Nach und Nach kamen weitere Leute, und alle stellten sie sich hinter ihn. Wären es Brüder gewesen, die er zumindest flüchtig kannte, die um Besonderheiten wie der seinen wussten, hätte er damit leben können. Doch es waren fast ausnahmslos Städter. Er wagte es nicht, zurückzublicken und in ihre Gesichter zu sehen, doch wandte er den Kopf so weit, dass es aussah, als würde er etwas in der Gegend beobachten, wobei er aber die Städter aus den Augenwinkeln sah. Gerade hinter ihm waren zwei ältere, untersetzte; ein Pärchen, wie es aussah. Die Frau stand links hinter ihm, der Mann dagegen rechts. Während die Reihe sich fortbewegte, auf den Stand zu, achtete Fahach bereits darauf, Abstand zwischen sich und den Vorderen zu bekommen, um nicht aufzustoßen. Doch schien diese Art der Vorsicht und Rücksichtnahme den Hinteren unbekannt. Das Pärchen ging stets so weit, dass sie immer wieder mit ihm zusammenstießen, dass es fast den Verdacht erweckte, sie wollten ihm so nahe sein. Doch ihm gefiel dies nicht, er wollte Freiraum. Stattdessen hörte er sie hinter sich schniefen, husten und quatschen und roch ihren fauligen Atem. Immer, wenn sie husteten, hielt er den Atem an, in der Hoffnung, nicht zu erkranken. Gleichzeitig spürte er wieder dieses Stechen wie von tausend Nadeln, während sich der Schweiß der Angst seine Bahn suchte. Unruhig sah er sich um, wollte weg aus dieser Schlange, hielt es zwischen all diesen Leibern nicht mehr aus.
„Weißt du schon, was du willst?“ fragte Man plötzlich in seine Angst hinein. „Heute könnten wir uns wirklich mal vollstopfen!“ Er hatte gut reden; hinter und vor ihm standen nur Brüder.
„Oh – äh – könntest du das auch alleine machen? Und ich warte dort hinten auf dich?“
Man, der den Bruder Fahach bereits seit vielen Jahren gut kannte, nickte. „Natürlich – geh nur. Aber dann muss ich halt für dich was aussuchen.“
Fahach verabschiedete sich dankbar und hielt auf den Baum zu, von dem aus er die Ansprache gesehen hatte. Man hatte neben den Ständen auch Tische und Bänke aufgestellt, doch da an diesen kein Platz mehr war, wollte man nicht mit Fremden kuscheln und ihnen beim Schmatzen zuhören, gab es keine andere Wahl. Kurz fühlte er sich albern, schämte sich für seine Angst, doch konnte er nichts dagegen tun. So war er schon immer gewesen und deshalb war auch ins Kloster gegangen. In der einsamen Ruhe am Baum ließ die Angst auch sofort nach, und statt ängstlicher Hitzeanfälle wurde ihm langsam kühl.
Und dann kam auch Man, gerade rechtzeitig zum Schlagen der Einundzwanzig.
XI
Zusammen setzten Man und Fahach sich auf einen Holzstamm, der bei der Befriedung des Hügels zur besseren Sicht entstanden und immer noch nicht von den zuständigen Städtern weggeräumt worden war. Von dort hatten sie einen guten Überblick, ohne im Mittelpunkt zu sein. Das Essen war ihnen auf hölzernen Tellern gegeben worden, um die es nach der Feier nicht schade sein würde. Selber war das Essen wenig eindrucksvoll, doch genügte es Fahach nach diesem Tag völlig. Kurz saßen sie schweigend nebeneinander und aßen, beobachteten das Treiben und dachten nach, doch vermochte es Man wie so oft nicht, seinen Mund gänzlich zu halten.
„Könnte es sein, dass es mehr Besucher sind als letztes Jahr?“
„Oh. – Ich dachte schon, das liegt an mir.“
„Das wird den Ältesten sicher erfreuen.“
„Warum? Der liegt doch jetzt sicher schon im warmen Bett, hat seine Ruhe und freut sich, nicht bei uns sein zu müssen. Und die hier – die meisten sind doch bloß zum Vergnügen hier und werden uns morgen früh schon wieder vergessen haben.“
„Na, soviel wie die trinken wohl erst Übermorgen. – Genau. – Ich komm gleich wieder.“
Tatsächlich hatte Man schon aufgegessen und machte sich jetzt plötzlich auf, zurück zu den Ständen. Fahach blieb verwundert zurück, doch genoss auch die Ruhe. Als er selber fertig war mit seinem Mahl und den Teller neben sich auf den Boden sinken ließ, kam Man zurück. In den Händen zwei große hölzerne Becher haltend, grinste er kurz und reichte Fahach einen davon. Dieser wusste sofort, um was es sich handelte, grinste seinem Begleiter zurück und bedankte sich.
„Ja, so wird der Abend sicher leichter zu ertragen sein.“
Wieder saßen sie nebeneinander, jetzt aber den geistigen Getränken frönend. Vielleicht sollte er das öfter machen, dachte Fahach bei sich. – Einfach, um die Welt ertragen zu können. Doch irgendwie fand er nie die Verlockung dazu.
„Oh – guck dir das an“, sagte er auf einmal, als er eine Frau auf einer der Bänke entdeckte, und deutete auf sie. „Die Städter lassen sich auch immer mehr gehen. Kein Wunder, dass sie immer unzufriedener werden. Kein Wunder vor allem auch, dass ich so etwas hinter mir lassen wollte.“
„Oh ja, vielen täte ein Ausflug zu uns gut. Aber wenn wir schon bei Frauen sind; mir ist da eine aufgefallen, die immer wieder in deine Richtung sieht.“
Sofort wurde Fahach unruhig und bekam feuchte Hände. Das war ein böser Witz.
„Scherz nicht mit mir; du bildest dir das ein.“
„Das tue ich sicher nicht. Aber sie sieht immer wieder hierher.“
„Dann sieht sie bestimmt dich an.“
„Kann nicht sein. – Sie hatte auch her gesehen, als ich weg war.“
„Wen meinst du?“
„Lieber nicht, sonst drehst du noch völlig durch.“ Als er Fahachs besorgten Blick erkannte, lachte er kurz und schlug ihm so stark auf den Rücken, dass dieser sich fast verschluckte. „Trink mehr, dann wirst du es bald vergessen. Denk lieber daran, was du das nächste Mal mit Unfug anfangen wirst. Es wirkte nämlich nicht so, als müsste er das Kloster verlassen.“
Eine schlechte Nachricht kam wirklich selten allein. „Ja, das dachte ich auch…“
Aber tatsächlich war Fahach in Gedanken mehr bei dieser Frau, von der Man gesprochen hatte, nippte an seinem Getränk und starrte in die Menge, um etwas zu erkennen. Die Besucherreihen waren sehr gemischt. Von Eltern, die mitsamt ihren Kindern da waren, über noch ansehbare Gestalten hin zu solchen, bei denen Fahach aufgrund Alter oder Körperumfang lieber weggesehen hätte. Doch irgendwie musste er auch hinstarren, wie bei einer Krankheit, bei der man nicht wegsehen könne. Teilweise fühlte er sich beobachtet. Gab es diese Frau wirklich? Würde sie seine Bewegungen, seine Handgriffe sehen? – Bloß nicht den Becher fallen lassen.
„Ah, morgen wird wieder ein ganz normaler Tag sein.“
„Das hoffe ich. – Heute ging schon genug schief, dass es für die nächsten Wochen reichen dürfte.“
„Stell dir mal vor, es würde deine Gewohnheit werden, dass jeden Tag etwas fehl läuft. – Wie wäre das?“
„Hör‘ auf damit – das ist grauenvoll. Da hätt‘ ich auch in der Stadt leben können.“
Eine Weile saßen sie noch so da und Fahach versuchte herauszufinden, ob er beobachtet wurde, da sprach Man plötzlich wieder. „Sieh mal, da hinten.“
„Was?“ Verwirrt versuchte Fahach zu verstehen, was gemeint war, doch konnte „Da Hinten“ für so vieles stehen und gerade in dem Moment fing sein Geist auch noch an sich zu drehen. – Ach, vielleicht sollte er wirklich häufiger etwas dieser geistigen Getränke zu sich nehmen.
„Na da hinten.“
Fahach konnte nicht anders, als das kurzzeitig sehr lustig zu finden und kicherte, als wäre er ein kleines Kind. „Ich weiß immer noch nicht, was du meinst.“
„Da hinten, rechts von der Bühne, in den Schatten zwischen den Bäumen. – Siehst du es?“
Hatte Man wirklich geglaubt, dass er das bei einem „Da Hinten“ erkennen würde? Dass er bei einer so ungenauen Aufgabe auch nur annähernd in die richtige Richtung gucken würde?
„Ich weiß nicht so recht – was meinst du denn?“
„Das sind doch Anwärter, oder? Unsere Anwärter!“
„Ja und? – Ich seh‘ ni- oh, doch.“ Da sah er auch die drei Anwärter, die zwischen zwei Bäumen standen und irgendwas in den Händen hielten. – Aber er verstand immer noch nicht. „Und?“
„Siehst du nicht, was die da machen?“
„Nein.“
„Ich wette, die rauchen da.“
„Oh.“ Sollte er entsetzt oder neidisch sein? – Oder sich über die Belanglosigkeit wundern?
„Du weißt genau, dass es verboten ist.“
„Abends müssen wir nicht auf sie aufpassen…“
„Trotzdem – ich gehe jetzt zu ihnen hin. Kommst du mit?“
„Oh – ich weiß nicht – ich glaube, ich müsste mal hier hinter den Baum -“
„Na gut. Dann mache ich das selber. Oder hole zur Not noch den Herrn der Anwärter. – Bis nachher.“ Damit ging er, den das Getränk wohl auch zu Kopf gestiegen war, und ließ Fahach zurück.
Dieser sah ihm kurz nach, bevor er sich entschloss, seinem eigenen Hinweis zu folgen. Viel zu selten hatte er selbst dazu die Gelegenheit. Als er zurückkam, wünschte er sich aber fast, er wäre nicht gegangen, wäre mit Man zu den Anwärtern. Denn nichts hätte schlimmer sein können, als das, was ihn jetzt erwartete.
Plötzlich stand sie da. Eine fremde Frau – gut, für Fahach waren alle Frauen fremd – in einem gemeinen Kleid der Städter, in der Hand einen Becher. Später sollte Fahach sich äußerst deutlich an sie erinnern können. Das Gesicht, so gewöhnlich wirkend, verstrahlte dennoch etwas; die Haare, rotbraun, schulterlang und offen; vor allem die Augen mit dem unruhigen und doch starrenden Blick. Fahach entdeckte sie nicht sofort, war zunächst gedanklich dabei, zu seinem Sitzplatz zurückzukehren. Doch kaum war er da, sah er sie dort, mehrere Schritte weit entfernt und ihn ansehend.
Sofort wurde er unruhig. Was wollte sie? Warum sah sie so zu ihm herüber? Sollte er sich setzen oder nicht? Wenn er stehen bliebe, wie schlecht würde das wirken? Würde er sich setzen, wie könnte er das schaffen, ohne sich lächerlich zu machen? – Er musste sich setzen, es ging nicht anders, alles sonst würde seltsam aussehen. Unbeholfen ging er dem nach, achtete auf jeden Handgriff, jede Bewegung – und doch war eine jede davon ruckhaft und falsch. Als er schließlich saß, war es aufrecht und nicht entspannt, wie er sonst tun würde. Mit den Händen ergriff er den Becher, welchen er auf dem Boden zurückgelassen hatte, drehte und wendete ihn zwischen den Fingern, kannte bald jede einzelne Furche im Holz und versuchte beschäftigt auszusehen. Wurde es wärmer? Nein, wieder einmal spürte er dieses Stechen des sich anbahnenden Angstschweißes und überlegte fieberhaft nach einem Ausweg. Wo war Man? Warum hatte er ihm dies angetan, warum hatte er ihn allein zurückgelassen? Wann würde er endlich zurückkommen? Konnte er etwa seine Gedanken nicht lesen, seine stillen Schreie um Hilfe, um Rettung? Vielleicht sollte er einfach losgehen, weg von hier, an einen anderen Ort. An den Rand der Menge, die mit ihrer Masse Sicherheit bot oder zu Man und den Anwärtern.
Er wollte schon aufstehen, wollte losgehen, sah hoch – und sie an, wie sie vor ihm stand.
„Du bist doch einer von denen aus dem Kloster, oder?“ Ja, einer der Bruderschaft. – Doch der Gedanke ging zu lange in seinem Geist um, als das er ihn hätte aussprechen können. „Darf ich mich setzen? Und wieder überlegte er, was er sagen, wie er antworten, auf welche Art er verschwinden könne – doch da saß sie auch schon. „Warum sitzt du hier so allein?“
„Äh – ein Freund -“
„Ja, den habe ich gesehen. Aber er ist gegangen. – Wie findest du das Fest?“
„Nun -“, seine wirkliche Meinung hätte ihn auszudrücken Stunden gefordert, doch stand er unter dem Druck, schnell antworten zu müssen, „ganz nett.“
„Ah“, sprach sie und nickte, „ich bin das erste Mal hier. Wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Und dass sich hier so nette Leute ‚rumtreiben.“
Sein Verstand raste, als er versuchte, eine Antwort zu finden, etwas zu sagen, einen Ausweg zu finden. Seine Finger spiegelten das wieder und drehten und wendeten den Becher immer schneller.
„Er findet aber jedes Jahr statt.“ Was für eine sinnlose Antwort – doch sie verschaffte Zeit.
„Was macht ihr da oben eigentlich? Da im Kloster?“
Was sollte man darauf erwidern? „Na – wir leben da – forschen, lernen, lehren. – Einige stellen auch Waren für die Stadt her. – Also – wir sind wichtig für die Stadt. -“
Kurz lachte sie, was ihn erschrak. „Keine Sorge, ich soll dich nicht aushorchen und dafür sorgen, dass ihr geschlossen werdet, falls du das fürchtest.“
„Oh – äh – nein – es stimmt halt nur -“
„Ich habe gehört, ihr macht immer nur dasselbe. Stimmt das auch?“
„Naja – wir leben nach festen Gewohnheiten und Regeln.“ Er verspürte nicht wirklich Lust, dies einer Außenstehenden, Unwissenden beizubringen, und seine Angst schwang plötzlich in Abneigung um.
„Verstehe. Wie bist du da gelandet?“
Wieder verspürte er diese Abneigung, die Abweisung, das Gefühl, sie geistig wegzustoßen. „Es war das richtige. – Ich musste es tun.“
„Frauen nehmt ihr wohl nicht auf, wie?“
Auf den Gedanken war Fahach noch nie gekommen. Es würde sicherlich alles durcheinander bringen. – Er sagte nichts.
„Manchmal will ich auch weg aus der Stadt. Da wäre etwas wie das Kloster sicher nett.“
„Kann sein.“
„Du sprichst nicht viel, wie?“ fragte sie mit leichter Freude.
Fahach aber kam das wie ein Angriff auf sein innerstes Selbst, einen Stich in seine Mitte vor. Sofort baute er seine geistige Verteidigung weiter aus, suchte nebenbei nach einer Antwort – und fand keine.
„Naja, ich finde das ganz gut“, sagte sie. „Da, wo ich herkomm‘, müssen alle andauernd sprechen, als würde es sie sonst nicht geben.“ So wie du? Fragte sich Fahach. „Du sitzt hier so schön ruhig, abseits all der Spinner da – manchmal braucht man das. – Was dagegen, wenn ich noch bleibe? Du bist nett.“
Was sollte er da bloß sagen? Geh bitte, du kommst mir zu nah? – Und doch – irgendwie gefiel ihm das. – Der größere Teil von ihm aber wollte fliehen. – Immer noch. „Nein.“
„Schön. – Vielleicht können wir uns ja öfter hier mal sehen, auch nach dem Fest?“
„Vielleicht…“
Sah man ihm seine Angst nicht an? War er nicht bleich oder .- im Gegenteil – rot?
„Gut! – Sag mal – du hast da doch was getrunken. War es das Zeug von dem Stand da hinten?“
Er folgte ihrem Fingerzeig, doch wusste er es nicht. „Keine Ahnung. – Der Bruder, der mit mir hier war, hat es von irgendwo geholt -“ Sein bisher längster Satz in diesem Gespräch.
„He – naja – Lust auf mehr? Ich könnte uns was holen. – Dann könnten wir zusammen was trinken.“
„Ja, warum nicht.“ Vielleicht würden ihm mehr geistige Getränke helfen, seine Angst zu vergessen.
„Und du wirst nicht weglaufen?“
„Was?“
„Du wirst immer noch hier sein, wenn ich zurückkomme?“
„Oh – ja – sicher.“ Klang er zuversichtlich oder nicht?
Ihr schien es zu reichen, denn sie stand auf, nahm ihm den Becher ab – das Berühren ihrer Finger ließ ihn noch einmal aufschrecken – lächelte ihn an und verschwand.
Er aber blieb zurück. – Zurückbleiben? Sollte er wirklich bleiben? Irgendwie war sie nett. – Und doch – sie machte ihm Angst. In der Ferne sah er Man bei den Anwärtern – immer noch – und sie schienen viel zu besprechen zu haben. Gehen oder bleiben? Er überlegte hin und her, fühlte sich innerlich zerrissen. Sie sah er nicht mehr, war verschwunden in der Menge. Sollte er auf sie warten? Schließlich entschied er sich – und stand auf.
Er wagte es aber nicht, ohne Umweg zu Man und den anderen zu gehen. Was, wenn sie ihn auf seinem Wege sehen würde? Er wusste nicht, was er schlimmer finden würde: Wenn sie ihn bei seiner offensichtlichen Flucht sehen würde und enttäuscht wäre, würde ihn dies ebenso treffen, als wenn sie ihm erzürnt nachkäme.Also machte er einen riesigen Bogen, ging zunächst die Anhöhe hinauf gen Kloster. Kurz überlegte er sogar, wirklich schon heim zu gehen, sich in sein Bett zu legen. – Doch noch nie hatte er so etwas vor dem dreiundzwanzigsten Schlag getan.
Der Weg zum Kloster war vom Festplatz aus nicht einsehbar, wenn es auch das Kloster selbst sehr wohl war. So kreuzte er an dieser Stelle den Weg und begab sich auf der anderen Seite in die Senke, welche an der Seite des Weges war. Dort gehend dürfte man ihn ebenso nicht vom Platz aus sehen. Er folgte dem Weg also, bis er über die Anhöhe des Dammes die Bäume ragen sah, hinter denen Man und die Anwärter sein müssten. Vorsichtig erklomm er den Weg, bis er einen Blick auf Platz und Bäume erheischen konnte, zwischen denen er selber gesessen hatte. Der Baumstamm war verlassen, es gab dort kein Zeichen von ihr. Den Platz beobachtete er länger und forschend, doch sah er sie auch da nicht. – Doch, an einem der Stände war sie fast so weit, eine Bestellung aufzugeben.
Sein Herz fing an zu rasen, als sei er bei einem Wettrennen und kurz davor, zu verlieren. Er beschleunigte seinen Schritt und sah vor sich jetzt auch die Knaben: Unfug und zwei andere. – Und daneben Man. Doch nein, er schimpfte nicht, redete auch kaum – sondern lachte.
Da hörte Fahach vom Kloster her die zweiundzwanzig Glockenschläge.
XII
„Was tut ihr da?“ fragte Fahach, als er bei den anderen angelangt war.
„Ah, Fahach. Ist dir langweilig geworden?“
Von den drei Anwärtern bezeugten zwei dem Ankömmling kurz ihre Ehrerbietung, derweil Unfug nur – guckte.
„Langweilig? – Ich – äh – ich muss mit dir mal in Ruhe sprechen.“
„Na gut – wir haben uns gerade Geschichten erzählt. – Sehr lustig. – Dann mache ich jetzt mal Pause und komme mit dir.“
Die beiden gingen einen weiteren Halbbogen um den Festplatz herum, bis sie auf einer Wiese waren, die sich vom Kloster aus gesehen schräg hinter der Bühne befand. Man hockte sich einfach auf den Boden, doch Fahach wollte seine Kleidung nicht beschmutzen und blieb stehen.
„Was hat eigentlich so lange gedauert?“ fragte er.
„Gedauert? Was meinst du?“
„Na wolltest du nicht gleich zurück kommen?“
„Hatte ich das gesagt?“
„Ich dachte, das wäre‘ selbstverständlich? Ich würde dich auch nicht so einfach und so lange zurücklassen.“
„Du hast dich doch noch nie beschwert, alleine gelassen zu werden.“
„Ich wurde dann ja auch noch nie von einer Frau angesprochen!“
„Oh – so ist das. Wie war es denn?“
„Wie war was?“
„Na – mit der Frau.“
„Sie hat soviel gesagt – wollte so viel wissen – wollte mit mir etwas trinken.“
„Oh. Ist das schlimm?“
„Ist das -?“ Fahach war fassungslos; kannte Man ihn nicht, waren sie nicht Freunde? „Natürlich ist das schlimm! Sie hat – mir Angst gemacht.“
„Und warum bist du nicht zu uns gekommen?“
„Ich konnte nicht – was hätte ich denn sagen sollen?“
„Dass du weg musst. – Probleme mit den Anwärtern.“
Fahach erschien das etwas zu einfach; er suchte nach einer Antwort, warum das nicht möglich gewesen ist, doch fand keine.
„Ah, du wolltest gar nicht weg.“
„Ich wollte – doch – ich – weiß es nicht. Aber darum geht es auch nicht.“
„Worum dann?“
„Dass du nicht zurückgekommen bist.“
„Ich verstehe nicht.“
Da kannten sie sich schon so lange und er verstand nicht? Konnte das wirklich sein?
„Wie könntest du nicht verstehen? – Was würdest du sagen, wenn ich dich in einem solchen Augenblick allein zurück lasse?“
„Hm – ich weiß nicht. – Vermutlich wäre ich selber gegangen. – Aber ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst.“
„Na gut.“ Fahach war selber überrascht über seinen plötzlichen Zorn. „Aber was hat denn nun so lange bei den Anwärtern gedauert? Erzähl schon.“
„Naja – als ich zu ihnen bin, habe ich erst mal den strengen Lehrer gespielt. Sie an die Vorschriften erinnert und so. Sie taten auch zumindest reumütig. Dann erinnerte ich Unfug daran, dass besonders er sich gut benehmen müsste, will er nicht doch noch gehen. Da fiel mir erst ein, dass ich ja noch gar nicht wusste, was mit ihm jetzt eigentlich geschehen soll. Also fragte ich ihn. Und er erzählte, dass er eine Unterredung mit dem Ältesten gehabt hatte. Was dabei herauskam – lass dir das am besten von ihm selber erzählen, sonst glaubst du diese Geschichte ja doch nicht. Irgendwie kamen wir dann noch auf Erlebnisse, die wir so hatten. Ich erzählte ihnen, dass ich als Anwärter öfter auch gegen die Regeln verstoßen hätte. Unfug fragte, ob das auch selbst für den Ältesten und dich gelten würde.“
„Was hat er?“
„Ja, der Knabe interessiert sich für dich.“
Fahach gefiel das nicht und das sah man ihm an.
„Jedenfalls sagte ich, dass du schon immer so schlimm warst – nein, das war nicht böse gemeint!“ lachte er, doch Fahach runzelte die Stirn. „Wie das beim Ältesten aber war, wusste ich nicht. Als ich damals hierher kam, war er schon einer der Brüder.“
„Und was dann?“
„Dann?“
„Oder war das schon alles?“
„Nein – wir kamen darauf, wie es für die Anwärter sein musste. Also das Leben im Kloster. Heute, für sie. Die anderen beiden sind noch Neulinge; sie können uns von unserem Leben erzählen, wie wir es selber nie sehen würden. Es war schon aufschlussreich.“
„Hm – sie halten uns sicher für Monster.“
„Nein. – Eigentlich nur dich“, sagte er, mit einem Grinsen.
„Ich finde das nicht lustig“, war Fahachs grimme Antwort.
Man wurde daraufhin selber ernst. „Sie haben nur Angst, es uns nicht recht machen zu können.“
„Außer Unfug.“
„Außer er. – Aber wie gesagt, das soll er dir nochmal selber sagen.“
„Ich glaube, der Tag wurde zu lang für mich. – Ich habe schon seit einer Weile Kopfschmerzen.“ Langsam fiel ihm auch eine starke Erschöpfung auf; geistig wie körperlich.
„Lange müssen wir auch nicht mehr bleiben. – Soweit ich weiß, sind wir nie länger als bis zum dreiundzwanzigsten Schlag bei diesen Feiern geblieben. Und dann wartete noch kurz ein Buch auf mich.
„Ah, vermutlich das, welches ich heut‘ Mittag nicht finden konnte. – Eben, weil du es vor mir versteckt gehalten hast.“
Jetzt kehrte Mans Grinsen zurück, als er diesen Scherz hörte. „Wir sollten nochmal zu den Anwärtern zurück. – Allein, Unfug hat interessantes zu erzählen, das wirst auch du so sehen.“
„Außerdem müssen wir auf diese Unruhestifter Acht geben.“
„So schlimm sind sie nicht.“
Und tatsächlich hatte Man immer noch nicht erzählt, woran er die Knaben überhaupt hatte hindern müssen. – Ob sie wirklich etwas angestellt hatten? Möglicherweise waren sie auch brav gewesen, während Fahach und Man sich versehen hatten. – Und dann hätte auch Man überhaupt nicht erst gehen müssen. – Kurz brodelte wieder Zorn in ihm auf, doch wo Unfug war, konnte es nicht brav zugegangen sein.
Die Drei standen immer noch dort, wo sie zurückgelassen worden waren und sahen wie die Unschuld in Gestalt aus. Sie wirkten nicht, als hätten sie die Abwesenheit der Älteren für Unsinn genutzt und selbst Unfug stand einmal unverdächtig da. Stattdessen hatten sie wohl einiges zu bereden gehabt, wenngleich nichts wichtiges dabei gewesen zu sein schien. Kaum, dass die vollwertigen Brüder wieder erschienen, verstummten sie aber kurz, warfen einen Blick zu ihnen herüber – und fuhren fort. Ihr Gebrabbel drehte sich – um das Essen der Klosterküche – soweit Fahach das verstand.
„Na, was habt ihr angestellt, während wir weg waren?“ fing Man auch passend scherzhaft an.
Die beiden jüngeren grinsten nur verlegen, derweil Unfug der Antwortende war. „Wir planten wie immer die Stürzung der derzeitigen Herrschaft, das wisst ihr doch.“
Obwohl er ansatzweise lächelte, jagte der ernsthafte Tonfall Fahach einen Schauder über den Rücken. „Ist dem so, ja?“ fragte er, und erhielt ein etwas erschreckendes Lachen zur Antwort.
„Nimm ihn nicht so ernst, er heißt immer noch Unfug“, beschwichtige Man. „Aber trotzdem, wir werden nicht mehr lange hier bleiben am heutigen Tage und ich versprach Bruder Fahach, dass du, Unfug, ihm noch einmal erzählst, was du schon mir erzählt hast.“
„Dass ich Daheim bei meinen Eltern immer den Hof ausmisten musste?“
„Nein, das andere – das wichtige.“
„Ach, das meint ihr.“
Da sprach einer der Anwärter dazwischen: „Was meint ihr damit? Ihr geht?“
„Genau das soll es bedeuten.“
Fahach ertappte sich bei dem Gedanken, dass viele der Anwärter doch einfach – dumm seien. Oder zumindest schwer begreifend.
„Heißt das, wir müssen dann auch gehen?“
„Ich würde aber gerne noch bleiben“, sprach auch der andere Knabe.
„Ihr seid doch mit dem Herrn der Anwärter hierher gekommen, oder?“ fragte Man.
„Ja“, meinte einer der Knaben mit verwirrtem Blick.
„Ja hat der euch denn keine Anweisungen gegeben? Bisher war es immer so, dass ihr dann auch mit ihm wieder zurückkehren musstet. Hat er auch dazu nichts gesagt? – Aber das sind alles Regeln, das muss er euch gesagt haben.“
Die beiden Anwärter aber sahen sich nur ratlos an und zuckten dann missmutig mit den Schultern. Die Anwärter von heute waren schon lange nicht mehr das, was sie früher einmal waren, dachte Fahach sich. Oder hatte Man vielleicht Recht gehabt und in Wahrheit waren sie noch genauso, wie sie es selber damals waren? So recht vermochte er das aber nicht zu glauben.
„Vielleicht solltet ihr dann lieber mal zu ihm gehen und ihn fragen. – Was haltet ihr davon?“
„Zum Herrn der Anwärter gehen -?“ Dem Anwärter sah man das Unwohlsein förmlich ins Gesicht geschrieben und auch sein Freund sah nicht gerade begeistert aus. „Könntet ihr das nicht machen?“ wagte er dann noch zu fragen und Fahach spürte erneut eine Woge des Zorns in sich aufsteigen.
Doch Man konnte antworten, bevor er selber etwas gesagt hätte: „Wir sind eure Lehrer und sollen auf euch aufpassen, aber nicht alle eure Aufgaben übernehmen.“
Die Anwärter sahen kurz etwas zerknirscht aus, als hätten sie gerade eine größere Beschimpfung hinter sich. Fahach war erstaunt. – Wenn er das doch nur auch könnte.
„Also, geht lieber selber hin. – Wenn ihr euch nicht traut, den Obersten zu fragen, so fragt doch andere Anwärter. Es können ja nicht alle von euch so unaufmerksam sein, oder?“
Wieder sahen sie etwas getroffen aus, doch diesmal nickten sie reumütig.
„Komm, gehen wir“, sagte der eine zum anderen und schon verschwanden sie in Richtung des Festplatzes, um dort nach anderen Anwärtern zu suchen. – Oder sollten sie vorher schon ihren Mut finden; um nach dem Obersten zu suchen.
„Das habt ihr gut gemacht“, meinte Unfug, doch Man entlohnte ihn mit einem weniger freundlichen Blick.
„Noch stehen wir auch dir vor, also zügel dich lieber.“
Fahach dagegen wurde langsam ungeduldig. Er wollte zurück in sein Zimmer, in die Ruhe, die Behaglichkeit – in sein Bett – und nicht für die restliche Nacht an diesem Ort herumstehen.
„Was ist es denn nun, dass ich hören sollte? Fangt schon endlich an.“
„Seid ihr sicher?“ fragte Unfug noch, doch sah dabei Man an.
„Mach schon“, sagte auch dieser.
Fahach aber wunderte sich, was das alles sollte. Konnte es denn so schlimm sein, dass der Knabe derart zögerte?`Oder war es einfach nur so unsinnig, dass er es sich nicht traute, damit anzufangen? Das Herauszögern störte ihn.
„Na gut“, sprach Unfug, sah erst mal niemanden mehr an, danach hauptsächlich Fahach, doch hin und wieder auch Man. „Dann erzähle ich euch jetzt, was noch geschehen ist, nachdem ihr mich beim Ältesten abgegeben hattet.“ Und schon war Fahach interessiert, denn genau das fragte er sich doch schon seit einer Weile. „Also. – Ich stand dort vor dem alten Mann; ihr wart schon gegangen. Obwohl er mir kurz danach sagte, dass er kaum Zeit haben würde, bevor er zum Fest müsse, stellte er mir noch die üblichen unnützen Fragen. Wie es mir ging, wie der Tag war. Dazu konnte ich aber nicht viel sagen. Plötzlich fragte er mich, wie ich auf die Idee gekommen sei, einfach aus dem Kloster zu verschwinden und den Unterricht zu schwänzen. Ich sagte ihm, dass ich Langeweile gehabt hätte. Er sagte das, was ihr alle mir dauernd gesagt habt, dass ich damit nämlich gegen die Gewohnheiten und Regeln verstoßen würde.“
„Das hast du uns alles vorhin aber nicht erzählt“, unterbrach Man.
„Da war es ja auch noch nicht wichtig. Doch ich glaube, dass Bruder Fahach die ganze Geschichte; alle Einzelheiten hören will.“
„Mach weiter“, bestätigte dieser.
„Natürlich sagte ich ihm dasselbe, wie euch, denn es ist einfach die Wahrheit: Ich handelte so, wie ich gehandelt hatte, weil dies meine Gewohnheit sei. Genauso wie ihr immer dasselbe macht, mache ich immer etwas anders.“
„Das tatest du aber noch nicht, als du zu uns kamst. Außerdem ist es Gesetz, gleich zu bleiben; dein Handeln ist eine Störung, die uns allen schadet.“
„Das sagte der Älteste so ähnlich auch. Erstmal: Natürlich versuchte ich mich anzupassen, als ich damals herkam, denn ich wollte ein Zuhause und nicht zurück geschickt werden. Aber ich kann das einfach nicht mehr; ich kann mich nicht verleugnen.“
„Also störst du, machst deinem Namen alle Ehre.“
„Den Namen habt ihr mir gegeben. Aber wie auch immer, der Älteste hatte schon weiter gedacht. Er schien schon eine Weile über mich und andere wie mir nachgegrübelt zu haben. Seine Erkenntnis lautet, dass wir wirklich stören, aber nicht nur euch, sondern auch uns. So kann es nicht weiter gehen.“
„Also wirst nicht nur du, sondern auch andere verbannt?“ Fahach war etwas verwirrt und überrascht.
„Nein nein, ihr versteht nicht. Dem Ältesten kam eine viel bessere Lösung und obwohl er mich damit überraschte, kann ich nicht verleugnen, dass es mir gefällt.“ Fahach wartete einfach, was noch kommen könnte. „Wir sollen wirklich das Kloster verlassen. Aber nicht aus Verbannung. Wir sollen einen neuen Zweig der Bruderschaft bilden, einen, der wandert und die Lehren des Klosters in der Welt verbreitet.“ Fahach war – milde gesprochen – baff. „Bei der nächsten Ernennung werde auch ich ein Bruder. Ein vollwertiger, wie ihr. Und sollte zukünftig alles gut gehen, werde ich Oberster und Herr der Wandernden.“
Kurz blickte Fahach zu Man, der keine Miene rührte. Er wusste nicht, wie er sich fühlen sollte. Froh, diesen Knaben loszuwerden? Erfreut über diesen unsinnigen Scherz? Oder als würde er sterben, da seine ganze Welt umgekrempelt und verändert wurde. War dies das Unglück, auf das der Tag hingearbeitet hatte, mit all diesen Brüchen in seiner Gewohnheit?
„Das ist aber noch nicht alles“, sprach Man da.
„Wollen wir es ihm wirklich jetzt schon sagen? Es ist eine herrliche Überraschung; sie sollte vielleicht vom Ältesten selber verraten werden.“
„Sag schon; es ist besser so“, beschloss Man.
„Also – da ich selber unterwegs sein werde, kann ich nicht gleichzeitig alle überwachen, von allen Nachrichten sammeln, für alle eine Anlaufstelle sein. Wir werden hier im Kloster jemanden brauchen, der immer mit uns in Verbindung bleibt. Die Aufgabe wird wichtiger werden als die des Herrn der Anwärter! Nach dem Ältesten selber könnte es vielleicht sogar die wichtigste des Klosters sein. Und für den Ältesten kommt da nur einer in Betracht, der die Aufgabe übernehmen könnte; der ihn durch seine Standfestigkeit überzeugt hat. – Ihr werdet einer der wichtigsten Männer hier werden! Stellt euch das mal vor! Und gleichzeitig könnt ihr dabei immer in euren Gewohnheiten verbleiben.“
„Abgesehen davon, dass er wohl erst mal alle wird überarbeiten müssen. Gartenarbeit, Lehren und dergleichen werden wohl kaum noch Momente finden“, gab Man zu bedenken.
Doch Fahach hörte all das nur noch teilweise. Zeit seines Lebens hatte er nie anderes machen wollen, als immer dasselbe, und dabei Ruhe und Abgeschiedenheit verspüren und genießen. Er, der nichts wusste von der Welt da draußen, wollte eigentlich nur völlig allein, vielleicht noch mit einem Buch sein. Er spürte noch, wie sein Geist sich erhob, während er sich vorstellen musste, wie tagein, tagaus Nachrichten ihm zugestellte werden würden, er Entscheidungen zu treffen hätte, seine Gewohnheit immer wieder Störungen zu erleiden hätte und vor allem – wie Unfug ihm gleichgestellt sein würde.
Er wusste später nicht mehr genau, wie er ins Bett gefunden hatte, doch erzählte Man ihm, er hätte ihn leiten müssen.
Als die Glocken dreiundzwanzig mal schlugen, lag er bereits, entgegen seiner Gewohnheit, im Bett und schlummerte ein.
Das Nehmen der Kräuter für ein gutes morgendliches Gefühl hatte er vergessen.
Der nächste Tag
XIII
Gong!
In Wahrheit lag er schon eine Weile wach. Da er zu früh ins Bett gekommen war, wurde er auch zu früh wach. Trotzdem hielt er an seinem Bett fest. – Die Gewohnheit verlangte es.
Gong!
Kaum, dass er es merkte, doch dämmerte sein Bewusstsein davon, suchte den nächsten Traum – als würde es gerufen werden, als würde man es gar entführen. Doch ein anderer Teil von ihm hielt an etwas fest. – Was war es doch? – Warum sollte er aufstehen? – Oh – ja – deshalb, genau.
Gong!
Die Gewohnheit verlangte es. Würde er dem jetzt nicht nachkommen, so würde es sich nie wieder einpendeln, ein geregeltes Leben wäre dann nicht mehr möglich.
Gong!
Aber er wollte seine Regelmäßigkeit zurück. Seit sicher einer Stunde dachte er über den gestrigen Tag nach und was dort alles schief gelaufen war. Heutige Rückkehr zur Gewohnheit würde sicher wieder alles ins Lot bringen. – Der gestrige Tag? Wann war da aufgestanden? Ach ja, beim vorletzten Schlag.
Gong!
Mühsam raffte er sich auf. Durch sein Fenster fiel das Morgenlicht in den kahlen kleinen Raum, der aussah wie immer.
Gong!
Damit war die Nacht für ihn beendet und ein neuer Tag lag vor ihm. Wie jeden Morgen schlüpfte er als erstes in seine Sandalen, zuerst links, dann rechts. Gähnend erhob er sich, entledigte sich seines Nachthemdes und legte dieses gefaltet auf seine Schlafstatt, nachdem er diese gemacht hatte. Als nächstes käme die Morgenwäsche dran. Den linken Fuß auf das Bodenbrett mit der Flammenzeichnung, den rechten auf dessen Nachbarn. Acht Bretter waren es bis zur Waschschüssel. Schlaftrunken klatschte er sich etwas Wasser ins Gesicht, um wach zu werden. – Doch bringen tat das wenig. Vorgestern hatte er vergessen, seine Kräuter zu nehmen, und war dafür vom Schicksal bestraft worden. Auch gestern hatte er es wieder vergessen. Der plötzliche Schub der Angst ließ ihn wach werden.
Die Drei Bretter zu seinem Kleiderschrank überquerend öffnete er den linken, dann den rechten Flügel und nahm sich seine heutige Kleidung. Erleichtert über die Vertrautheit ging er zurück zum Waschbecken. Im Halbschlaf rasierte er sich, vorsichtiger als sonst, den gestrigen Schnitt sehend, und war nach vollendeter Leistung unendlich stolz auf sich. Nachdem er mit Aufstehen, Waschen, Anziehen und Rasur fertig war, galt es, hinaus in die Welt zu treten und sich auf den Weg zu machen.
Andächtig – oder schläfrig – öffnete er seine Tür und wagte einen ersten Blick hinaus.
„Morgen, Fahach!“ Wie immer gut gelaunt ging da einer seiner Brüder an ihm vorbei, kaum auf die zu betretenden Bretter achtend, eilend gen heutiger Predigt.
„Morgen“, murmelte auch er, als der Bruder schon halb verschwunden war, und machte da erste Schritte auf den Gang.
Die Brüder huschten teils an ihm vorbei, während er auf jedes einzelne Brett achtete, nur hin und wieder es ihm gleich tuende sehend.
Im Gang mit den Steinplatten versuchte er zu erkennen, an welcher Stelle er gestern so aufgehalten worden war, doch schien dies nicht mehr möglich.
Auf dem westlichen Hof angelangt sah er voraus die Schlange vor der Gebetshalle – wie jeden Morgen, außer gestern – und stellte sich an. Vor ihm stand Man. Sie grüßten sich kurz.
„Die Morgenandacht wird dich aufheitern.“
Doch mehr sprachen sie nicht – wie jeden Morgen.
Die ersten Brüder traten bereits ein und die beiden mussten nicht übermäßig lange warten. Als es so weit war, dass Fahach eintreten konnte, verbeugte er sich vor dem Tor und bat in seinem Geist inbrünstig darum, heute vor weiteren Unglücken gefeit zu sein, ohne daran zu denken, im Ausgleich dafür selber etwas zu versprechen. Danach säuberte er seine Sandalen auf der Matte vor dem Eingang, bevor er die Türschwelle übertrat. Die Anwärter knieten innen bereits in der ersten Reihe. Am Rande erkannte er darunter Unfug und ihm wurde mulmig.
An seinem Platz angelangt, kniete er sich auf den harten Steinboden und beobachtete wie immer das Treiben in der Halle. Alle Brüder und Anwärter waren anwesend, so wie auch die zwölf Oberen. Auf den Tischen vor ihnen einige dampfende Getränke, doch blickten sie noch ernst.
Und genau in dem Augenblick, in dem Fahachs Augen den kleinen brusthohen Tisch auf der Bühnenmitte sahen, fiel das Sonnenlicht durch die Ostfenster auf diesen und der Älteste trat ein. In der Morgensonne erstrahlte er, wie der Sohn der Sonne selbst. An seinem Tisch angelangt, verharrte er, sich mit den Händen darauf abstützend, und sah sich die Versammelten musternd an. Scheinbar zufrieden, fing er an.
„Heute ist der hundertste und zwölfte Tag des Jahres. Nachdem ihr jetzt alle wach seid, kann er beginnen. Die Sonne ist uns heute besonders wohlgesonnen und alles, was ihr heute richtig tut, wird euch doppelt gut getan; doch alles falsche erfährt doppeltes Unglück. Also lasst sie uns preisen.“ – Damit neigten alle kurz ihr Haupt. – „Aber unabhängig davon, ob unsere Herrin heute weiter auf uns herab strahlt oder nicht, werden wir unser Tagwerk verrichten. Mag die restliche Welt auch dem Irrsinn verfallen; wir bleiben eisern. Nun aber zur Verteilung der heutigen Aufgaben.“
Die Aufgabenverteilung bot – wie jeden Tag – keine Überraschungen. Nacheinander ging er die Namen und Aufgaben der Anwesenden durch. Fahach war müde, doch hielt ihn die Aufregung wach, die Angst. Würde er heute anderes hören als sonst – oder war alles nur ein Traum gewesen?
„Fahach“, sprach da der Älteste, „wird heute die aus der Stadt kommenden Waren annehmen. Nach dem Frühstück wirst du dich um den Garten kümmern. Nachmittags wirst du wie immer deine Schüler unterrichten.“
Auch wenn Fahach die Warenannahme nicht gefiel, konnte er nicht umhin, als erleichtert zu sein. Vielleicht würde alles noch gut und gewöhnlich werden.
„Lasst uns jetzt einen Augenblick des Schweigens einlegen und im Lichte unserer Herrin, der Sonne, baden.“ – Diesem gingen sie nach. – „Weiterhin wollte ich euch heute noch erfreuliche Nachrichten beibringen. Seit hunderten von Jahren leben wir nun hier, doch war das Kloster nicht immer so, wie wir es heute kennen. Selbst wir können nicht ewiglich den gleichen Gewohnheiten nachgehen, da sich die Welt draußen verändert, so musste es immer wieder Neuheiten geben, bevor wir zu dem wurden, was wir heute sind. Manche von euch mag dies jetzt erschrecken, doch keine Sorge: Für euch wird sich nichts ändern. Doch kamen wir überein, dass wir auch außerhalb des Klosters, außerhalb der Stadt für uns werden müssen, habt ihr doch sicher gehört, wie mein Aufruf gestern Abend nur wenige erreichte. Da wir einige unter uns haben, die mit dem Klosterleben nicht völlig zurecht kommen, aber trotzdem ein Anrecht darauf haben, zu uns zu gehören, gründen wir eine neue Abteilung: Einige Brüder werden zukünftig durch das Land oder sogar die Welt ziehen. Anregung dazu gaben uns einige Anwärter, die ein eigenes Verständnis von Gewohnheit haben. Sobald sie zu Brüdern vereidigt wurden, werden sie ihre Aufgabe aufnehmen, unter Führung des Mannes, den ihr derzeit als den Anwärter Unfug kennt.“ – Wie es sich gehörte, blieben alle ruhig, obwohl einige sichtbar überrascht waren. – „Und damit sie mit dem Kloster eng verbunden bleiben, ernennen wir auch einen neuen, dreizehnten Posten eines Obersten. Diesen wird Bruder Fahach übernehmen, meinen Glückwunsch. Und nun, lasst uns baden in den Strahlen, welche die Herrin Sonne und sendet.“ Es war doch kein Traum gewesen. „Ihr seid jetzt entlassen. Und gedenkt der Sonne.“
Das war also das Unglück gewesen; nur dass es nicht gestern, sondern erst heute kam.



 Veröffentlicht von kaltric
Veröffentlicht von kaltric