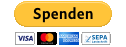Wo bin ich?
Geschichten aus Pervon, Teil IV
Etwas schmerzte. Es dauerte nicht lang, bis er dies seinem Schädel zuordnen konnte. Träge betastete er ihn, doch konnte nichts Außergewöhnliches feststellen. Die Augen zu öffnen fiel ihm schwer; sie schienen verklebt. Auch die Glieder waren bleiern. Letztlich schaffte er es aber an die Decke zu starren; dort boten sich seinem Blick teils lose hängende, teils zernagte Holzbretter. Als sich seine Augen an die kaum vorhandene Helligkeit gewöhnt hatten, wandte er den Kopf, sich noch mehr anzusehen – und bereute es sogleich, als ein scharfer Stich durch seinen Schädel fuhr. Sobald er diesen überwunden hatte, konnte er das Zimmer in Gänze erkennen – oder was davon übrig war. Er erkannte ihn als alter hölzerner Verschlag, dessen Bretter sich stellenweise bereits lösten: Die Einrichtung war karg, die Belichtung spärlich. Ein einsames Fenster schien ungenau zugenagelt, doch ließ sich auch kein Sonnenschein dadurch erkennen. Als Einrichtung boten sich ihm bloß ein heruntergekommener Schrank am Fuße des Bettes sowie eine Waschschüssel daneben.
Er entschied, dass ein Liegen ihm nichts mehr bringen könnte – wo war er hier? – und versuchte aufzustehen. Kaum dass er sich hingesetzt hatte, bereute er diese Entscheidung aber auch schon wieder: Kurz verließen ihn sämtliche Kräfte, derweil sein Blick dunkel wurde. Als es nachgelassen hatte, saß er wacklig auf dem Rand des Bettes – und endlich fiel ihm auch auf, wie unbekleidet er doch war. Dies störte ihn dann schon, war doch auch der Raum sehr kühl; ein kaltes Lüftchen zog durch die Lücken des Bretterfensters. Dieser Luftsog hatte ihn bisher auch behindert den unangenehmen Geruch wahrzunehmen, der ihn an irgendetwas ihm nur schwach bewusstes erinnerte. Als sich dann aber unter der Decke, die dünn auf dem niedrigen Bett lag, etwas bewegte, schreckte er hoch. Er wollte gar nicht wissen, was dort drunter war, oder woher gar dieser Gestank kam.
Noch immer war ihm unbekannt wo er sich befand, doch ging er nun auf die alte Holztür zu, von welcher sich bereits jegliche Farbe löste – und hielt inne. Jemand hatte etwas mit Rot auf die Tür gemalt, genau in Sichthöhe: „Sieh in den Schrank.“
Verwirrt stand er vor der Nachricht – Von wem kam sie? Und was sagte dies über seine Anwesenheit in diesem Raum aus? Die Schrift erkannte er nicht, doch ließ sie ihn eine Weile ausharren, bis er endlich dem Drang nachgab, in den Schrank zu sehen. Es ekelte ihn, die Schranktür zu öffnen; ein unbestimmtes Gefühl versuchte ihm zu vermitteln, was grausiges in diesem großen Behälter lauern könnte, von dem womöglich der abstoßende Geruch des Raumes kommen mochte. Doch er überwand sich und fand – Kleidung. Bloße, nicht sonderlich ungewöhnliche Kleidung: Eine zwar alte doch noch brauchbare braune Stoffhose, ein farbloses, etwas verschmutztes Hemd, eine dünnes schwarzes Jäckchen, Wollsocken und gute eingelaufene Lederstiefel. Nur Unterwäsche musste er vermissen, doch konnte er notfalls auch darauf verzichten, galt ihm nun erstmal die lockende Wärme der Kleidung mehr. Eine kurze Untersuchung ergab keine versteckten Fallen oder Quellen eines verdächtigen Geruchs, so zog er sich eilends an und fühlte sich gleich ein wenig wohler.
Gerade wollte er erneut die Raumtür in Angriff nehmen, da griff er einer Gewohnheit folgend in die Hosentasche, ein Taschentuch suchend, und fand unerwarteterweise ein Stück Papier: „Sieh in die Jackentasche.“
Jemand schien ein Spiel mit ihm zu spielen. Plötzlich fühlte er sich beobachtet, vermochte aber niemanden zu sehen, wenngleich das Fenster genug Möglichkeiten geboten hätte. Misstrauisch ließ er den Zettel fallen und durchsuchte die Taschen. Die Innentasche barg ein gefaltetes Blatt, das er ihr entnahm und betrachtete: ein Brief. Angeschrieben wurde jemand namens Joaris.
„Ich vermisse und denke an dich. Ich freue mich darauf dich an unserem Platz wiederzusehen; unter dem alten Weidenbaum. In Liebe, deine Sasis.“
Sasis – an irgendetwas erinnerte ihn dieser Name. Gedankenverloren faltete er das Blatt wieder, da fiel etwas daraus, das er vorher nicht bemerkt hatte: Die Zeichnung einer Frau – einer schönen Frau – einer Frau, die er oft angesehen hatte: Die Zeichnung seiner Frau: Sasis! Mit einem Ruck lüftete sich ein Schleier in ihm und er verstand, was dieser Brief zu bedeuten hatte.
Es konnte nicht lange her sein, da hatte sie diesen Brief geschrieben. Schnell war er damals zum Treffpunkt geeilt – doch nun war er hier. Wo war hier, was war mittlerweile geschehen – wo war Sasis? Befand sie sich auch hier? War der Brief vielleicht eine Drohung von jemandem, der sie in seinen Klauen hielt? – Irgendeine Bedeutung musste die Anwesenheit des Briefes doch haben.
Da er zunächst aber nichts weiter in diesem Raum zu finden hoffte, entschloss er sich endlich, ihn zu verlassen. Knarrend schwang die Tür ohne Widerstand auf und ein Schwall kalter Luft kam ihm entgegen. Mit einem Mal war er bereits in der freien Natur; scheinbar hatte er sich in einer kleinen Hütte befunden. Es war dämmrig, und da im Zimmer zuvor noch hellere Strahlen durch die Fensterbretter gekommen waren, schloss er, dass dies die Abenddämmerung sein musste, auch wenn es sich erst später bestätigen konnte. Nach einem Schritt hinaus auf die feuchte Erde frierte ihm bereits; wärmen konnte ihn das bisschen Stoff am Körper nur unzureichend. Zitternd trat er jedoch weiter und blickte sich um.
Hinter ihm lag tatsächlich eine billig zusammengezimmerte Holzhütte, doch war diese nur Teil einer größeren Anlage. Voraus erblickte er einen niedrigen Zaun, zur Linken lag ein Gebäude mit großen Toren, wohl eine Scheune oder ein Stall, rechts davon stand ein weiteres Gebäude, das kaum besser gebaut war denn die Hütte, doch wesentlich größer und mehrstöckig. Es schien ihm der Hof eines Bauern oder Viehbesitzers zu sein und nun stand er auf dessen Hauptplatz, den ein kleiner Brunnen zierte. Die Gebäude waren allesamt ruhig und unbeleuchtet, wirkten nicht belebt. Um sich in dieser Welt zurechtzufinden sah er sich zunächst die Gegebenheiten an und fand alles verlassen und alt vor.
Der Brunnen war ausgetrocknet; Schlamm und Unrat versperrten seinen Grund, derweil bereits Moos auf seinen Rändern wuchs. Bei diesem alten verfaulendem Geruch konnte er nur schaudern. Als er auch Haupthaus sowie Stall in einem solchen Zustand vorfand, verzichtete er darauf, diese sich noch genauer anzusehen. Die Tür des Hauses jedenfalls war morsch und modrig und fiel ihm fast entgegen, kaum dass er sie zu öffnen versuchte, und der Geruch von Schimmel und die zahlreichen den Weg versperrenden Überreste ließen ihn von einem Eindringen Abstand halten. Im Stall war es sogar noch schlimmer; ein süßlicher Geruch drehte ihm den Magen um, so dass er diesem Tor schon gänzlich aus dem Weg ging.
Plötzlich aber knarrte etwas hinter ihm, als er sich wieder zurückgewandt hatte. Erschrocken drehte er sich sofort wieder, doch fand nichts – der Stall hatte sich nicht verändert. Er schob es auf seine Nerven, die wegen dieser sonderbaren Umstände und der kalten Einsamkeit angespannt sein mussten. Trotzdem beschloss er langsam rückwärts gehend, den Ort so schnell es möglich war zu verlassen. Es fröstelte ihn, doch bot der Hof nichts, und irgendwoe musste es noch anderes geben. So trat er über den Schlamm und durch die Pforte in die Außenwelt.
„Wann kommen sie denn?“
„Was sagst du?“ Joaris blickte verwirrt auf. Hatte sie mit ihm gesprochen?
„Wann sie kommen – hörst du mir überhaupt zu?“ Unerwartet setzte sie sich vor ihn – und lächelte. „Immer bist du mit deinen Gedanken soweit weg – wann kommst du mal wieder zu mir?“
Wehmütig ergriff er ihre Hände. „Oh – es tut mir leid – du weißt – du – die Arbeit -“
„Ja ja – aber nun mache einmal Pause und sei einfach nur mein Mann, ja?“
„Tut mir leid -“ Dann kam ihm ein Gedanke „- wann sie kommen? Ja – müssten sie nicht gleich da sein?“
„Das frage ich dich ja!“
„Oh!“
„Ach!“ Ihre Geduld schien nun zu Ende. Bevor sie etwas sagen konnte, klopfte es an der Tür. Ihr Gesicht zeigte Entsetzen. „Da sind sie! – Oh! – Und du bist immer noch nicht vorbereitet!“
Um ihren Zorn nicht auf sich zu lenken erhob er sich und eilte gen Schlafzimmer, ihr dabei noch etwas zurufend. „Sag ihnen, ich bin gleich fertig!“
Der Ausdruck ihrer Verärgerung schmerzte ihn.
Die Straße war noch immer schlammig, doch leichter Bodennebel um seine Füße hinderte ihn daran alles zu sehen. Es war ihm nicht bewusst, wie er hierher gekommen war. In einem Moment verließ er den alten leeren Bauernhof, im nächsten stand er mitten in einem Dorf und konnte nichts über den Weg dorthin sagen. Kein Eingangsschild begrüßte ihn – auch keine Einwohner. Der Weg sah aus wie jener vor dem Hof, also konnte er nicht allzu weit gereist sein – auch da es kaum dunkler geworden war – , doch sah er trotzdem hinter sich nur Dunkelheit zwischen kalten Bäumen – und dachte sich nichts dabei.
Es drängte ihn zu erfahren, wo er sich hier befand – und was mit Sasis geschehen war. Eilends folgte er dem Weg, einen möglichen Dorfplatz suchend, von dem er weiter ausgehen konnte. Rechts und links tauchten immer häufiger Häuser auf, die aber mehr der Hütte des Bauernhofes ähnelten denn Stadthäusern und in ungleichen Entfernungen zur Straße errichtet worden waren. Keines schien mehr als ein Stockwerk zu haben und nicht eines wies Anzeichen von Leben, lediglich Verfall auf. Wo also waren die Einwohner? War er hier in eine Geisterstadt, einen verlassenen Ort geraten? Wenn ja – wie und warum.
Die Fragen aber verblassten, als er das Gefühl bekam beobachtet zu werden. Schon auf dem Hof hatte er es gehabt – etwas flüsterte ihm zu, wie Augen aus der Dunkelheit seine Schritte beschatteten. Zunächst unauffällig, dann sichtbarer versuchte er seine Umgebung danach abzusuchen, doch gab es Tausende von Möglichkeiten für jemanden, sich hier zu verstecken. Hinter den Fenstern der Häuser, sofern nicht verhangen, starrte ihm Düsternis entgegen und im stärker werdenden Zwielicht hätte sich problemlos jeder zwischen Häusern, hinter Büschen und verlassenen Fahrzeugen, gar draußen in diesem unscharf erscheinendem Wald verbergen können.
Schaudernd ging er weiter – und erreichte eine Kreuzung, die mittig des Ortes zu liegen schien. Von ihm unbemerkt waren die Häuser enger an die Straße gerückt und hatten sich gen Himmel gereckt. Genau an der Kreuzung waren sie schon fast beeindruckend und eines davon lockte besonders. Die Schrift an der Vorderseite konnte er nicht entziffern; sie verschwamm vor seinen Augen, doch erkannte er hinter den Vorhängen des Erdgeschosses warmen Feuerschein und Essensgeruch wies ihm den Weg durch die Vordertür hinein.
„Ah, da bist du endlich – wie war es?“
Verwirrt sah er sie an. „Was?“
„Na sag schon, hast du es bekommen?“
Er blickte zunächst ihr freudig aufgeregtes Gesicht, dann seine leeren Hände an – und wagte nicht, ihr ein zweites Mal ins Gesicht zu sehen.
„Was? – Hast du? – He – warum gehst du?“ Sofort eilte sie ihm nach, ihre Stimme schärfer werden lassend. „Du hast es nicht bekommen, oder? Warum nicht? Es war doch so einfach! So einfach, was du tun solltest – und du hast es nicht geschafft! – Warum verlass ich mich überhaupt noch auf dich?“
Er wollte den Streit nicht, doch sie scheinbar – zornig wandte er sich um. „Wenn es so einfach ist, dann geh‘ doch selber!“
Kurz sah sie ihn sprachlos an, bis sie letztlich ihre Stimme wiederfand. „Das werde ich auch!“ Und mit einem Mal rauschte sie aus dem Zimmer, die Tür laut hinter sich zuschlagend.
Er aber wandte sich seinem Mahl zu.
Ein Geschmack von Verwesung kam ihm auf die Zunge und der Geruch von Schimmel und faulendem Holz stieg ihm in die Nase. Die Luft war feucht und modrig, der Boden bedeckt von Unrat, Moos und Schlamm. Dinge, die er nicht genau erkennen konnte – und wollte – hingen von der Decke und ganz allgemein war das Gebäude in keinem Zustand, den er für lebenswert halten würde. Immer wieder trat er auf weiche Gebilde, die unter seinen Schuhen leicht nachgaben und ihm dadurch Schauder über den Rücken jagten. Statt Essensgeruch erwartete ihn nun dieser faulende Gestank; statt wärmendem Feuerschein war da nur die beklemmende Feuchte.
Eigentlich wusste er nicht, wonach er hier suchte, doch hatte er das dringliche Gefühl, es tun zu müssen. Vorsichtig öffnete er die Tür, die von dem dem Gang in welchem er sich befand zu einem Raum führte, den er erkunden wollte – und hielt erschrocken an, als er am anderen Ende etwas rascheln hörte; wie Laub unter Schritten. Da jedoch nichts weiter geschah, wagte er sich hinein, über zerbrochene Möbel, vorbei an aufquellendem Holz und über unendliche Scharen von Ungeziefer hinweg. An der Stelle angekommen, wo es geraschelt hatte, sah er nichts Besonderes – doch, einen Haufen Zettel. Neugierig kniete er nieder. Anfassen wollte er sie sicherlich nicht, waren sie doch auf den ersten Blick sichtbar nicht mehr in dem Zustand wie einst. Scheinbar boten sich ihm dort alte Nachrichten.
„Seltsame Höhlen in den Bergwerken von Roggis gefunden.“
Roggis – ein Ortsname – wieder kam ihm etwas entfernt vertraut vor. Wo hatte er das schon mal gehört?
„Die Bergwerke von Roggis liefern kein Gold mehr.“
„Zahllose Siedler verlassen Roggis.“
„Das Land will Roggis keine Unterstützung gewähren.“
So und so ähnlich klangen viele der Überschriften, die er da las. Was auch immer dieses Roggis war, es schien ihm nicht gut zu gehen.
„Schlimmer Unfall in den Bergwerken von Roggis! Zahllose verschüttet.“
„Frau des Bürgermeisters von Roggis verschwunden. Vermutung, dass sie die Höhlen der Bergwerke erkundete.“
Soweit er es überblicken konnte, schienen alle Nachrichten von diesem Roggis zu handeln. Die Schlussfolgerung lag also nahe, dass er sich in dem Ort dieses Namens befinden musste – sofern nicht ein von einem anderen Dorf Hergezogener diese gesammelt hätte.
„Roggis wird keinen Schutz im Krieg bekommen.“
Damit endeten die neuesten Nachrichten, soweit er das feststellen konnte. Die Umgebung da draußen sah aber nicht gerade zerstört aus, nur verlassen und – tot.
Er wusste nicht, wieso, doch mit einem Mal vermochte er zu sagen, dass er beobachtet wurde. Aus dem Augenwinkel sah er noch, wie draußen auf der Straße sich etwas bewegte – und dann war es ruhig. Sofort verließ er den Raum und folgte dem Flur; stürzte auf die Straße hinaus.
„Ist es hier nicht wunderschön?“
Verwirrt unterbrach er seine Frau und blickte auf. „Oh – äh – was?“
Sofort verdüsterte sich ihr Blick. „Du hast nicht wirklich deine Arbeit mit genommen, oder? – Wir wollten hier allein und in Ruhe sein!“
Als wollte er sie schützen, hielt er die Unterlagen vor sich.
„Das ist wichtig – für uns alle – wenn wir das nicht in den Griff bekommen – könnte es für alle zu spät sein.“
Plötzlich warf sie etwas nach ihm, dass sie vom Boden aufgehoben hatte. „Wenn du nicht bald etwas anderes in den Griff bekommst, wird es für uns auch zu spät sein!“
„Ach! – Jetzt spiel dich bitte nicht wieder so auf.“ Er sprach ruhig, doch gereizt. Momentan hatte er wirklich keine Lust auf sowas.
Sie aber wurde rot vor Wut. „Ich und mich aufspielen? Oh! Dir werde ich es zeigen!“
Sie konnte sich wirklich immer wieder so schrecklich aufregen, was auch ihn letztlich nicht mehr halten lassen konnte.
Noch aber versuchte er sich zusammenzureißen. „Beruhige dich! – Warum kannst du nie vernünftig mit mir reden; warum musst du immer gleich schreien?“
„Wer schreit denn hier!“ Ihre Stimme wurde schriller.
Nun hatte er keine Geduld mehr. Zitternd versuchte er sich noch zu beherrschen.
Sie bemerkte nichts; steigerte sich in ihre eigene Rage. „Ah!- Warum nur habe ich mich je darauf eingelassen? Du bist doch so ein Versager! Du hättest das nicht mitnehmen müssen, da du eh versagen wirst!“
Nun reichte es. Seine Hand unterstand nicht mehr seinem Willen. Plötzlich und ohne Vorwarnung schlug er sie. Erst als sie vor Schmerz zurückzuckte um sich dann zusammenzukrümmen und anfing zu weinen, bemerkte er seine Tat.
Sofort tat es ihm leid. „Das wollte ich nicht…“
Doch sie ließ sich nicht trösten. Und so wurde ihr Schmerz auch der seine.
Sich in einer dunklen Seitenstraße unter einem bewölkten Nachthimmel wiederfindend, fragte er sich kurz, wie er da hingekommen war. Er erinnerte sich noch, die Tür eines Hauses aufgerissen zu haben, dann – wurde es hell – und im nächsten Augenblick stand er hier. Er glaubte, dass dies schon mehrmals erlebt zu haben – warum? – da hörte er ein Quietschen am Ende der Gasse. Sofort lief er los in Richtung des Geräusches, dabei Müll und Schutt ausweichend, deren Gestank ihn sonst hätte ohnmächtig werden lassen, und fand eine schmale Hintertür in das Gebäude links von ihm führend.
Knarrend und quietschend schwang diese hin und her, bewegt von der durch die Gasse ziehenden Luft. Fast schon enttäuscht hielt er ein, hörte sein hämmerndes Herz und entspannte sich wieder. Welch eine schreckliche Nacht dies doch war – da fiel im Inneren des Hauses etwas lautscheppernd zu Boden. Sein Herz machte einen Sprung und so tat auch er. Sich kaum entscheiden könnend zwischen der Furcht, die dieser Ort ihm einjagte, einer Neugier mehr wissen zu wollen und dem Verlangen, ein Lebewesen an diesem Ort zu finden – gewannen die letzten beiden.
Vorsichtig öffnete er die Tür und ließ sie dabei vermutlich mehr quietschen, als wenn er sie aufgerissen hätte. Drinnen durchsuchte er jeden der Räume, die allesamt seit Jahren verrottend sich ihm darboten; ähnlich allem anderen, das er bisher gesehen hatte: Möbel und andere Einrichtung waren kaum noch erkennbar; entweder aus Gründen der Jahre oder weil irgendwer – oder irgendwas – sie einst zerstört haben muss. Doch dann entdeckte er die Treppe in den Keller, einen großen Raum, der aber beheizt und hellerleuchtet von einem Ofenfeuer war – und an jeder Wand hingen Zeichnungen und Briefe – allesamt von Sasis, wie er sofort erkannte.
Sasis! Wie hatte er sie seit dem Bauernhof vergessen können? Und wichtiger: Was sollte dieser Raum? Entsetzt sah er sich die Bilder an, wie sie Sasis in allen möglichen und unmöglichen Lebenslagen zeigten, sowie in allen Altern, vom Kind bis – zum Tod. Schrecklicherweise bot sich ihm dieses Bild als Abbild ihrer verunstalteten Leiche, die davon abgesehen aber noch aussah, wie er sie gekannt hatte. Wer wollte ihm so etwas antun, zu behaupten, sie sei derart abscheulich gestorben? Würde er diesen jemand finden, seine Gnade wäre nicht vorhanden. Weiterhin: Wer schon grundsätzlich wohl hatte Interesse, auch bloß seine Frau zu beobachten, wie er es hier getan haben muss? Oder waren alle Zeichnungen Fälschungen?
Die Briefe erkannte er als alte Zeugnisse vergangener Tage, an denen sie noch frisch verliebt sich gegenseitig geschrieben hatten. Einige, deren Absendezeiten jünger waren als die der anderen – aber was wusste er schon über das Jahr, wenn er nicht mal wusste wo er war? – zeigten ihm aber auch hier Böses. Der Ton der Briefe wurde teils zornig, als stammten sie aus einer Trennung, die sie aber nie gehabt hatten. Zunächst waren die Zeilen wütend, dann traurig und später wurden sie versöhnlich bis hin zu wieder liebend klagend. Die Schrift war die ihre; es konnte sie unmöglich jemand gefälscht haben – doch erinnerte er sich nicht an sie.
Grübelnd und nachsinnend ließ er vom Lesen und Betrachten ab um sich dem Fenster zur Straße hin zuzuwenden, damit die Dunkelheit der Pfade seinen Geist klären könnte bis er Platz für Neues hätte. Doch kaum dass er hinausblickte, sah er eine düstere Gestalt, die etwa von der Tür des Hauses in dem er sich befand die nächtlichen Straßen überschritt um zwischen anderen Häusern wieder zu verschwinden. Aufgeschreckt und angetrieben von einem rasenden Herz versuchte er dieser Gestalt zu folgen. Er rannte aus dem Zimmer, einen Flur voll Gesteins entlang und riss die Tür zur Straße auf.
„Warum rennst du so?“ Er war außer Atem, doch sie lief immer weiter über die Wiese.
„Jetzt komm doch!“ Bald hatte sie den Baum erreicht und wartete auf ihn alten Mann, der keuchend hinterherkam.
„Willst du mich etwa umbringen?“
„Na, ich glaube, da würde ich dann andere Wege wählen.“ Lachend setzte sie sich auf das Moos am Stamm.
„So? – Und welche wohl?“ Vorsichtig wählte er den Platz neben ihr.
„Als würde ich dir das verraten.“
Schweigend blickte sie dann den Hang hinab, von wo aus die Berge langsam begannen. „Wann wirst du endlich mit mir in die Berge reisen? – Sie sind so nah – und doch so fern.“
„Sie sind gefährlich – und wegen ihnen habe ich zuviel zu tun.“
Verärgert zog sie die Augenbrauen zusammen. „Fängst du schon wieder von deiner Arbeit an?“
Er war verletzt. „Warum – warum musst du meine Worte immer so verdrehen? Was bringt es dir?“
Sie schnappte sichtbar nach Luft. „Oh ja! Das würde dir ähnlich sehen: mich jetzt als Böse hinstellen.“
Sein Gesicht zeigte Verzweiflung. „Warum wirst du nur wieder so?“
Ohne ein weiteres Wort aber stand sie auf und ging in Richtung der Berge.
„Was tust du da?“
Doch sie antwortete nicht auf seine Rufe. Hastig erhob er sich und lief ihr nach, bis doch noch etwas von ihr kam.
„Lass mich in Ruhe!“
Und das tat er dann; beobachtete, wie sie weiter auf die Berge zuging.
Nach etwa einer Stunde verzweifelten Überlegens beschloss er, doch zu folgen. Er sollte sie in den alten, der Gefährlichkeit wegen stillgelegten Bergwerke finden.
Sie erwartete ihn bereits. „Eigentlich hatte ich es noch einmal mit dir versuchen wollen. Doch nun – kann ich es dir auch sagen: Ich halte es nicht mehr aus. Deine Arbeit war dir stets wichtiger als ich es bin. Andere Männer aber sehen mich noch und wissen wir man mit umzugehen hat – Ich verlasse dich.“
Er war nahezu sprachlos. „Wer…?“
„Ist das noch wichtig?“
„Sag!“
„Das ist also wirklich alles?“ Sie wirkte enttäuscht. „Du arbeitest seit Jahren mit ihm zusammen.“
„Was – ? Wie konntest du – ?“ Wut überlagerte den Schmerz.
„Ja – und er gibt mir mehr als du.“
„Du – !“ Zornentbrannt stürzte er sich auf sie; legte seine Hände um ihren Hals.
Nebel wallte um seine Füße, während er über den Acker schritt. Rechts und Links säumten Gräber seinen Weg, dass es ihn schauderte. Nichts hier an diesem Ort lebte und seine Toten wollte er nicht wandeln sehen. Voraus erkannte er bloß Dunkelheit und selbst über ihm war nur Schwärze. Unsicher stapfte er durch die Reihen der Erinnerungssteine. Einmal sah er sich um, doch erkannte nicht mehr als beim Blick voraus. Hin und wieder sah er aus den Augenwinkeln kleine Gebäude, wohl große Gräber, doch so oft er versuchte sich einem zu nähern, schien es ihm, als würden sie weiter verschwinden.
Sich fragend wo er hier war und wie er wieder wegkäme, sah er plötzlich eine dunkle Gestalt in der Ferne vor sich, die er glaubte schon einmal gesehen zu haben. Er rief sie an und bemerkte jetzt das erste Mal, keine Stimme zu haben. Er wedelte mit den Armen, doch die Gestalt schien ihn nicht zu bemerken. Er lief auf sie zu, doch so sehr er sich auch bemühte; er näherte sich ihr nicht, blieb immer an der gleichen Stelle. Und noch während er so verzweifelt und sinnlos dahin lief, hob die Gestalt ihre Haube an.
Verzweifelt sank er auf die Knie, während die Welt um ihn verschwand und nur Dunkelheit übrig ließ.
„Oh, es tut mir so leid! Schluchzend beugte er sich über Sasis, nahm sie in den Arm, strich ihr das Haar aus dem Gesicht. „Wie konnte es bloß jemals so weit kommen? Ich liebe dich doch viel zu sehr… – Wie könnte ich ohne dich leben?“
Er schwor sich, sie niemals zu vergessen. Doch unmöglich konnte er so wieder heim nach Roggis kehren; er kannte die Strafe. Dringend musste er sich etwas einfallen lassen; dann würde man ihn niemals wieder in Roggis erblicken.
Zeit seines Lebens erfuhr niemand die Wahrheit. Und er – er wurde glücklich ohne sie und ihre Launen.
Nachdem sie ihre Haube gelüftet hatte, sprach Sasis zu ihm. „Ja, du hast mich umgebracht und nun sind wir beide hier. Statt mich zu ehren oder dich zu entschuldigen, bist du damals feige geflüchtet. Du behauptetest immer mich zu lieben aber machtest mir das Leben zum Leid. Endlose Schrecken wünschte ich mir für dich. Im Leben konnte ich sie dir nicht bescheren für das, was du mir angetan hattest, doch nun, da du selber auch tot bist, darf ich dich endlich strafen. Lange habe ich gewartet; ewig wirst du nun leiden. Niemals wieder wirst du schöne Augenblicke kennen, dafür wird mein Hass sorgen. Sei gefangen hier in deinem Alptraum für den Rest deiner Ewigkeit!“
ENDE



 Veröffentlicht von kaltric
Veröffentlicht von kaltric