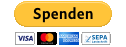Abstract
Diese Arbeit betrachtet die Wortarten des Akkadischen anhand einiger ausgewählter aktueller Theorien zum Thema Wortarten. Nach einer Einführung in das Akkadische basierend auf den wichtigsten Grammatiken werden diese Theorien vorgestellt und danach auf das Akkadische anhand von Daten angewandt. Das Ergebnis bestätigt die Grammatiken teils in ihrer Einteilung, kann einige Theorien unterstützen und bei anderen Schwächen aufzeigen.
1. Einleitung 4
2. Das Akkadische 8
2.1. Allgemeines 8
2.2. Überblick zur Sprache 9
2.3. Phonologie 11
2.4. Morphologie 13
2.4.1. Pronomina 15
2.4.2. Nomina 16
2.4.3. Verba 19
2.4.4. Partikel (Präpositionen, Adverbien und der Rest) 25
2.5. Syntax 27
3. Die theoretischen Grundlagen und Modelle 31
3.1. Mögliche Klassen nach Schachter & Shopen 31
3.1.1. Die offenen Klassen 33
3.1.2. Die geschlossenen Klassen 35
3.1.3. Fazit 36
3.2. Hengeveld: Klare Kategorien und flexible Sprachen. 36
3.2.1. Sprachtypen: rigide und flexibel 36
3.2.2. Syntaktische Slots 37
3.3. Croft: Wortklassen sind universal nach Semantik geordnet 39
3.3.1. Crofts Kritik 39
3.3.2. Crofts universale Theorie: RCG 40
3.3.3. Semantische Klassen: Prototypen 41
3.3.4. Fazit 42
3.4. Sasse: Gegen universale Kategorien 42
3.4.1. Sasses Theorie zur N/V-Distinktion. 43
3.4.2. Fallstudie Cayuga: Wurzeln statt kanonische Formen. 46
3.4.3. Partizipien 47
3.5. Luuk: Nur flexible Wortklassen? 48
3.6. Fazit 51
4. Die Wortarten des Akkadischen 54
4.1. Schachter & Shopen: Die klassischen akkadischen Wortarten. 54
4.1.1. Die offenen Klassen 55
4.1.2. Die geschlossenen Klassen 64
4.1.3. Fazit 72
4.2. Hengeveld: flexibel oder nicht? 73
4.2.1. Die Wortklassen 74
4.2.2. Die Einordnung ins System 78
4.2.3. Fazit 79
4.3. Croft: prototypisch und nicht-prototypisch 80
4.3.1. Die unmarkierten Wortklassen 80
4.3.2. Die markierten Wortklassen 81
4.3.3. Die semantischen Prototypen 83
4.3.4. Fazit 86
4.4. Sasse: Untersuchung auf allen Ebenen 88
4.4.1. Formale Untersuchung 88
4.4.2. Syntaktische Untersuchung 90
4.4.3. Morpholexikalische Untersuchung 91
4.4.4. Ontologische Untersuchung 93
4.4.5. Diskurstechnische Ergebnisse 95
4.4.6. Fazit 96
4.5. Luuk: flexibel oder nicht? 100
4.5.1. Verben 100
4.5.2. Substantive 103
4.5.3. Flexible 105
4.5.4. Der Sprachtyp 107
5. Fazit 108
6. Referenzen 112
7. Abkürzungsverzeichnis 114
8. Tabellenverzeichnis 115
Einverständniserklärung 116
Versicherung 116
1. Einleitung
In den letzten Jahren gab es verstärkt Überlegungen, welche die klassische Einteilungen von Wortarten in Sprachen in Frage stellen. Sie berufen sich darauf, dass diese Einteilungen auf traditionelle Begriffe zurückgehen, die sich a) an den klassischen Grammatiksprachen wie Latein orientieren und b) auf teils unsinnige Definitionen basieren1. Andere meinen gar, dass Einteilungen in Wortarten nicht vorhanden oder zu strikt sind, wollen nur oder gar nicht sprachspezifisch gliedern und bezweifeln teilweise das universelle Vorhandensein einiger Klassen.
Die traditionelle Einteilung spricht von vier Hauptklassen von Wortarten. Substantive (N2) haben die Funktion der Referenz, Verben (V) die der Prädikation, Adjektive (ADJ) und Adverbien (ADV) die der Modifikation. Weiter nimmt man für jede Klasse Kriterien an, anhand derer man sie einteilen kann. Meist ist das Hauptkriterium entweder semantisch (Substantive beschreiben ‚Dinge‘, Verben ‚Handlungen‘) oder morphologisch (Substantive tragen Kasus, Numerus, Genus; Verben dagegen Tempus-Aspekt-Modus (TAM) und Person) oder syntaktisch (Substantive stehen mit Artikeln, Adjektiven oder Genitivattributen oder in bestimmten Wortstellungen).
Schnell stellen sich dabei Probleme ein. Im Deutschen z.B. wird Prädikation durch Verben ausgedrückt, wie in: Die Frau kocht. Ist das Prädikat jedoch kein Verb (Nominalsätze), so muss in den Satz eine Kopula eingesetzt werden, die dessen Funktionen übernimmt: Du bist Koch. Viele Sprachen brauchen das aber nicht. In einigen Sprachen gibt es etwas ähnliches wie die Kopula, das jedoch nicht vom Verb abstammt. Wiederum findet man in etlichen Sprachen die Kriterien, die man eigentlich klassisch für bestimmte Wortarten definierte, plötzlich an ganz anderen Wortarten, z.B. wenn der Possessiv (POSS) auch am Verb steht. Diese Sprachen benutzen dann vielleicht auch gar nicht diese Kriterien um überhaupt Wortarten zu definieren, sondern vielmehr syntaktische Kriterien, z.B. Juxtaposition statt einer Kopula oder eine bestimmte Prädikatsstellung, in der jedes Lexem Prädikat wird. Dann erfährt man aus der Form wenig oder nichts über die Funktion und würde auf gar keine oder falsche Wortarten schließen. Somit reichen die traditionellen Definitionen allein nicht aus.
Das Akkadische ist eine ausgestorbene semitische Sprache Mesopotamiens, das von der Altorientalistik3 untersucht wird und seit Ende des 18. Jahrhunderts bekannt und seit Mitte des 19. Jahrhunderts verständlich ist (vgl. Edzard 2004). Die Sprache ist in Form von etlichen Texten erhalten und zugänglich, wobei viele noch nicht übersetzt sind. Die Grammatik des Akkadischen ist soweit gänzlich erschlossen, lediglich einige (theoretisch mögliche) Paradigmenformen sind nicht belegt und über einige Besonderheiten wird gestritten. Als semitische Sprache weist es einige charakteristische Besonderheiten auf, vor allem die enge Verbindung der meisten Wortklassen miteinander aufgrund von Wortwurzeln, die abstrakte Bedeutungen tragen und je nach morphologischer Form einer anderen Klasse angehören. Damit stellt das Akkadische für einige Theorien über Wortarten ein Problem dar, für andere dagegen ein passables Beispiel.
Seit 1952 ist der „Grundriss der akkadischen Grammatik“ Standardwerk des Akkadischen und andere altorientalische Forschungen konzentrieren sich vor allem auf einzelne Texte und Übersetzungen oder Details von Schrift und grammatische Besonderheiten oder einzelne Dialekten. Eine wirkliche Untersuchung die Wortarten betreffend liegt nicht vor und selbst der Grundriss geht nur sehr knapp auf dieses Thema ein. Lediglich zum Stativ gab es eine gewisse Diskussion, ausgelöst von Buccatelli (1968); doch befand sich diese weiterhin im semitistischen Rahmen.
Sofort sollte man sich fragen, ob die Einteilung der Wortarten in der Altorientalistik (bzw. im Grundriss) überhaupt ihre Rechtfertigung hat, da dort zur Einteilung nur einfachste Kriterien genutzt wurden4 und der Forschungsstand zudem etwas überholt ist. Gleichzeitig muss man sich bei der Lektüre der Literatur betreffend Wortarten ebenso fragen, inwieweit diese Berechtigung haben und korrekte Aussagen treffen.
Ziel dieser Arbeit ist daher die Untersuchung des Akkadischen anhand einiger ausgewählter typologischer Wortarten-Theorien und gleichzeitig umgekehrt die Überprüfung dieser Theorien anhand des Akkadischen. Die Hypothesen sind dabei recht einfach: Einerseits wird das Akkadische für einige Theorien sicher Probleme bringen, andererseits wird die klassische Einteilung der Wortarten des Akkadischen sicher nicht völlig gerechtfertigt und zumindest überdenkenswert sein.
Hierfür wird zunächst das Akkadische kurz vorgestellt, mit seinen traditionell angenommenen Wortklassen und Besonderheiten. Danach folgen ebenso knapp die ausgewählten Theorien zu Wortarten. Diese beiden Abschnitte wären in der Reihenfolge an sich auch austauschbar. Zusammen bilden sie aber die Grundlage. Als Drittes wende ich die Theorien auf das Akkadische an, um zu sehen, wie sie sich schlagen und welche Ergebnisse sich finden. Schließlich folgen die Auswertung und ein Fazit, besonders bezogen auf die aufgestellten Hypothesen.
In den ersten zwei Kapiteln werden auch die wichtigsten Begriffe um Akkadisch und die Wortartenforschung erläutert werden.
Die „Kurzgrammatik“ des Akkadischen orientiert sich vor allem an Wolfram von Sodens „Grundriss der akkadischen Grammatik“ (= GAG, ursprünglich erschienen 1952), welches 1995 in seiner 3. Auflage erschien, die aber gegenüber der 1. im Text weiterhin unverändert ist und lediglich zusätzliche Korrekturen und Anmerkungen enthält. Insofern ist sie ein wenig überholt, doch liegt noch kein vergleichbares Werk vor, das nicht nur die Grammatik in Kurzfassung vorstellt, sondern derart detailliert, auch mit Belegen und Beispielen, selbst auf alle bekannten Sonderformen der akkadischen Grammatik und dialektale Unterschiede eingeht.
Zur Ergänzung wurde Artur Ungnads „Grammatik des Akkadischen“ (ursprünglich 1906) herangezogen, die vor dem GAG Standardwerk und insofern dessen Grundlage war und in der Überarbeitung durch L. Matouš, die wiederum stark aus dem GAG leiht, seit 1979 in der 5. Auflage vorliegt. Da es seit der Überarbeitung aber fast nur eine Kurzform des GAG ist, findet sich dort nur wenig Neues. Weiter dient als Ergänzung das Lehrbuch „Introduction to Akkadian“ von Richard Caplice in der 4. Auflage von 2002, welches aber ebenso wiederum auf den GAG zurückgeht.
Grammatiken, die vor Ungnad erschienen oder sich nur einem speziellen Dialekt widmen, sind entweder zu alt und damit fast grundsätzlich überholt oder sonstwie unzureichend für diese Vorstellung, besonders wenn es um einen anderen Dialekt geht5. Zur Ergänzung der Einleitung und des allgemeinen Teils verweise ich auf Edzard (2004) und bei der Phonologie auf Streck (2005). Davon abgesehen entstammen die meisten Informationen schlussendlich zwangsweise dem GAG. Dies ist ein weiterer Hinweis, dass ein neues Standardwerk vielleicht vonnöten wäre, welches auch andere Positionen zu vertreten vermag als der GAG. Neuere Erkenntnisse finden sich (abgesehen von verstreuten Zeitschriftenartikeln) nur im Unterricht der Altorientalistik selber. Interessanterweise betrifft das aber wieder nur Details und man wird auf den GAG für mehr Informationen verwiesen.
Letztlich eine Vorbemerkung: In den folgenden, im Original englischsprachigen Texten und Artikeln der Autoren, auf denen Abschnitt 3 beruht, ist stets von ’nouns‘ die Rede. Übersetzt kann dieser Begriff sowohl Substantiv als auch Nomen bedeuten. Letzteres hat den großen Nachteil, dass es ebenfalls ambig ist und Substantive oder Nomina6 bezeichnen kann. Da die übliche Auffassung des Begriffes ’noun‘ aber besagt, dass er korreliert mit dem deutschen ‚Substantiv‘, wird hier diese Übersetzung gewählt. Welchen Begriff ein Autor nun genau meint, kann man nur aus dessen Text erschließen.
Der Begriff ‚Nomen‘ soll hier ganz vermieden werden aufgrund seiner Ungenauigkeit. Stattdessen wird von Substantiven und Nomina die Rede sein.
2. Das Akkadische
2.1. Allgemeines
Es wird sich hier in Aufbau und Reihenfolge größtenteils an die Vorbilder GAG und Ungnad und anderer Grammatiken gehalten. Auf Allgemeines zur Sprache folgen die Bereiche Phonologie, Morphologie und Syntax.
Akkadisch (akk.: lišānum akkadītum7; akkadische Zunge) ist eine ausgestorbene semitische, also afroasiatische Sprache, die sich jedoch in etlichen Details grammatisch, teils auch lexikalisch, von den anderen semitischen Sprachen unterscheidet, da sie vor allem durch das Sumerische stark beeinflusst wurde, besonders in der Wortstellung: SOV statt flexibel. Andere Besonderheiten sind die lokalen und dativisch-allativischen Präpositionen und ein verringerter Lautbestand, vor allem im Bereich der Pharyngalen8, so der GAG.
Als semitische Sprache hat das Akkadische eine ausgeprägte Wurzelmorphologie, bei der veränderte Vokale und Konsonanten sowie Affixe in mehreren Stämmen (die wiederum Modi und Aktionsarten ausdrücken) die Bedeutung einer Form verändern; viele eindeutig semitische Lexeme, einen Teilbereich des semitischen Lautbestandes, die drei Kasus Nominativ, Akkusativ und Genitiv; besondere ‚Stati‘ der Substantive sowie unabhängige und mit Eigenheiten versehene Pronomina. Die Semantik hängt an einer festen Folge von 3, seltener 2 oder 4 Radikalen – den Wurzelkonsonanten – sowie den Vokalschemata – besonders auch dem meist festen Wurzelvokal – und der Morphologie. Durch ihren Flektierungsreichtum haben die semitischen Sprachen kaum Notwendigkeit Komposita zu benutzen, kennen aber die Möglichkeit zwei oder mehr Wörter durch den Genitiv, im Sinne einer possessiven Konstruktion, zu verbinden, was auch den Sinn eines Kompositums wiedergeben kann.
In der Semitistik ist es für eine Sprache aufgrund der Wurzelmorphologie allgemein üblich, ein Paradigmenwort auszuwählen, um exemplarisch die verschiedenen möglichen Formen daran darzustellen. Im Akkadischen nahm man hierzu parāsum ‚trennen‘ für alle verbalen (und teils nominalen) Formen – und verschiedene andere für die speziellen Unterklassen der Verben. Die Radikale werden bei diesen Paradigmenwörtern groß und Affixe und Vokale klein geschrieben, um die verschiedenen Formänderungen anschaubar darzustellen: iPRuS ‚er trennte‘ bzw. als abstrakte Paradigmenform für das Präsens: iPRvS, wobei v für den entsprechenden Wurzelvokal steht.
Akkadisch kennt zahlreiche Dialekte, deren zwei wichtigsten nach den beiden großen antiken Reichen der babylonische und der assyrische9 genannt werden. Das Altbabylonische (OB ‚Old-Babylonian‘ oder aB ‚alt-Babylonisch‘10) gilt hierbei als vergleichsweise klassische Sprache, die am einheitlichsten war und in der auch die meisten Texte vorliegen, weshalb a) die meisten Grammatiken und b) auch diese Arbeit auf diesem Dialekt basiert. Vor allem das Assyrische unterscheidet sich durch Archaismen und Innovationen, wie der Vokalharmonie und teils anderer Lexeme vom Babylonischen, aber auch die babylonischen Dialekte untereinander differenzieren teils zu stark11.
2.2. Überblick zur Sprache
Akkadisch ist neben dem Altägyptischen die älteste bekannte afroasiatische und einzige älteste bekannte semitische Sprache12. Aufgrund ihrer Besonderheiten, u.a. auch einen Dativ, den es nur bei den Pronomina und in anderen semitischen Sprachen nicht gibt, bildet sie innerhalb der semitischen Sprachen einen eigenen Zweig, das Ostsemitische, zu dem Eblaitisch und die Dialekte des Akkadischen gehören. Diese Dialekte unterteilen sich wiederum in die von Mari, Babylonien und Assyrien13.
Gesprochen wurde das Akkadische etwa von 2500 vor Christi bis um das Jahr 0; wobei es bis zur Ankunft Alexanders in Mesopotamien schon durch das Aramäische als Umgangssprache verdrängt worden war. Das Altakkadische (aAkk), das entweder Vorgänger der anderen Dialekte oder ein früh ausgestorbener Dialekt war, hielt sich von etwa 2500 – 1950 v. Chr., danach spaltete es sich in Babylonisch und Assyrisch. Das Altbabylonische wurde etwa bis 1530 v. Chr. gesprochen und ist der am besten bezeugte Dialekt; andere Dialekte sind hier irrelevant14. Besonders unter dem König Hammurapi15, der mit seiner Gesetzesstele einen der bekanntesten Texte des Akkadischen schuf, wurde gewissermaßen eine ‚klassische‘ Sprache geschaffen, die auch strikt alle hier vorgestellten ‚Regeln‘ der Grammatik einhielt.
Zu allen Zeiten unterschied sich die poetische Sprache teils stark von der prosaischen. Erstere hatte zahlreiche Archaismen und viele Freiheiten wie z.B. flexible Wortstellung; zweitere reflektiert vermutlich am ehesten die Umgangssprache und kann auch deren Begriffe enthalten16. Die Differenz ging später soweit, dass man zwischen normalen Dialekten und einer zeitgleichen Literatursprache, dem Jungbabylonischen (jB) unterschied, das in beiden Reichen geschrieben und verstanden wurde.
Geschrieben wurde das Akkadische in der sogenannten Keilschrift, welche die Akkader von ihren früheren Nachbarn, den Sumerern, übernommen hatten. Diese schufen sie um 3000 vor Christi als Bilderschrift. Aus den Lautwerten der Wörter, die im Sumerischen ein- oder zweisilbig waren, entstanden später Silbenwerte für die Zeichen. Da manchmal ein Zeichen für mehrere Wörter steht, entstanden so teils auch mehrere Lautwerte für ein Zeichen. Gab es Schwierigkeiten, wie ein Wort zu lesen war, wurde dies durch Determinative gelöst. Da das Schreibmaterial für gewöhnlich Ton war und man auf diesem leicht mit dreieckigen Griffeln die Zeichen eindrücken konnten, wurden aus den Bildern Keile – die Keilschrift. Als die Akkader anfingen auch in Keilschrift zu schreiben, erweiterten auch sie die Schrift. Alte sumerische Wörter wurden als Logogramme übernommen, die für teilweise mehrere akkadische Wörter stehen konnten. Aus einigen Lautgebilden der akkadischen Wörter, vor allem aus einsilbigen, wurden weitere Silbenwerte für die Zeichen. So gab es einen großen Mix von Logogrammen, Determinativen und vielen Silbenwerten. Jedoch nutzte nicht jeder Dialekt, jeder Schreiber oder jede Textgattung auch sämtliche Möglichkeiten, sondern nur eine beschränkte Anzahl von Zeichen.
In der Moderne fertigt man von einem Keilschrifttext zunächst eine syllabische Umschrift an, die Transkription. Gibt es für einen Silbenwert mehrere Zeichen, nummeriert man sie der Reihe nach: a, á, à, a4, a5, usw. Danach wird die Transkription in zusammenhängende Wörter gesetzt, mit allem, was man in der Transkription nicht sieht, wie Längungen und Geminaten; die Transliteration. Logogramme werden komplett groß geschrieben, Namen am Wortanfang groß, Determinative werden für gewöhnlich hochgestellt. Im Folgenden werde ich nur die Transkription wiedergeben.
Nachteile der Keilschrift sind, dass es keine Worttrenner oder Zwischenräume gibt, Geminaten am Wortende nicht schreibbar und innere Geminaten oft nicht zu erkennen sind und nur selten plene17 geschrieben wurde – mitunter auch Pleneschreibung vorkommt, obwohl sie nicht erwartet wird, z.B. zur Betonung oder um einen Fragesatz anzuzeigen.
2.3. Phonologie
Zunächst muss man sagen, dass die genaue phonetische Rekonstruktion von Lauten lediglich aus einer Schrift schwierig ist; in der Keilschrift jedoch speziell kann man sich teilweise kaum sicher sein, ob damit wirklich alle Laute wiedergegeben wurden und letztlich – wie man diese aussprach. Es wird immer vom Protosemitischen ausgegangen, aber letztlich sind einige Punkte noch heute umstritten, z.B. ob die Sibilanten Affrikaten waren, was heutzutage teilweise angenommen wird, oder ob es ein /o/ gab. Bei den Lauten berufe ich mich größtenteils auf Streck (2005), da in diesem Bereich in den letzten Jahren viel gestritten wurde und der GAG definitiv überholt ist.
Das Akkadische hatte auf jeden Fall die drei semitischen Primärvokale (/a/, /i/, /u/) sowie eine Innovation; einen sekundären Vokal (/e/), der nicht phonemisch ist. Laut dem GAG hatte es höchstwahrscheinlich auch ein Schwa (/ə/)18 und vielleicht /o/, /y/, /ø/. Das OB kennt noch einen Diphthong /ai/, geschrieben aj bzw. ay, je nachdem ob deutsche oder internationale Umschrift, sowie die Halbvokale /j/ (geschrieben j oder y) und /w/.
Bei den Konsonanten sind die Plosive am leichtesten zu identifizieren: /b/, /p/, /t/, /d/, /k/, /g/ und /?/ (letzteres geschrieben als ِ’19) sind sämtlich wie im Deutschen. An Nasalen hatte es /m/ und /n/. /r/ müsste wie im Semitischen ein Vibrant sein, der laterale Approximant ist /l/. Als Frikativ hat das Akkadische lediglich das /x/ (geschrieben: ḫ). Bei den meist emphatisch genannten Lauten nimmt man mittlerweile an, dass es Ejektive waren: /t’/ (ṭ), /ts’/ (ṣ) und /k’/ (q). Bei den Sibilanten wird wie gesagt davon ausgegangen, dass sie Affrikaten waren20: /ts/ (s), /tł/ (š) und /dz/ (z). Wie man sieht, fehlen die Laryngale völlig.
Beide, Vokale und Konsonanten, können lang vorkommen, geschrieben als Geminate bzw. im Typ ū; also mit Längenstrich. Die Längung ist auch phonemisch. Weiterhin könnte auch sein, dass es weitere phonemische Realisierungen einzelner Laute gab, was sich aber kaum noch überprüfen lassen wird.
Es gibt eine ganze Reihe von phonologischen Regeln, die hier aufzuführen aber zu viel wäre. Wichtig zu wissen ist an dieser Stelle jedoch: Zwei Vokale werden, wenn zwischen ihnen nichts, ein ‚, ein w oder ein j steht kontrahiert, z.B. zu û, wobei es Regeln gibt, welche Vokale zu welchem kontrahieren. Der kontrahierte Vokal wird als lang gesprochen angenommen. Auch gibt es weiter viele Assimilationsregeln, denen man fast ständig begegnet, über alle ‚Wortarten‘ hinweg.
An Silben kennt das Akkadische offene und geschlossene, kurze, lange und überlange. Offen und kurz sind VC und CV; offen und lang CVV; lang und geschlossen CVC; überlang und geschlossen CVVC. Ob möglicherweise am Silbenschluss auch CC möglich war lässt sich nur schwer sagen. Weiter hat das Akkadische als eine Regel die Tendenz, möglichst wenig Silben in einem Wort zu haben. Trotzdem können Verbalformen sehr lang werden.
Der Akzent liegt auf der vorletzten, bei mehrsilbigen Wörtern auf der drittletzten Silbe, so der GAG21. Einen Satzakzent gibt es nicht.
2.4. Morphologie
Der GAG unterteilt die Wortarten des Akkadischen (ohne es explizit so zu benennen) grob in Pronomina, Nomina(/)Verba22 und Partikel, welchem ich hier bei der kurzen Vorstellung zunächst folgen werde. Erst recht spät im GAG bemerkt von Soden, dass er funktional untersuche und nicht, wie es damals die große Gegenströmung war, strukturalistisch. Die anderen Grammatiken geben keinerlei Theoriehintergründe an.
Leider erwähnt der GAG auch erst spät, was eigentlich grundlegend am Anfang erläutert werden sollte: Wie gesagt bauen die semitischen Sprachen auf Wurzeln auf, die aus standardmäßig 3 Konsonanten und einem Vokal bestehen, eine meist abstrakte Bedeutung haben und diese durch Wurzelflexion und Veränderungen der Lautformen stark differenzieren können. Diese Wortwurzeln kommen rein und gänzlich ohne Zusatz in der Sprache eigentlich nicht vor, jedoch nimmt man an, dass die Wurzelform eines Verbes im Imperativ vorliegt23. Laut dem GAG hat das Akkadische, wie das Semitische an sich, eine Tendenz dazu, eine begrenzte Zahl von als solchen erkennbaren Bildungstypen zu schaffen, denen oft auch Bedeutungsklassen angehören. Sehr bekannt ist z.B. die Nominalform, mit der aus einem Verb ein abstraktes Nomen gebildet wird. Pronomen nehmen eine Sonderstellung ein, weil sie nicht von Wurzeln gebildet werden; dasselbe gilt auch für die meisten Partikel – wobei das Thema Adverbien wieder etwas komplizierter ist. So ist im Akkadischen also das größte Problem zu unterscheiden, ob es den Unterschied Nomina vs. Verba gibt.
Zunächst einmal aber unterscheidet der GAG zwei Hauptwurzeltypen. Die erste Gruppe sind die Nominalwurzeln, von denen laut GAG nur Nomina gebildet werden. Diese Nomina sind meist gegenständliche Alltagssubstantive, wie pûm ‚Mund‘ oder kalbum ‚Hund‘. Ungnad nennt diese Primärsubstantive mit unveränderlichen Vokalen. Viele dieser Nomina wurden später jedoch auch denominalisiert zu Verba – oder Adjektiva, welche aber schon Nomina sind, jedoch auch von Substantiven oder Verben stammen können24. Die zweite Gruppe sind demnach die Verbalwurzeln, aus denen mindestens ein Verb und meist auch mehrere Nomina geformt werden können; zu letzteren zählt Ungnad von Verben gebildete Substantive – eventuell könnte man noch annehmen, dass es mehrere homophone Wurzeln25 gibt, die im Endeffekt zu nur je einer der beiden Gruppe gehören. Ein weiteres Problem sind die zahlreichen Lehnwörter, die unterschiedlich stark schon eingearbeitet wurden aber auf jeden Fall keine akkadische (oder gar semitische) Wurzel aufweisen.
An Wortklassen kennt der GAG daher die Folgenden: Zunächst die Pronomen, die nicht von Wurzeln stammen und Flexionsbesonderheiten aufweisen. Gleiches gilt für die Partikel, zu denen für den GAG quasi alles zählt, was nicht zu den anderen Klassen gehört. Nomina und Verba sind von den Wurzeln her nur teilweise unterscheidbar, von der Deklination und Konjugation aus gar nicht, da Infinitive und Partizipien stark Richtung Nomina tendieren und diese sowie Substantive auch im Stativ stehen können, zu dem wir noch kommen. Die Adjektive wiederum können von beiden abgeleitet und Numerale können Substantiv oder Adjektiv sein. Nach von Soden muss daher die Einteilung klar nach semantischen Gesichtspunkten erfolgen. Demnach ist alles, was referiert, ein Substantiv; was Attribute beschreibt ein Adjektiv und was Aktionen oder Zustände schildert ein Verb. Wie wir noch sehen werden sind diese Kriterien jedoch unzulänglich, da hiernach z.B. der Infinitiv striktes Substantiv ist und der Stativ als Tempora bezeichnet wird.
Somit gäbe es also die folgenden Klassen laut GAG: Pronomen, Partikel, Numerale, Nomina (Substantive, Adjektive) und Verba.
2.4.1. Pronomina
Die eigenständigen Pronomina entstanden laut GAG aus Deuteelementen. Dazu kämen einige andere Nomina26 mit pronominalen Funktionen. Die Pronomina treten selbständig oder suffigiert auf. Dekliniert werden sie wie die Nomina, bis auf die Personalpronomina (PPN). Diese treten nur in der 1. und 2. Person auf, für die dritte wird ein anaphorisches Pronomen genutzt, das aber ebenso wie die PPN dekliniert wird. Sie haben 4 Kasus, damit einen mehr als die Nomina, 2 Numeri und 2 Genera. Ihre Funktion ist prädikativ in Nominalsätzen; dagegen emphatisch in Verbalsätzen, wenn an der Verbform auch ein Pronomen-Suffix ist. Das anaphorische (zurückverweisende) Pronomen (šū) ist laut GAG gleichzeitig adjektivisch und substantivisch27, derweil die eigentlichen PPN nur substantivisch sind.
Die PPN-Suffixe sind verkürzte PPN und kennen alle drei Personen, die 3. jedoch nur drei Kasus; den Nominativ haben nur 1. und 2. Person. Die anderen Kasus sind Genitiv, Akkusativ (zeigt das direkte Objekt an28) und Dativ (zeigt andere Objekte an). Letzterer Kasus kommt nur bei den PPN vor. Die PPN haben demnach eine feste Basis und deklinieren für Numerus, Person, Genus und Kasus29.
Demonstrativ-Pronomen (DEM) werden weiter unten ausführlicher behandelt, da sie eigentlich zu den Adjektiven gehören, laut GAG.
Das Determinativ-Pronomen (DET) hat eher syntaktische Zwecke; es leitet Nominal- und Relativsätze ein. Früher wurde es voll dekliniert, später blieb nur die Akkusativ-Form ša übrig. Es lässt sich im Deutschen meist mit ‚dass‘, ‚welcher‘ oder ‚der‘ wiedergeben; in Verbindung mit Possessivsuffixen vervielfachen sich die Möglichkeiten.
Interrogativa (INTER) unterteilt der GAG in mehrere Klassen. Das substantivisch-persönliche hat Genus und die Basis ‚mann-‚, das für die drei substantivischen Kasus dekliniert wird: mannu ‚Wer‘, manna ‚Wen‘, manni ‚Wessen‘. Durch eine präpositionale Konstruktion kann man auch einen Dativ erreichen: ana manni ‚Wem‘. Das substantivisch-sächliche hat die Basis min: minû ‚Was‘ sowie die anderen beiden Kasus. Schließlich gibt es noch ein adjektivisches, das nicht für Kasus dekliniert: ajju ‚Welcher‘.
Indefinit-Pronomen (INDF) ergeben sich aus einer Reduplikation der DEM oder INTER; manchmal auch mit dem Klitikum -ma. So z.B. mamman (aus mann-) ‚irgendwer‘, mimma ‚irgendwas‘ und ajjumma ‚irgendein(er)‘.
2.4.2. Nomina
Als Nomina versteht der GAG Substantive, Adjektive und Numerale, weist aber darauf hin, dass er viele Wörter z.B. aufgrund fehlender Belege nicht klar einordnen kann. Wegen dem Bestreben der Sprache, gleich lautende Wörter zu vermeiden, würde nicht jedes perfekt in eine Bedeutungsklasse passen. Weiter soll auch noch ein Formenwandel möglich sein, sobald ein Wort erst einmal fest im Lexikon sitzt. Lehnwörter können von der Form her aussehen, als würden sie zu einer Bedeutungsklasse gehören, doch muss das nicht sein. Wenn die Bedeutungsklasse nicht zu dem Wort passt, kann man es aber leichter als Lehnwort erkennen. Nominale Komposition gibt es nicht, höchstens erstarrte Genitivkonstruktionen.
Auf fast 20 Seiten zeigt der GAG sämtliche bekannte Nominalformen30 für Substantive und Adjektive samt Bedeutungen und Beispielen, was wiederzugeben hier zu viel wäre, doch trifft Caplice (2002) eine beispielhafte wichtige Auswahl31: PaRiS ist das Verbaladjektiv, PuRRus sind Adjektive körperlicher Defekte; PaRS sind Primär- und einige deverbale Substantive, PiRS Handlungen, PuRS Adjektiv-Abstrakta, PaRāS der Infinitiv des G-Stammes, PaRīS Adjektiv-Substantive, PuRāS Tiere und Diminutiva, PaRRāS Berufe, PuRRuS der D-Infinitiv, maPRaS Plätze und Instrumente und taPRāS reziproke Handlungen.
An Genera kennt das Akkadische maskulin und feminin, wobei ersteres das ‚Neutrum‘ ist, zweiteres ursprünglich das ’nomina unitatis‘32 war und bei Adjektiven das Neutrum ist. Feminin ist meist durch -(a)t am Stamm erkennbar, doch nicht alle Wörter zeigen ihr grammatisches Geschlecht auch korrekt an: ummu ‚Mutter‘ ist feminin im Sinn und grammatikalischen Auswirkungen, hat aber nicht das Suffix.
Die Numeri sind Singular und Plural. Der semitische Dual kam schon im OB nur noch bei bestimmten Wörtern fest vor, war also nicht mehr produktiv. Der Singular steht auch für Kollektiva, der Plural wird nur durch Endungen ausgedrückt, doch einige Wörter sind auch Plurale tantum, also Singular in Form. Der Plural kann aber auch anders gebildet werden, z.B. verdoppeln einige Wörter ihren mittleren Konsonanten; einige besondere haben den Plural -ānu; Adjektive -ūtu bzw. wenn feminin -ātu.
In den semitischen Sprachen kennen Substantive sogenannte Stati, in denen sie stehen können und die in der Deklination unterschiedlich behandelt werden. Im Akkadischen wird die Normalform Status Rectus (SR) genannt. In diesem werden die Wörter voll dekliniert und von den Nomina hängt kein nominaler oder pronominaler Genitiv und kein Relativsatz in Genitivstellung ab. Man kann ihn determiniert oder indefinit lesen; das ergibt der Kontext. Im SR gibt es 3 Kasus für alle Nomina. Der Nominativ (NOM) -u zeigt Subjekte und deren Attribute an. Der Akkusativ (AKK) -a hat viele Funktionen, vor allem mit Verba und Adverbien. Er zeigt das direkte Objekt an. Der Genitiv (GEN) -i zeigt vor allem Besitzverhältnisse und andere Zugehörigkeiten. AKK und GEN werden im Abschnitt über die Syntax genauer erklärt. Im OB nur noch sporadisch und meist poetisch vorhanden sind der Vokativ, der Terminativ-Adverbialis auf -iš (Richtung, lokativisch, vergleichend und adverbial33) und der Lokativ-Adverbialis auf -ū. Zusätzlich ist noch wichtig zu erwähnen, dass es sogenannte Mimation gibt, was heißt: Die Kasusformen lauten auf -m aus, z.B. der AKK auf -a-m. Dies wurde aber selbst OB nur von Hammurapi selbst durchgehalten. In späteren Dialekten wurden die Kasus dann kaum noch unterschieden und am Ende hatte die Sprache sogar nur noch zwei Kasus, wie einige andere semitische Sprachen auch. Weiter ist zu sagen, dass Dual und Plural bereits nur diese zwei Kasus kennen: NOM und Obliquus (OBL), in dem Akkusativ und Genitiv zusammenfallen.
Der Status Constructus (SC) ist eine verkürzte Form mit vielen Formenregeln und nur beschränkt deklinierbar. In ihm stehen Nomina von denen ein (pronominaler) Genitiv oder Relativsatz ohne dem Determinativ abhängt und mit dem Nomina eine Akzenteinheit bildet. Der SC kennt (äußerlich) keine Kasus und hat mehrere Bildungstypen in zwei großen Klassen, so fällt bei einfachen Wörtern die auf einen Konsonanten auslauten bloß die Endung weg, bei solchen mit zwei Konsonanten wird ein Vokal eingeschoben und anderes. Im Plural sieht der SC aus wie der SR, weshalb er dort gerne vermieden und umschrieben wurde. Als zweite Funktion ist es der SC, an den allein bei Nomina Suffixpronomina gehängt werden können, was meist nur GEN und OBL sind (Possessivverhältnisse). Auch hier gibt es Regeln, wie der SC geformt wird. Klasse 1 hat hierbei dieselbe Form wie vor GEN, Klasse 2 eine andere.
Der Status Absolutus (SA) ist nicht deklinierbar und selten. Er hat keine Endungen bzw. im Feminin lediglich -at, sieht damit also fast wie ein Stativ aus. Im SA stehen z.B. Kardinalzahlen vor dem als Apposition Gezähltem, Preise und Massen, Distributiva, lokale und temporale Ausdrücke, verschiedene adverbiale Ausdrücke und der Vokativ.
Weiter ist zu erwähnen, dass Eigennamen meist im SR-NOM stehen und nicht dekliniert werden, während Götternamen manchmal im SA stehen können34.
Adjektive sind Nomina mit einer bestimmten Nominalform und können wie erwähnt aus Substantiven oder Verben abgeleitet worden sein35. Sie kongruieren in Genus, Numerus und Person mit dem Substantiv, zu dem sie gehören. Im Akkadischen gibt es weder Komparativ (nur analytisch umschreibbar mit dem Adverb eli ‚oben, über‘) noch Superlativ (nur vergleichend umschreibbar, z.B. ‚x ist der Große der Götter‘) als richtig eigenständige Form, jedoch hat der D-Stamm eine Intensiv-Funktion, welche bei Adjektiven der eines Superlativs gleichkommt.
Demonstrativ-Pronomen sind wie gesagt adjektivisch. Das Akkadische kennt zwei Deixis: annû ‚hier‘ und ullû ‚dort‘. Sie werden für Kasus, Genus und Numerus dekliniert und ullû bildet auch Adverbien. Adjektivisch sind sie, da sie nur Attribut sein können.
Numerale stehen wie erwähnt auch ein wenig zwischen Substantiven und Adjektiven. Da sie meist mit Ziffern geschrieben wurden ist ihre Aussprache teilweise nicht klar und Ordinale (ORD), die zu den Adjektiven gehören, sind noch weniger bekannt. Für Kardinale (KRD) und Ordinale bietet der GAG Tabellen; wobei bei den Ordinalen ab der 20 Kardinale eingesetzt wurden. Bruchzahlen wiederum werden durch die Ordinale oder häufiger durch bestimmte Substantive wie ‚Hälfte‘ ausgedrückt. Multiplikativa (MULT) werden gebildet in der Form KRD-ī-šu, wobei ersteres Morphem ein Adverbialisierer ist. Zahladverbien kamen OB noch nicht vor; an Zahladjektiven kannte es ēdum ‚einzig‘ und ištēn ‚einzeln‘. Zeitangaben letztlich wurden mit dem Determinativzeichen KAM geschrieben, welches aber für ORD und KRD stand, weshalb es ambig ist.
2.4.3. Verba
Verba sind klar identifizierbar, sobald sie konjugiert sind, was wir noch sehen werden. Man kann sie allerdings auch deklinieren, dann sind sie eher nominal. Ihre Wurzeln an sich sind stets ambig, solange sie noch nicht verändert wurden, was das größte Problem dieser Untersuchung sein wird. Aus den Wurzeln werden nach klaren Gesetzen der Wurzelbildung die endgültigen Formen gebildet. Die Wurzeln haben normalerweise 3 Konsonanten (Radikale); diese Wurzeln werden stark genannt. Die Formen mit nur 2 Konsonanten werden schwach genannt und unterscheiden sich in der Konjugation ein wenig von den starken Verben; ihre Wurzeln werden aber angeglichen und entweder geminiert oder um w(a)-, der j(a)- erweitert; lediglich die Verben, die auf Vokal auslauten sind absolut schwach. Wurzeln mit 4 Radikalen sind selten, aber den starken ähnlich. Weiterhin hat jede Wurzel einen Wurzelvokal, der im Imperativ erkennbar ist – laut Ungnad auch im Präsens – und sich in der Konjugation verändert, aber bei den dynamischen Verben (schwache) Bedeutungsklassen bildet, bei Zustandsverba dagegen nicht.
Die Grundbedeutung einer (Verbal)wurzel im Semitischen erlebt viele Modifikationen durch morphologische Veränderungen. Diese werden in Flexionsstämme eingeteilt, wobei jede Wurzel mehreren Stämmen angehören kann, aber nicht muss. Bei den Hauptarten wird die Aktionsart oder Diathese verändert (Passiv, Reflexiv, Reziprok, Faktitiv, Iterativ, Durativ, Kausativ usw.). Dies wird auch durch Flexion gelöst, die sich aber in sogenannten Stämmen präsentiert. Es gibt vier Hauptstämme und mehrere niedere. Da sie andere Flexionen als die schon vorgestellten benutzen, muss man sie hiervon als eigenständig abgehoben betrachten. Verbalstämme gibt es in allen semitischen Sprachen36, doch unterscheiden sie sich in Einzelheiten.
Folgendes gilt zunächst für den sogenannten Grundstamm, die Normalform. Person und Genus werden durch Affixe angezeigt37. Der GAG unterteilt in fientische und Zustandsverben. Letztere dürfte man auch statisch nennen können, erstere wären demnach dynamisch. Ungnad (1979) nennt die beiden Klassen wie der GAG und erklärt fientische als Handlungsverben. Caplice (2002) nennt sie state- und action-verbs. Fientisch ist jedenfalls kein (gewöhnlicher) Ausdruck der Linguistik, weshalb ich ihn vermeiden werde. Dynamische Verben sind durch Denomalisierungen erweiterbar, was nicht immer erkennbar ist, und passen dann oft nicht mehr in Bedeutungsklassen. Statische Verben sind unkomplizierter und bieten weniger Unregelmäßigkeiten.
Verba kennen 2 Numeri, abgesehen vom Imperativ und den Wunschformen, 3 Persona und 2 Genera. Der GAG nennt 4 Tempora und davon abgeleitete Wunsch- und Verbotsformen. An Modi gibt es laut GAG nur den Imperativ; andere Grammatiken, z.B. Ungnad, nennen auch den Indikativ (die Normalform) und rechnen Subjunktiv (im Nebensatz) und Ventiv (Bewegung) mit hierzu. Wiederum andere zählen hier auch die Wunsch- und Verbotsformen Prekativ und Kohortativ, Vetitiv und Prohibitiv auf. Der Ventiv stammt vom Dativ-Suffix und benennt eine ‚Hin-Bewegung‘. Verben können auch gleichzeitig DAT- und AKK-Suffixe aufnehmen um Objekte zu bezeichnen.
Zu den Tempora kann man den GAG kurz zitieren:
„[Sie] dienten primär nicht dem Ausdruck relativer Zeitstufen wie weithin unsere Tempusformen, sondern dem Ausdruck von Aktionsarten und anderen nicht zeitstufengebundenen Modifikationen des Verbalbegriffes.“ (GAG: 99)
Laut Ungnad wurden ursprünglich Durativ und Punktuell unterschieden. Später bildeten sich jedoch klarere Tempora, welche dann auch nur noch wenige Gemeinsamkeiten mit den Formen anderer semitischer Sprachen hatten.
Den Stativ nennt der GAG ursprünglich eine Tempusform, in späteren Auflagen dagegen ein konjugiertes Nomina, deren jedes (außer dem Infinitiv) in den Stativ gesetzt werden kann. Übersetzen sollte man es dann als „x ist/war y“38. Von Substantiven ist dies aber nur bei Personenbezeichnungen üblich, bei Adjektiven und Partizipien auch sonst häufig. Der Stativ hat die Form PaRiS, wobei bei anderen Persona außer der 3. Maskulin noch Suffixe folgen und nach phonologischen Regeln Vokale ellidiert werden (3.f.: PaRS-at). Es ist eine Zustandsform ohne Festlegung der Zeitstufe, so der GAG. Wird der Stativ von transitiv-dynamischen Verba gebildet, beschreibt er den Zustand, der sich aus der Handlung ergibt, weshalb er auch nur genutzt wird, wenn das Verb auch einen Zustand beschreiben kann. Auch Buccellati (1968) bezweifelte schon die klassische Auffassung und bezeichnete den Stativ als Nominalsatz, bestehend aus einem Pronomen, dem Affix, und einer Nominalform; entweder adjektivisch oder substantivisch. Tropper (2002) vertritt eine ähnliche Position.
Das Präsens (PRS) beschreibt laut GAG durative Handlungen und Vorgänge über einen gewissen Zeitraum und sollte deshalb vielleicht Durativ (DRT) heißen39. Es kann sowohl zukünftige als auch gegenwärtige Handlungen und selten sogar vergangene beschreiben. Seine genauen Möglichkeiten sind: das feststellende Futur; eine zeitlose Feststellung; Gegenwart; mit der Negation den Prohibitiv; bei Fragen Modalität; die durative Vergangenheit. Bei Zustandsverba ist die Bedeutung ingressiv. Erkennbar ist das Tempus an der Verdopplung des mittleren Radikals: i-PaRRaS (in der 3.m.).
Das Präteritum (Past = PST) war ursprünglich laut GAG zeitlos, zeigte später vergangene Handlungen an und konnte in possessiven und negativen Sätzen sogar das Plusquamperfekt sein, wurde in den späteren Dialekten aber vermehrt durch die anderen Tempora verdrängt40. Seine Form lautet (in 3.m) iPRuS.
Akkadisch ist (laut GAG) die einzige semitische Sprache, die ihren Perfekt (PF) mit dem Infix -ta- bildet: iPtaRaS. Da andere Verbalformen aber ähnliche Infixe haben, kommt es oft zu Verwechslungen. Das PF beschreibt eine eben vollendete Handlung und ist damit das Gegenstück zum PRS. Es wird fast nie negiert und kann zusammen mit dem PST eine Nachzeitigkeit, die sogenannte ‚consecutio temporum‘ anzeigen: Hier folgt nach einem oder mehreren PST das PF, um eine Handlung zu beschreiben, die nach den PST-Handlungen stattfand.
Der Imperativ (IMP) kennt nur die 2. Personen und sieht aus wie das PST ohne Präfixe. Es gibt keinen negativen oder passiven IMP.
Die Wunschformen unterscheidet man in zwei Typen. Der Kohortativ (KHR) ist 1.PL und wird mit der Form i VERB gebildet, was dann so etwas wie ‚lass uns x‘ ausdrückt. Der Prekativ (PRK) kann Zustände oder Handlungen herbeiwünschen. Bei ersterem steht das emphatische Partikel lū41 vor einem Stativ, bei zweiterem kontrahiert das lū mit dem Präfix des PST-Verbes; bei der 3. Person zu lî-, bei der 1. SG zu lû-. Die 2. Person wird durch den IMP ausgedrückt. Ob der Prekativ nun nur Wunsch oder gar Befehl bedeutet muss aus dem Kontext gelesen werden. Die Verbotsformen sind der Prohibitiv (PRHB)42 der Form lā43 PST-Verb und der Vetitiv (VET)44. Letzterer hat eigenständige Negationen, die nur hier genutzt werden: aj vor Verben mit vokalischem Anfang, ē vor konsonantischen Anfängen.
Das Akkadische hat zwei besondere verbale Endungen. Der Ventiv (VNT) drückt eine Bewegung hin zu einem Ziel aus und wird deshalb oft mit Verben der Bewegung oder des Schickens benutzt. Er ist eigentlich das Suffix 1.SG.DAT, lautet maskulin -am, feminin -m; nach vokalischen Ausklängen -nim und assimiliert sich oft an folgende Suffixe. Der Subjunktiv (SBJV) bezeichnet ein Verb in Abhängigkeit in einem Relativ- oder subjunktiven (=subordinierten) Nebensatz. Der GAG beschreibt ihn als eine ‚Art Genitivendung am finiten Verb‘ (GAG: 108), also das, was am Verb hängt und die gleiche Funktion wie der Genitiv der Nomina hat. Seine Form lautet -u, aber verschwindet, wenn das Verb schon eine vokalische Endung hat.
Zwei Formen werden in der Untersuchung noch prominent werden. Der Infinitiv (INF) ist die Form, in der Verben in Wörterbüchern zitiert werden45. Er kann nominal gebildet werden mit einem abhängigen Genitiv oder verbal mit einem Objekt im Akkusativ bzw. Subjekt im Nominativ. Gegenüber Modus und Tempus ist er neutral. Die Form lautet PaRāSum (im Nominativ). Das Partizip (PTZ) ist eine wichtige Form der semitischen Sprachen, die gerne genutzt wird. Es ist stets aktiv, fast immer nominal, kann auch Substantiv sein, meist aber Adjektiv46 und ist neutral für Tempus. Selten wird es im Stativ konjugiert. Die Form lautet PāRiS. In anderen Stämmen als dem Grundstamm ist das Partizip an dem Präfix mu- erkennbar. Selten kommt es auch ohne Endung als Verbaladjektiv (VADJ) vor.
Nun mehr zu den Stämmen. Die oben dargestellten Formen bieten sich so im Grundstamm (G-Stamm), welcher die Normalform ist. Er hat keine Besonderheiten, aber zeigt einige verbale Bedeutungsklassen, die erkennbar sind an dem Wurzelvokal (a, i, u), der vor dem 3. Radikal einer Wurzel erscheint. Man sieht hierbei als Wurzelvokal die Vokale von PST und PRS an. Unser Paradigmenwort parāsum hat z.B. den Vokal a im PRS (und Stativ und PF) und u im PST. Diese Klasse a/u sowie die Klasse a/a bezeichnen Verben, die eine Tätigkeit am Objekt beschreiben. Die Klasse i/i enthält Verben mit einer momentan resultativen Tätigkeit und in die Klasse u/u gehören Vorgänge und Handlungen nicht-momentaner Art.
Im Dopplungsstamm (D-Stamm) wird der 2. Radikal verdoppelt (wie im G-PRS); zusätzlich haben die Präfixe ein u statt i. Der Wurzelvokal wird einheitlich ersetzt durch ein a im PRS und ein i in allen anderen Formen. Der D-Stamm ist faktitiv und seine Verben führen einen Zustand herbei. Transitive Tätigkeitsverben können auch resultativ sein und aus Nomina bildet der D-Stamm Tätigkeitsverben.
Der Š-Stamm heißt so, weil bei ihm die Wurzel ein Infix -ša- bzw. ein Präfix šu- bekommt. Wie im D-Stamm haben alle Präfixe ein u; auch die Wurzelvokale sind gleich. Der Stamm bildet kausative Verben.
Im N-Stamm gibt es ein Infix -n-, das immer assimiliert wird, bzw. ein Präfix na-. Der Stamm bildet den Passiv der dynamischen G-Verben und den Ingressiv der Zustandsverba.
Weiter gibt es zu jedem der vier Hauptstämme einen sogenannten tan-Stamm mit dem Infix -ta(n)- hinter dem 1. Radikal, dessen n oft assimiliert wird, was zu Ambiguitäten führt. Die Vokale sind leicht anders als in den normalen Stämmen. Die tan-Stämme bilden den Iterativ zu den normalen Stämmen bzw. können bei Bewegungsverben auch ein ‚hin und her‘ ausdrücken.
Zuletzt gibt es zu G, D und Š noch je einen t-Stamm mit dem Infix -t(a)-, welches gleich dem PF aussieht. Der Gt-Stamm ist richtungsändernd (passiv, reziprok, selten reflexiv, habitativ oder separativ), der Dt-Stamm ist passiv zum D, der Št passiv zum Š.
Die bisher gezeigten Formen gelten für die starken Verben. Die sogenannten schwachen unterscheiden sich in der Flexion teilweise von den starken, auch wenn dieselben Grundregeln gelten.
Verben mit einem Alef (I‘, II‘ und III‘ genannt; je nach Position des Radikals) sind morphologisch noch starke Verben. Je weiter rechts das Alef in der Wurzel aber steht, desto schwächer werden sie. I‘ weisen als Anfangsvokal entweder a oder e auf; II‘ haben ihr Alef oft noch vorhanden; bei III‘ wird entweder der erste Vokal gelängt und das Alef fällt weg oder ein Auslautvokal wird gelängt.
Verben bei denen der zweite Radikal geminiert wird sind formal nicht schwach doch sie bilden eine Bedeutungsklasse der schwachen Verben, nämlich meist durative Handlungen und Vorgänge.
Verben I n haben ein n(a)-Präfix das in die Wurzel aufgenommen wurde bzw. bei Zustandsverben war dieses N von Anfang an da. Sie teilen die Bedeutungsklassen der starken Verben und werden auch fast genauso gebildet. Auch Verben I w haben ein Präfix, nämlich w(a)-, bzw. es bereits in der Wurzel, wobei die dynamischen Verben einige nicht-freiwillige Handlungen oder Bewegungen mit einem Ziel beschreiben. Weiter gibt es die Verben I j, die meist wie I e47 behandelt werden.
Die rein schwachen Verben haben statt eines dritten Konsonanten einen langen Vokal und sind in ihrer Flexion den starken Verben angeglichen doch noch nicht völlig gleich. Verben ‚mediae infirmae‘ (II‘, mittelschwach) kommen mit allen drei Grundvokalen vor. Sie weichen am meisten von den starken Verben ab. Dynamische Verben II ū und ī bezeichnen den Übergang zwischen zwei Zuständen, Bewegungsarten, körperliche Funktionen und terminativ-resultative Handlungen. Die ‚tertiae infirmae‘ (III‘, drittschwach) haben meist ū und ī, kennen aber keine Bedeutungsklassen.
Letztlich gibt es noch die doppelt schwachen Verben, die zwei Formbildungen angehören sowie einige wenige dreifach schwache, die aber besonders häufige Verba bezeichnen.
Auch unregelmäßige Formen gibt es, so vor allem izuzzum ’stehen‘ und itūlum ‚liegen‘. Und schließlich existieren noch einige wenige vierradikalige Verben, die ebenfalls häufige Tätigkeiten beschreiben und in der Flexion den starken Verben völlig angeglichen sind. Dies alles ergibt ausufernde Paradigmen, die der Akkadisch-Lerner sich einprägen kann.
2.4.4. Partikel (Präpositionen, Adverbien und der Rest)
Partikel48 unterscheidet der GAG nach ihren syntaktischen Funktionen in Präpositionen, Subjunktionen, Konjunktionen, Adverbien, Interjektionen und den Rest, die meist eigenständige Wörter, teils erstarrte Konstruktionen und selten Klitika sind. Laut GAG gäbe es aber keinen großen Wesensunterschied zwischen diesen Subklassen und viele hätten auch mehrere, klassenübergreifende Funktionen. Weiter gäbe es die Unterscheidung in Primärpartikel, die aus Deuteelementen entstanden und sekundäre, die mit der adverbialen Endung aus Nomina gebildet wurden. Den Unterschied letztlich festzustellen sei aber schwer. Die adverbialen Endungen sind vor allem der Akkusativ -am für Adverbien der Zeit und des Ortes und der Terminativ -iš für Adverbien aus Adjektiven. Viele Partikel stehen im Status Absolutus.
Präpositionen gibt es in einer beschränkten Menge; sie regieren fast alle beim Substantiv und PPN den Genitiv. Die wichtigsten Präpositionen sind ina (lokativ: in, an; instrumental: mit; partitiv: unter; ablativ: von) und ana (allativ: nach, zu; temporal: bis; kausal: zwecks). Weiter gibt es noch andere präpositionale Ausdrücke, die aus einem Substantiv + adverbialer Endung bestehen oder zusammen mit einer Präposition erstarrt sind. Z.B. steigern Ausdrücke wie ina libbi (wörtlich: ins Herz) noch die Grundbedeutung, hier also: (mitten) hinein o.ä.
Die Subjunktionen ersetzen einen nominalen Genitiv, bilden einen Nebensatz mit Verb im Subjunktiv und kommen meist auch gleichzeitig als Präposition vor. Wichtig sind z.B. inūma (als), kīma (wenn, dass) und ištu (seit).
Konjunktionen verbinden ohne zusätzliche Rektion Sätze und deren Teile. Die Konjunktion u bringt keinen logischen Zusammenhang, die Disjunktion ū wird oft weggelassen und gilt nur für Wörter, derweil es bei Sätzen ū lū heißt.
Die Adverbien unterteilen sich in Adverbien des Ortes (lokal), der Zeit (temporal) und der Art und Weise. Erstere unterteilen sich wiederum in Frageadverbien die meist von ajjum abgeleitet werden und demonstrative Adverbien wie maḫra ‚vor‘. Zweitere kennen einige Formen deren wichtigste inanna ‚jetzt‘ ist. Die Adverbien sind zahlreich, wie minna ‚irgendwie‘, ullânu ‚außerdem‘ und arḫiš ’schnell‘, aber oft abgeleitet, denn sie können auch durch den AKK -am, den TERM -iš, den DISTRIB -išum, den LOK -ūm oder den MULT -ī gebildet werden.
Satzdeterminatoren und modale Partikel gibt es nur einige wenige, wie z.B. anumma ’nunmehr‘, das wichtige šumma ‚wenn‘, das ebenso wichtige umma ‚folgendermaßen‘ und außerdem noch der wichtige emphatische Partikel lū, der z.B. auch im Prekativ vorkommt aber allein stehend eine Bekräftigung der Tat ausdrückt, wie lū allik ‚er ging wahrhaftig‘.
Negationen (NEG) sind die Partikel lā (für Wörter und Satzteile, Nebensätze, Verbotssätze und Wortfragen) und ul (für Aussage- und andere ganze Sätze). Beide gibt es auch als ul – ul bzw. lā – lā für ‚weder noch‘.
Weiter gibt es drei wichtige Klitika. Dem ersten, -ma, begegnet man in Verbalsätzen fast andauernd. Es hängt sich an Verben und bildet eine logische Konjunktion zu folgenden Verbalformen. An Prädikaten eines Nominalsatzes ist es emphatisch. Auch werden viele Partikel damit gebildet. Das Klitikum -mā ist selten und verstärkt eine Frage. Letztlich gibt es noch für zitierte wörtliche Rede das -mi, das entweder nach einem das Zitat einleitenden umma ‚folgendermaßen‘ an einer Verbalform folgt oder dieses auch ganz ersetzt.
Interjektionen (INTRJ) sind natürlich in einer toten Sprache kaum welche bekannt. Die, die es sind, haben fast ausnahmslos auch gewisse Bedeutung: anna ‚ja‘, ulla ’nein‘, gana ‚Geh!‘, agana “Wohlan!‘ und šī lū kī’am ‚So sei es!‘. So ‚wirkliche‘ Interjektionen sind das aber nicht.
2.5. Syntax
Im Folgenden werden Satzformen des Akkadischen49, die eventuell zugehörigen Formen sowie spezielle Funktionen dieser Formen vorgestellt. Das Akkadische kennt Einwortsätze, Nominalsätze und komplexe Verbalsätze. Beide Arten können koordiniert werden durch Konjunkte oder als Bedingungssatz. An Nebensatzformen gibt es Relativ-, Temporal-, Lokal-, Kausal- und Objektsätze.
Einwortsätze sind im Akkadischen (zumindest in der Schrift) selten und meist ein Ausruf oder ein verkürzter Satz, bei dem etwas als bekannt angenommenes weggelassen wurde.
Nominalsätze haben keine finite Verbalform und deshalb auch kein Akkusativ-Objekt, aber einen Genitiv. Sie können nur Aussagen über Zustände machen und das Tempus muss aus Adverbien oder dem Kontext geschlossen werden. Das Akkadische kennt Subjekt (S) und Prädikat (P). Ersteres können sein: Substantive, substantivische Adjektive, Namen und PPN. Sie können noch Attribute (Adjektive, adjektivische Pronomina, Ordinale, Partizipien oder attributionelle Relativsätze), Appositionen (erklärende Substantive im selben Kasus) oder einen Genitiv haben. P stehen normalerweise hinter dem S und sind erweiterbar. Negationen kommen vor dem P, Frage-Pronomina stehen am Satzanfang. Satzfragen können die normale Wortstellung (SOP) einhalten oder umkehren. In kompositionalen Nominalsätzen ist das P ein weiterer Satz (nominal oder verbal), in dem das S meist durch Suffix wiederaufgenommen und damit betont wird. Dann findet auch Kongruenz statt zwischen beiden Einheiten betreffend Genus und Numerus. Eine Kopula bei einfachen Nominalsätzen gibt es nicht.
In Verbalsätzen ist das P ein finites Verb. Die Wortstellung weicht von anderen semitischen Sprachen ab und folgt dem Vorbild der Sumerer in der Form SOP, wobei also das S vor einem Objekt kommt und die Reihenfolge nur zur Betonung verändert wird. Adverbien stehen direkt hinter dem Satzteil, den sie modifizieren bzw. wenn sie den ganzen Satz modifizieren am Satzanfang; seltener auch in der Mitte. S und P kongruieren in Numerus, Kasus und Genus, bis auf einige Ausnahmen wie Kollektiva und grammatische Feminina.
Der GAG nennt es Annexion, wenn sich ein Nicht-Verb mit einem oder mehreren folgenden abhängigen Genitiven (Genitiv-Verbindung, wobei das Nicht-Verb im Status Constructus steht) oder gleichwertigen Sätzen zu einer Einheit verbindet, die Zugehörigkeit oder eine Beschreibung bestimmt. Die Funktionen des Genitivs sind dabei vielfältig. Genitiv- oder Annexionssprengung (bzw. bei Caplice (2002) Periphrase) wird es genannt, wenn das Relativ-Pronomen ša eine Annexion auflöst. Das Nicht-Verb steht dann nicht im SC. Meist hat die Annexionssprengung stilistische Gründe.
Die Kardinale stehen vor dem Gezählten und einem folgenden Determinativ KAM, wobei 1 bis 2 im Genus kongruieren, 3 bis 10 im Genus polarisieren. Ordinale sind zwar formal Adjektive laut GAG aber stehen ebenso vor dem Gezählten.
Die Rektion finiter Verben wird dem GAG zufolge nur teilweise durch Bedeutungsklassen bestimmt und vor allem kann es auch mehrere Rektionen für einen Stamm geben. Intransitive Verben (INTR) verlangen kein Akkusativ-Objekt, beschreiben im G-Stamm Zustände, Vorgänge oder sind Passiva von transitiven Verben und ingressiv im N-Stamm. Transitive (TR) verlangen ein Akkusativ-Objekt und sind Verben die eine auf das Objekt gerichtete Tätigkeit beschreiben, Faktitiva (D-Stamm) von Zustandsverben oder Kausativa (Š-Stamm) der Vorgänge und Bewegungen beschreibenden Verben. Ditransitive Verben (DITR) wiederum wollen zwei Akkusativ-Objekte und sind umfangreich als Verben des Bedeckens, Bekleidens, Ausstattens, Umgeben, Wegnehmen, Fordern usw. vorhanden oder als Kausativa von TR oder Faktitiva.
Aus den sogenannten Verbalwurzeln werden auch nominale Formen abgeleitet: Partizip und Infinitiv. Die Partizipien stehen adjektivisch in Attributivstellung, dagegen substantiviert oft mit einem abhängigen Genitiv. Die Infinitive wiederum sind grundsätzlich substantivisch, haben aber sowohl verbale als auch nominale Rektion, wobei jedoch vollsubstantivitiert nur die nominale vorkommt, welches also die normale ist. In diesem Fall haben sie einen abhängigen Genitiv. Sind sie verbal, sind dagegen ein Subjekt und ein Objekt möglich. Oft werden Infinitive genutzt um den durch ein finites Verb ausgedrückten Begriff zu verstärken. Dann können sie auch im Lokativ vor dem finiten Verb stehen oder im Genitiv nach dem Relativpronomen. Auch nach einer Präposition als Ersatz für einen Nebensatz sind Infinitive möglich.
Modale Modifikationen kann man nur durch wenige Partikel erreichen, von denen die meisten wiederum zu selten belegt sind, um Schlüsse aus ihnen zu ziehen. In Wortfragen steht das Interrogativ am Satzanfang. Imperative stehen als Prädikat am Satzende. In Prohibitiv, Vetitiv, Prekativ und Kohortativ herrscht die normale Wortstellung, die nur selten modal modifiziert wird. Eine indirekte Rede gibt es nicht; die direkte wird durch umma ‚folgendermaßen‘ eingeleitet oder durch ein -mi am Verb angezeigt.
Auch einige Arten von koordinierten Sätzen kennt das Akkadische. Bei einer Parataxe werden gleichgeordnete Sätze die eng zusammenhängen durch eine Konjunktion verbunden. Hierbei kann man gemeinsame Satzteile auslassen oder durch Suffix am Verb wiederaufnehmen. Die zeitliche Koordination consecutio temporum wird durch ein PST-Verb mit -ma und folgendem PF erreicht. Disjunktionen müssen nicht ausgedrückt werden. Untergeordnete Nebensätze gibt es im Akkadischen nicht wirklich, das meiste wird durch bestimmte Zeitformen und Prekative gelöst. Konditionalsätze kann man nur durch die Verbindung von Hauptsätzen mit -ma oder durch šumma erreichen. Šumma leitet Bedingungssätze ein. Hierbei steht das Prädikat im Indikativ, das Tempus ist PST (wird aber als PRS genutzt), es ist aber auch consecutio temporum möglich. Irreale Bedingungssätze sind durch šumman möglich und Alternativen kann man durch šumma – šumma anbieten.
Nebensätze gibt es einige: relativ, verbal, nominal, temporal, lokal, kausal; vergleichende und Objektsätze. Ihr Merkmal ist, dass das Verb in den Subjunktiv -u gesetzt wird; Nominalsätze als Nebensatz sind also nur durch ihre Einleitung erkennbar, da sie kein Verb haben. Die Tempora sind oft anders als in Hauptsätzen. Syntaktisch sind die Sätze Genitive, die vom Relativ-Pronomen, der Subjunktion oder dem Substantiv abhängen. Eine Einteilung nimmt der GAG anhand des Inhaltes vor.
Relativsätze hängen meist von dem entsprechenden Pronomen ab, das wiederum meist Attribut oder Apposition zum Substantiv ist. Tempus ist das Übliche; Imperativa und Prohibitiva kommen nicht vor. Bei verbalen Relativsätzen kann das Pronomen Subjekt oder Objekt sein. Ohne das Pronomen hängen die Sätze direkt am Substantiv. Nominale Relativsätze sind selten und immer Attributsatz. Letztlich leitet das Partikel mimma Objekt-Relativsätze ein.
Temporalsätze (TS) sagen etwas über Handlungen, Vorgänge oder Zustände aus, die zur Haupthandlung in einem bestimmten zeitlichen Verhältnis stehen. Genauer bestimmt werden sie durch Subjunktionen und den verwendeten Tempus. Meist stehen sie vor dem Obersatz (OS; Hauptsätze, Nebensätze und Relativsätze); selten darinnen. Inūma ‚als‘ steht mit einem Stativ in verschiedenen Tempora. Ištu ’seit‘ drückt eine Vorzeitigkeit des TS aus. Bei kīma ‚wenn‘ folgt die Handlung des OS auf den des TS. Adi ‚bis‘ kommt nach dem OS und bildet kein PF. Warka ’nach‘ hat PST wenn es vor PST im OS steht.
Lokalsätze sind eigentlich Relativsätze ohne Pronomen aber mit der Partikel ašar. Kausalsätze haben aššu ‚weil‘ und keine feste Tempusfolge; können auch im OS stehen. Objektsätze werden durch kīma ‚wie‘ eingeleitet und entsprechen dass-Sätzen. Sie haben keine bestimmte Tempusfolge, aber sind meist PST oder PRS. Auch Vergleichssätze werden durch kīma eingeleitet.
Letztlich gibt es noch einige besondere Satzformen. Die Periode ist eine Verbindung von mehr als einem Satzgefüge durch Aneinanderreihung oder Verschachtelung und kommt vor allem juristisch und poetisch vor. Die Parenthese ist ein in einem Satz eingeschlossener aber nicht verbundener Satz. Anakoluthen kommen häufig bei Perioden vor: plötzliche Abbrüche, weil der Schreiber den Faden verlor. Ellipsen sind Satzauslassungen, wenn diese unnötig, also schon bekannt sind. Eide sind verkürzte Selbstverfluchungen für den Fall des Vertragsbruches und können positiv oder negativ sein.
Die Häufigkeit syntaktischer Formen ist letztlich in nicht geringem Maße auch zurückzuführen auf den Stil des Schreibers oder seine Herkunft.
3. Die theoretischen Grundlagen und Modelle
Im Folgenden sollen einige der bekannteren Theorien Wortarten betreffend kurz vorgestellt werden, damit wir sie im nächsten Kapitel auf das Akkadische anwenden können, um zu sehen, welche Wortarten dieses hat und gleichzeitig die Theorien an dieser Sprache ein wenig zu veri- oder falsifizieren. Zunächst betrachten wir hierzu die Einleitung von Schachter & Shopen in die Sprachtypologie, welche eine eher klassische und rein grammatische Betrachtungsweise von Wortarten vertritt. Danach sehen wir uns Hengeveld an, der die Sprachen der Welt in klare Typen einteilen will, je nachdem welche Wortklassen sie haben, dabei aber nur die sogenannten offenen Klassen berücksichtigt. Es folgen Croft, der bestimmte Wortartenklassen für universell und semantisch motiviert hält und Sasse, der darauf aufbaut aber die Universalität bestreitet und schließlich Luuk, der gar meint, dass viele der vorgenommenen Klassenunterscheidungen zu weit gehen und einige Wortklassen eigentlich flexibel sind.
3.1. Mögliche Klassen nach Schachter & Shopen
Die Bücher der Reihe „Language Typology and Syntactic Description“ sind Klassiker der Typologie und inhaltlich teilweise seit mehreren Jahrzehnten kaum verändert worden. Die neueste Auflage von 2007 soll hier als Einstieg für das Kapitel gewählt werden. Die Bücher nehmen für sich in Anspruch Typologen und Feldforscher auszubilden, weshalb es anfangs auch einen Überblick über alle, der Meinung der Autoren zufolge, möglichen Wortklassen gibt. Dieser Überblick spiegelt recht gut die traditionelle Auffassung von Wortklassen wider, wie sie auch in vielen älteren Grammatiken und teils auch noch heute vorkommt. Nach Schachter & Shopen (2007 – Im Folgenden auch abgekürzt: S&S50) sind Wortklassen die Hauptklassen von Wörtern, die grammatisch in Sprachen unterschieden werden. Dabei sollen ausnahmslos alle Sprachen Wortklassen haben, aber in unterschiedlichen Ausmaßen.
S&S kennen nur grammatische Kriterien, keine semantischen. Sie berufen sich dabei auf die Annahme, dass semantische Gesichtspunkte noch auf alten Schultraditionen basieren und damit unzureichend sind. Bei den grammatischen Kriterien unterscheiden sie die Wortdistribution (Distributionelle Analyse, DA), syntaktische Funktionen, morphologische und syntaktische Kategorien. Diesen Oberpunkten zugehörige Subkriterien fügen sie bündelweise für die einzelnen Wortklassen zusammen. Sie stellen damit also eine Menge von möglichen Kriterien auf, die teilweise mehreren Wortklassen zugehörig sein können. Demnach entscheiden also sogenannte Cluster von Kriterien, zu welcher Klasse Wörter gehören. Weiterhin kann es ihnen zufolge nötig sein, diese Klassen noch weiter in Subklassen zu unterteilen; wenn sich die einzelnen Lexeme zu stark in ihren Kriterien unterscheiden oder es andere Gründe gibt.
Wortdistribution: Die ‚Substantive‘51 boys und girls sind in positionell austauschbar (1 und 2 in (1)) und teilen deshalb das Kriterium der Position. Stimmen weitere Kriterien überein, gehören sie zur selben Wortklasse. Das ‚Verb‘ like muss aber an dieser festen Position stehen (ist in 3 ungrammatikalisch), gehört also zu einer anderen Klasse52.
(1) 1. Boys like girls.
2. Girls like boys.
*3. Like boys girls.
Die Einteilung in Wortklassen erfolgt sprachspezifisch und nicht vorher universal definiert. Interessanterweise geschieht die Benennung aber nach sogenannten universalen semantischen Überlegungen (S&S 2007: 2). Die Semantik darf also nichts zur Einteilung beitragen, benennt aber die Klasse; die Einteilung erfolgt sprachspezifisch, die Kriterien sind aber universal. S&S berufen sich bei der Benennung der Klassen vor allem auf Wierzbicka (2000), derzufolge es Basiswörter gibt, die man in allen Sprachen findet und anhand derer S&S die Wortklassen einteilen.
Weiter soll es noch andere universale Unterteilungen geben. So sollen sämtliche Sprachen zwischen offenen und geschlossenen Klassen unterscheiden. Offene Klassen sind solche, die erweiterbar sind, z.B. durch Lehnwörter oder persönliche Variationen und Erfindungen. Geschlossene dagegen sind limitiert und meist klein. Die Einteilung der Wortklassen in die beiden Oberklassen soll hierbei für alle Sprecher einer Sprache gleich sein, wenngleich einzelne Lexeme z.B. dialektal unterschiedlich sein können. Alle Sprachen sollen hierbei offene Klassen haben. Dass aber alle auch geschlossene haben, zweifeln S&S zumindest bei synthetischen Sprachen stark an. Da sie aber meinen, dass alle Interjektionen haben, widersprechen sie sich eigentlich selber.
3.1.1. Die offenen Klassen
Zu den offenen Klassen gehören nach S&S Substantive53 (N), Verben (V), Adjektive (ADJ) und Adverbien (ADV). Wie gesagt werden diese nach Clustern von Kriterien eingeteilt, wobei N & V, N & Adj sowie V & Adj auch viel gemeinsam haben können, weshalb es schwierig sei zu entscheiden, wann eine Klasse eigenständig und wann eine Subklasse ist. Dieses muss man anhand der festgelegten Cluster feststellen. Wichtig für unsere Untersuchungen ist auch die Aussage, dass sämtliche Sprachen, wenn man alle Daten und Analyseebenen in Betracht zieht, zwischen Substantiven (Nouns54) und Verben unterscheiden.
Der Substantiv-Klasse (N) verpassen sie ihren Namen anhand der traditionellen Definition, dass sie Namen, Plätze oder Orte enthält – auch wenn man, wie gesagt, dies nicht als Einteilungskriterien nehmen darf.. Hierbei berufen sich S&S auf Langacker (1987), demzufolge semantisch ein N „a region in some domain“ (S&S 2007: 5) beschreibt, und auf Wierzbicka, derzufolge sie permanente Charakter enthält die referieren können. Zugehörige Kategorien der Klasse sind Kasus bzw. grammatische Funktionen, Numerus, Genus/Klasse und Definitheit, also z.B. belebt vs. unbelebt. Oft muss man die N-Klasse weiter unterteilen, z.B. die Subklasse der Eigennamen erstellen. Syntaktisch sind Substantive für gewöhnlich Argument oder Kopf des Argumentes, seltener Prädikat (z.B. in Nominalsätzen: Er ist Lehrer.). Als Subklassen begegnen einem häufig z.B. Unterscheidungen in ‚gewöhnliche‘ Substantive und Eigennamen sowie eine unterschiedliche Behandlung des Genus.
Als Verb (V) definieren S&S die ‚meisten‘ (vgl. S&S 2007: 9) der Wörter, die Aktionen, Prozesse und Ähnliches beschreiben, erweitert um Langackers Theorie (1987), dass sie temporale Relationen ausdrücken. Sie sind meist Prädikate und selten Argumente. Ihre zugehörigen Kategorien sind Tempus, Aspekt, Modus, Diathesen und Polarität. Häufig kongruieren sie mit dem Argument und bekommen daher noch andere Merkmale hinzu, die aber für die Klasse selbst nicht typisch sind, wie Person, Genus und Numerus. Man unterscheidet laut S&S in allen Sprachen zwischen transitiven und intransitiven Verben, die manchmal noch andere Besonderheiten aufweisen. Besonders die Kopula sollte man nach S&S als Subklasse ansehen, vielleicht auch eine Unterscheidung zwischen aktiven und stativen Verben treffen55.
Der Unterschied zwischen N und V soll S&S zufolge nicht in allen Sprachen sehr klar sein, doch wäre immer einer vorhanden, wenngleich er auch nur vage sein mag (vgl. S&S 2007: 13). Interessanterweise führen sie die Entscheidung, ob zwei Klassen Sub- oder Hauptklassen sind auf ‚bloße Terminologie‘ zurück.
Zu Adjektiven (ADJ) sagen S&S, dass es sie nicht in allen Sprachen gibt und sie noch keine zufriedenstellende Definition haben. Sie drücken Qualität oder ein Attribut aus, sind eher funktional beschreibbar, denn sie modifizieren Substantive, und können Prädikat sein. Als Kategorie selbst ordnen ihnen S&S bloß den Grad zu, doch ergänzen sie, dass die Adjektive weiterhin oft Kongruenz in einigen Kategorien mit dem Substantiv haben. Je nach Sprache können die Adjektive auch eine geschlossene Klasse sein. Sprachen ohne Adjektiv unterteilen S&S in zwei Subklassen: a) hat durchaus Adjektive, aber als kleine geschlossene Klasse. Als Ersatz benutzen diese Sprachen (oft stative) Verben für physikalische und Substantive für menschliche Modifikationen. b) hat absolut keine ADJ, benutzen laut S&S deren Funktionen aber entweder über Substantive oder über Verben.
(2) Beispiel Mandarin56
a) neige nühaizi piaoliang
das Mädchen schön
‚das Mädchen ist schön‘
b) piaoliang de nühaizi
schön REL Mädchen
‚das schöne Mädchen‘
Adverbien (ADV) sollen noch seltener sein als Adjektive. Ihre Mitglieder unterteilen sich eher in viele Subklassen, die meist nur wenig gemein haben; einige dieser Subklassen können sogar geschlossen sein. Die Definition eines Adverbs ist ebenso funktional als Modifikator eines Verbes, Adjektivs oder Adverbs. Um noch mehr Adverbien zuzulassen, definieren S&S sie als ‚Modifikator einer Konstituente (die kein N ist)‘ (vgl. S&S 2007: 20). Aufgrund ihrer Vielfalt haben sie keine gemeinsamen Kategorien, aber oft eigene phonetische Besonderheiten.
3.1.2. Die geschlossenen Klassen
S&S führen auch einige Beispiele für geschlossene Klassen an, wobei diese Liste nicht vollständig sein soll, da diese Formen divers sind.
Zunächst gehen sie auf sogenannte Pro-Formen als eine komplette Klasse ein, die jeweils eine vollständige andere (meist offene) Wortklasse ersetzen sollen. Personal-Pronomen werden anaphorisch benutzt, wenn der Referent aus dem Kontext klar ist, haben distributionelle Besonderheiten und sind oft Klitika. In vielen Sprachen dienen sie auch als emphatische Verstärkung. Reflexiv-Pronomen sind oft ebenso emphatisch und koreferenziell mit dem Subjekt des Satzes. Reziprok-Pronomen sind oft identisch oder verbunden mit dem Reflexiv und besitzen auch eine ähnliche Bedeutung: eine Handlung zusammen bzw. gegenseitig tun. Andere, seltenere Pro-Formen sind Demonstrativa, Indefinita und Relativ-Pronomen. Als weitere Pro-Formen soll es Pro-Sätze (meist Affirmationen oder Negationen), Pro-Phrasen (wie die sogenannten Question-Tags), Pro-Formen für Verben, Adjektive, Adverbien sowie die Interrogativ-Pronomen geben. Letztere sehen sie als universal an.
Als weitere Klasse zählen sie die Nominal-Adjunkte auf, die zusammen mit den Nomina eine Phrase formen und die Semantik erweitern bzw. selten auch schlicht von der Syntax gefordert werden. So z.B. Rollenmarker (wie Kasus oder Topik), Quantoren (die z.B. manchmal für Plural erfordert sind), Klassifikatoren und sämtliche Artikel. Verbal-Adjunkte sind der vorherigen Klasse ähnlich. Zu ihnen zählen nach S&S Auxiliare, die z.B. TAM des Hauptverbes ausdrücken und kein eigentliches Verb sind (vgl. S&S 2007: 41) und Verbal-Partikel: nicht flektierte Wörter, die von einigen Verben verlangt werden und von Adpositionen abstammen (vgl. S&S 2007: 44). Die nächste Klasse sind die Konjunktionen. Zu diesen zählen sie die Koordinatoren, Subordinationen (die eine Phrase in eine größere einbauen), Komplemente und Relativpartikel.
Letztlich nennen sie noch einige andere unter der Überschrift ‚Der Rest‘, z.B. Klitika, die meist aus verschiedenen Wortklassen stammen, Kopula (manchmal als Subklasse der Verben), emphatische Partikel (wobei S&S hierzu nur die zählen, die das Prädikat verstärken, derweil die Nominal-Verstärker zu den Diskursmarkern gehören), Existenzialis wie die Negation, Interjektionen – die meist phonologisch völlig anders sind als andere Wörter der Sprache und bei ausgestorbenen Sprachen leider meist nicht in der Schrift mitgeteilt wurden57 – Modalpartikel wie Bitten und Honorifika. Weitere kleine mögliche Klassen lassen sie außen vor.
3.1.3. Fazit
Schachter & Shopen (2007) zeigen eine Übersicht der traditionell angenommenen Wortklassen. Sie kennen vier Hauptklassen, die sie als offene Klassen ansehen, wobei Adjektive und Adverbien aber auch geschlossen sein können und Substantive und Verben universal sein sollen. Bei den geschlossenen Klassen kennen sie Pro-Formen, Adjunkte, Konjunkte und ‚den ganzen Rest‘. Ihnen zufolge könnte man also vor allem bei den geschlossenen Klassen sehr viele kleine Unterteilungen vornehmen.
3.2. Hengeveld: Klare Kategorien und flexible Sprachen.
Hengeveld & Rijkhoff (2005, im Folgenden H&R) stellen Hengevelds Einteilung von Wortklassen der Sprachen vor. Jede Sprache habe hierbei min. eine Wortklasse58.
3.2.1. Sprachtypen: rigide und flexibel
In Hengevelds ursprünglicher Fassung unterteilte er klar zwischen flexiblen und starren59 Sprachen, wobei es keine Überlappungen gäbe. Bei Flexiblen seien dabei einige oder sogar alle Funktionen anderer Klassen in einer Klasse vereint. Die flexiblen Sprachen unterscheidet er in 3 Sprachtypen (F, V/Nicht-V, V/N/Modifikator), die starren in 4 weitere (V/N/Adj/Adv, V/N/Adj, V/N und V), erhält also die Klassen 1 bis 7. V definiert er hierbei ausschließlich als Kopf einer Prädikatsphrase; N als möglichen Kopf einer Referentialphrase, Adj als möglichen Modifikator hierzu und Adv als möglichen Modifikator zur Prädikatsphrase.
Später stellte er fest, dass wohl keine Sprache klar in eine dieser Klassen passt, sondern es eher Übergänge zwischen den Klassen gibt, z.B. 3/4 zwischen Klassen 3 und 4. Eine flexible Sprache ist eine Zwischenstufe, wenn seine Wortklassen kompatibel zu zwei Typen sind, was passieren soll, wenn eine derivierte Version weniger Möglichkeiten besitzt als seine Basis (vgl. H&R 2005: 409). Eine starre Sprache ist eine Zwischenstufe, wenn die für die Einteilung wichtige Klasse klein und geschlossen ist.
Im Gegensatz zu z.B. Croft nimmt Hengeveld an, dass Konzepte in Bezug auf Referenz und Prädikation nicht in allen Sprachen gleich seien, also nicht universal. Flexible Lexeme bezeichnet er als semantisch und kategoriell vage und nicht etwa als polysem, wobei der Kontext oder syntaktische Slots sie definiert. Semantische Unterschiede eines Lexems führt er also auf syntaktische Positionen zurück, die dafür verantwortlich sind. Flexible können ihm zufolge aber auch Subklassen enthalten.
H&R wenden dies auf die Sprache Mundari an, die ihnen zufolge, wenn man nur die Basis eines Wortes betrachtet, die Sprache zu Klasse 1 macht, betrachtet man auch noch die Derivation sei sie Klasse 1/2. Alle flexiblen Sprachen hätten eine spezielle Wortreihenfolge oder spezielle morphologische Marker, um zu disambiguieren. Die Morphologie greift hierbei meist ein, wenn auch die Wortreihenfolge flexibel ist. Flexible Sprachen seien ihm zufolge agglutinierend oder isolierend und haben keine strikte morphologische Konjugation. Ähnlich wie S&S denkt also auch Hengeveld, dass der Sprachtyp mit seinen möglichen Wortklassen korreliert.
3.2.2. Syntaktische Slots
Van Lier (2009) beschreibt Hengevelds Theorie als Ganzes ebenfalls kurz. Ihr zufolge wären für die Klassifikation syntaktische Slots wichtig, derweil die Semantik völlig außen vor gelassen wird. Morphologische Kategorien wiederum helfen nur bei der Identifikation. Die vier möglichen Slots sind: Kopf einer Prädikatsphrase, Kopf einer referentiellen Phrase und deren jeweilige optionale Modifikatoren. Traditionell würde man dies Substantiv, Verb, Adjektiv und Adverb nennen.
Damit ergeben sich auch gleichzeitig die vier großen Standard-Wortklassen: Substantiv, Verb, Adjektiv und Adverb. Hierbei dürfen die jeweiligen Lexeme aber kein weiteres Morphem aufnehmen, um zu einer bestimmten Form zu werden, in der sie die Klasse wechseln würden. Es wird also der sogenannte Stamm betrachtet, nicht klassenverändernde Affixe. Weiterhin können alle Wortklassen auch Kopf einer Prädikatsphrase sein, lediglich Verben sollen nur dieses sein können (vgl. van Lier 2009: 14). Die vier Klassen sind hierarchisch unterteilt: Der Kopf einer Prädikatsphrase ist immer gegeben und damit auch zwingend vorhanden, wenn es auch einen Kopf einer referentiellen Phrase gibt. Modifikatoren einer referentiellen Phrase sind in dieser Hierarchie am seltensten.
Angewandt auf die Hierarchie bedeutet sie aber, je weiter unten in der Hierarchie eine Wortklasse steht, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie sich mit der über ihr stehenden zu einer flexiblen vereint. Insofern ist eine flexible Klasse Adj/Adv also eher anzunehmen als eine N/Adj/Adv und eine Klasse V/N ist nicht möglich. Diese Hierarchie gab logische Möglichkeiten für 7 Sprachtypen. Später erweiterte er, wie oben beschrieben, sein System durch Zwischenstufen, da die ursprünglichen sieben Typen nicht korrekt die Sprachen der Welt vorhersagten. In diesen Zwischenstufen werden derivierte Formen mit einbezogen, die zuvor explizit verworfen worden waren. Ist die in der Hierarchie tiefststehende Klasse einer Sprache klein und geschlossen, so gilt es nach diesem System als ‚intermediate rigid‘.
|
System |
Kopf von PrädPhrase |
Kopf von RefPhrase |
Mod von Refphrase |
Mod von Prädphrase |
|
|
Flexibel |
1 |
Contentive60 |
|||
|
1/2 |
Contentive |
||||
|
Contentive |
Nicht-Verb |
||||
|
2 |
Contentive |
Nicht-Verb |
|||
|
2/3 |
V |
Nicht-Verb |
|||
|
V |
Nicht-Verb |
Modifikator |
|||
|
3 |
V |
N |
Modifikator |
||
|
3/4 |
V |
N |
Modifikator |
||
|
Modifikator |
ADV |
||||
|
Strikt |
4 |
V |
N |
ADJ |
ADV |
|
4/5 |
V |
N |
ADJ |
ADV |
|
|
5 |
V |
N |
ADJ |
– |
|
|
5/6 |
V |
N |
ADJ |
– |
|
|
6 |
V |
N |
– |
– |
|
|
6/7 |
V |
N |
– |
– |
|
|
7 |
V |
– |
– |
– |
|
(3) Tab. 1: Das System der Sprachen der Welt nach Hengeveld.
Noch später, in kürzlichen Arbeiten, wurde weiter klar, dass obiges System immer noch zu strikt ist (vgl. Van Lier 2009: 22). Nach Anpassungen gibt es 10 weitere Sprachklassen bzw. insgesamt 17, wenn das alte System ersetzt wird. Das neue Modell enthält keine Zwischenstufen mehr und birgt weiter einige Probleme, weshalb die Theorien des Hengeveld noch nicht als völlig ausgereift angesehen werden können.
3.3. Croft: Wortklassen sind universal nach Semantik geordnet
Croft verteidigt – im Gegensatz zu Hengeveld – schon länger die Ansicht, dass Wortklassen (zumindest N, V und Adj) universal sind und nicht nur in bestimmten Sprachen vorkommen. Außerdem nimmt er auch Semantik und Morphologie in seine Kriterien mit auf.
3.3.1. Crofts Kritik
Croft (2000) zeigt zunächst die klassischen Positionen und deren Probleme auf. In der Schultradition basieren die Definitionen der Wortklassen auf Semantik, wobei jedoch die Morphosyntax ignoriert wird, wie es auch schon S&S sagten. Wörter verschiedener semantischer Klassen können jedoch in allen Wortklassen auftauchen, was schon oft gezeigt und wozu noch keine Alternative geboten wurde. Die Generativisten führten dann Binärwerte für syntaktische Ähnlichkeiten ein, jedoch wurde keine Grundlage definiert dies zu begründen, weshalb ihre Theorien vor allem sprachübergreifend schlecht vergleichbar wären. Andere theoretische Typologen teilt er ein in Lumper (‚Klumpenbildner‘), die alles auf wenige Klassen reduzieren, dies aber nur können, wenn sie wichtige Sprachfakten ignorieren, und Splittern (‚Spalter‘), die viele Kategorien annehmen – manchmal zuviele.
Hengeveld ist ihm zufolge ein eindeutiger Lumper, der zwar einen festen theoretischen Hintergrund hat, was nach Croft unbedingte Voraussetzung ist, doch seien seine Annahmen trotzdem falsch. Denn seine Einteilungen sollen nur funktionieren, wenn er wichtige sprachliche, vor allem semantische, Daten ignoriert, da sich auch die Bedeutung eines Lexemes je nach Anwendung ändert (vgl. Croft 2000: 69). Es gäbe ein Problem, wenn Lexeme einer Sprache spezielle semantische Verschiebungen durchlaufen, die multiple Bedeutungen haben, da sie dann in unterschiedliche Wortklassen fallen. So gibt es nach Croft in Sprachen teils Lexeme, die einfach multiple Bedeutungen haben, die sich aber erst durch den Kontext ausformen und dann in verschiedene Wortklassen fallen (vgl. Croft 2000: 71). Auch würde er seine Kriterien inkonsistent anwenden, besonders bei Sprachen, die schlecht vergleichbar sind. Letztlich würde Hengeveld noch kleine syntaktische Einheiten und Wortklassen ignorieren, jedoch gäbe es bereits eine Klasse, auch wenn sie nur wenig Vertreter hat61.
Distributionelle Analyse (DA) wäre laut Croft (2000) ein wichtiges Instrument, da sie oft nicht markierte Kategorien zeigt, denn die gleiche Form zweier Lexeme muss nicht bedeuten, dass sie die gleiche Klasse haben. Doch die Grenzen, die DA aufzeigt, sind meist zu unscharf, weshalb man auf zuviele Klassen schließen könnte bzw. die einzelnen Klassen überhaupt nicht genau aufstellen kann. So könnten die Splitter zuviele Klassen aufstellen; zum Beispiel, ob das Lango nun nur eine Klasse Adjektiva oder drei hat (vgl. Croft 2000: 79).
3.3.2. Crofts universale Theorie: RCG
Nach Croft (2000) muss eine universal-typologische Theorie der Wortklassen folgendem entsprechen:
- Muss sie Kriterien haben, um Ober- von Subklassen zu unterscheiden;
- muss sie sprachvergleichend Bestand haben und ein einheitliches Set von formalen grammatischen Kriterien aufweisen;
- muss sie unterscheiden zwischen Sprachspezifischem und Universalem.
Seinen Beobachtungen zufolge kann niemand der ersten Annahme entsprechen und Hengeveld geht zwar in Richtung der zweiten jedoch noch nicht korrekt.
Crofts Annahme ist, dass Kategorien einzelner Sprachen definiert sind durch ihre Grund-Satz-Struktur und ihre Sprachkonstruktionen, welche wiederum primitive Elemente syntaktischer Repräsentationen sind. Seine grundlegende Theorie nennt er Radical Construction Grammar, die er in anderen Publikationen62 ausführlicher erläutert hat. Nach dieser stammen syntaktische Kategorien, wie Wortklassen, von den sie definierenden Konstruktionen und so sind Wortklassen nicht sprachspezifisch und Universalien nur Kategorien und Strukturen, die in (fast) allen Sprachen vorkommen; also nicht absolute Universalien im klassischen Sinne.
Eine wichtige Annahme ist die typologische Markiertheit. Diese ist eine universelle Eigenschaft einer konzeptuellen Kategorie und dementsprechend nicht sprachspezifisch. Wortklassen definiert er als typologisch unmarkiert für eine Funktion, derweil andere mögliche Funktionen markiert sind. Markierte haben mindestens so viele Morpheme wie ihre unmarkierten Varianten, derweil diese mindestens soviel grammatisches Verhalten aufweisen wie die markierten. Unmarkiert sind pragmatische Funktionen: Referenz, Modifikation, Prädikation. Funktionsanzeigende Morphosyntax enkodiert hierbei die 3 Grundfunktionen für unterschiedliche lexikalische Klassen. Alle Möglichkeiten zusammen nennt er konzeptuelle Kategorien (vgl. Croft 2000: 89).
|
Konzept |
Referenz |
Modifikation |
Prädikation |
|
Objekte |
Unmarkiertes N |
GEN, Adjektivisierer |
Prädikats-N, Kopula |
|
Eigenschaften |
Deadj. N |
Unmarkierte Adj |
Eigenschafts-Adj, Kopula |
|
Aktionen |
Aktions-N, INF, Komplemente |
PTZ, Relativsätze |
Unmarkiertes V |
(4) Tab. 2: Konzeptuelle Kategorien (Croft: 89).
Den Kern einer Kategorie/Klasse nennt er Prototypen. Diese sind universal, derweil die Abgrenzungen zu anderen Klassen sprachspezifisch sind. Dementsprechend stehen Begriffe wie Substantiv, Verb und Adjektiv für universale Prototypen. Die sprachspezifischen Grenzen werden dann in der Praxis durch die DA festgelegt. Eine Wortklasse nimmt dann in der sogenannten kognitiven Karte eine bestimmte Region ein, die je nach Sprache unterschiedlich groß ist. Funktionale Eigenschaften wie bei S&S reichen hierbei nicht, um eine Klasse zu definieren, doch diese Eigenschaften definieren die mentale Karte auf der sich die Prototypen ausbreiten (vgl. Croft 2000: 91).
3.3.3. Semantische Klassen: Prototypen
Nach van Lier (2009: 34) unterscheidet Croft drei mögliche Funktionen für Lexeme, die er Funktionen propositionaler Akte (propositional act functions) nennt, die Hengeveld zwar auch kennt, jedoch nur als Zusatzannahme, nicht als Basisfunktion: Prädikation, Referenz und Modifikation; die bereits oben angesprochenen pragmatischen Funktionen. Diese Funktionen unterteilen die Lexeme in drei semantische Klassen: Objekte, Eigenschaften und Aktionen – soweit sein altes System, das er bald aber erweiterte. Die semantischen Klassen wiederum werden durch vier semantische Eigenschaften definiert: Relationalität (ob die Definition eines Konzepts Referenz zu einem anderen Konzept benötigt), Stativität (ob das Konzept Status oder Prozess beschreibt), Zeitlichkeit (welchen Zeitstatus das Konzept hat), (skalare) Graduierbarkeit.
|
Relationalität |
Stativität |
Zeitlichkeit |
Graduier. |
|
|
Objekte |
Nicht-Rel. |
Status |
Permanent |
Nicht-grad. |
|
Eigenschaften |
Rel. |
Status |
Perm./zeitl. |
Grad. |
|
Aktionen |
Rel. |
Prozess |
Zeitlich |
Nicht-grad. |
(5) Tab. 3: Semantische Klassen nach Croft (vgl. van Lier 2009: 34).
Die semantischen Klassen sind die Prototypen, wie oben erläutert. Als Beispiel wählt er das Japanische, wo es, traditionell gesehen, mehrere Adjektiv-Subklassen gibt, die sich unterschiedlich verhalten. Bei Hengeveld würden dabei mehrere Subklassen herauskommen, bei Croft anhand der Prototypen nur eine Oberklasse. Durch die Prototypen können also verschiedene Sprachen ihre Wortarten verschieden ausformulieren, doch haben dabei alle dieselben universellen Wortklassen.
3.3.4. Fazit
Crofts Vorteile sind die sprachübergreifende Vergleichbarkeit dank der Prototypen, die unscharfe Grenzen haben, derweil andere Theorien mit zu vielen Klassen enden würden oder gar die Feinheiten eines Sprachsystems teilweise ignorieren um nur die vordefinierten Klassen zu erreichen.
3.4. Sasse: Gegen universale Kategorien
Sasse (1993) spricht sich dagegen aus, dass man mit vorgefertigten Erwartungen und vordefinierten Wortklassen an eine Sprache herangeht. Seiner Meinung nach sind diese Definitionen empirisch nicht übertragbar und damit eine Einteilung in Klassen nur erlaubt, wenn die Empirie einer Sprache die Daten dafür liefert. Vor allem meint er, dass die traditionelle Unterscheidung von Nomen63 und Verb nicht immer gegeben sein muss. Damit ist auch schon gesagt, dass er sich auf sogenannte Inhaltswörter in seinem Artikel beschränkt; wie auch schon Hengeveld und Croft.
3.4.1. Sasses Theorie zur N/V-Distinktion.
Sich auf Literatur die N/V-Distinktion betreffend stürzend erklärt Sasse, dass diese meist Unterdifferenzierung annehmen und führt einige ‚falsche‘ Positionen vor, z.B., dass die Distinktion einfach nur schwach ausgeprägt ist; dass sie überhaupt nicht vorhanden ist; dass verschiedene Wortklassen Unterklassen sind; dass es einen Unterschied nur in einer bestimmten Ebene der Analyse gibt; dass sie Prototypen sind; dass der Übergang zwischen beiden Klassen fließend ist. Die Begriffe ‚Nomen‘ und ‚Verb‘ sowie andere Kategoriennamen, seien einzelsprachliche und nicht universale Begriffe.
Seiner Erklärung nach ist der allgemeine Fehler, der gemacht wird, dass sprachspezifische Begriffe auf universelle Theorien ausgedehnt werden. Man geht davon aus, dass das, was man in einer Sprache findet, in allen zu finden sein muss. Vollkommen übertragbar sei das aber nie und im Vergleich sprachübergreifend annehmbar nur bei verwandten Sprachen (vgl. Sasse 1993: 190). Diese teilweise Vergleichbarkeit ergibt sich daraus, dass die Sprachen ihre Wortklassen durch ähnliche Kriterienbündel aufbauen, so wie es auch Schachter & Shopen sagen. Es haben z.B. die meisten europäischen Sprachen zwei Wortklassen, genannt ‚Nomen‘ und ‚Verb‘, die sich durch einige oder alle der Kriterien Genus, Numerus, Kasus, TAM, Person und Diathesen auszeichnen.
Probleme ergeben sich dann, wenn die Kategorien, die eine Wortklasse einer Sprache aufweist, anders sind als erwartet. Wichtig sei, dass einige Sprachen ähnliche Wortklassen nur deshalb besitzen, weil sie aufgrund einer häufigen formalen Konventionalisierung bestimmter sprachlicher Operationen, namentlich Referenz, Prädikation und Modifikation diese gebildet haben. Doch dafür nutzen Sprachen teils unterschiedliche Klassen und Kategorien. Diese Probleme finden sich bereits bei indoeuropäischen Sprachen und schlimmer noch bei isolierenden. Man kann also, nach Sasse, einzelsprachliche Erkenntnisse nicht auf alle Sprachen verallgemeinern.
Die traditionellen Begriffe stammen aus dem Bereich des Lexikons64, doch finden sich schnell Sprachen, für die andere Kategorien, wie z.B. syntaktische, wichtiger sind. Beide Arten von Kategorien müssen in einer Sprache nicht einmal zusammen vorkommen, weshalb dann Annahmen, die von der traditionell lexikalischen stammen, die Syntax übersehen und falsche Schlüsse ziehen – und ontologische Überlegungen müssen nicht zu den richtigen lexikalischen Kategorien führen (vgl. Sasse 1993: 194). Referenz und Prädikation müssen sogar überhaupt nicht mit der lexikalischen Kategorie eines ‚Nomens‘ verbunden sein. Sasse (2009) zeigt hier Beispiele, wo sogar die Syntax dies übernimmt. Die unscharfen Prototypen von Croft (1991) seien ein Einblick – aber keine Lösung. Viele Autoren scheinen Sasses Ansicht nach anzunehmen, dass lexikalische Klassen überall dieselbe Ontologie ausdrücken, wobei aber unterschiedliche Kulturen auch unterschiedliche Konzepte aufweisen65.
Seine Schritte zu einer möglichen Lösung sind, zuerst die Fehler auseinander zu nehmen, zu untersuchen und neue Kriterien aufzustellen für eine mögliche Einteilung von Lexemen in Wortklassen. Kategorien, so sagt er, hätten sprachspezifische Begründungen bekommen und dürften daher auch nur einzelsprachlich definiert werden, sie sind aber nicht universal vergleichbar, wobei Prototypen dies auch noch nicht lösen. Es ist aber eine Korrelation einzelsprachlich formaler Mittel mit universalen Ontologien im Bereich bestimmter kognitiver Domänen möglich (vgl. Sasse 1993: 195).
An Zuteilungskriterien (von lexikalischen Kategorien66) setzt er fünf an:
- formale67 (Flexion, Distribution und Derivation),
- syntaktische (wie Slots; potentielle Abbildungsfunktion auf syntaktische Kategorien),
- morpholexikalische (phonotaktische Struktur, kategorienindizierende Affixe),
- ontologisch-semantische (Zuordnung zu ontolog. Kategorien & Bedeutungsklassen),
- diskurstechnisch-pragmatische (Zuordnung zu grundlegenden Diskursoperationen (Referenz, Prädikation, Modifikation) ).
Ähnlich wie Croft äußert auch Sasse Kritik an der Distributionellen Analyse. Sie sei eine gute heuristische Methode, liefert aber nur Kontextbeschränkungen und Kollokationen für Lexeme/-gruppen (vgl. Sasse 1993: 198). Bei nullderivierten Lexemen kann sie (fälschlicherweise?) zwei Kategorien annehmen. Ist die Bedeutung jedoch durch Position oder Kontext vorhersagbar, so ist das Lexem laut Sasse vage.
Syntaktische Kategorien sind nur möglich, wenn eine lexikalische Kategorie nicht auf der syntaktischen Ebene zugewiesen wird, sondern strikt davon getrennt worden ist. Gibt es keine lexikalischen Kategorien, so müssen die syntaktischen ohne die lexikalischen existieren können. Deshalb sollen vage Inhaltswörter auch durch bestimmte syntaktische Positionen keine bestimmten Wortklassen werden (Sasse 1993: 199). Syntaktische Kategorien sind formal zu bestimmen (über Funktionswörter, Morphologie, Position) und können phrasal (konfigurationelle Kategorien mit interner Struktur wie NP, VP, AP) und/oder funktional (Prädikat / Argument) definiert sein.
Er teilt die Sprachen der Welt in vier Typen ein, je nachdem ob lexikalische und/oder syntaktische Kategorien vorhanden sind und ob diese korrelieren:
|
Typ |
Lex. Kat. |
Synt. Kat. |
Korrelation |
Beispiel |
|
A |
ja |
ja |
ja |
Euro. Spr. |
|
B |
ja |
ja |
nein |
Tagalog |
|
C |
ja |
nein |
N/A |
Cayuga |
|
D |
nein |
ja |
N/A |
Tongan |
(6) Tab. 4: Typen der Welt (vgl. Sasse 1993).
Er nimmt also an, dass eine von beiden Kategorien mindestens vorhanden ist.
Als ontologische Kriterien zählt er die systematische Korrelation von formaler Wortklasse mit einer Konzeptklasse, basierend auf der Annahme, dass die menschliche Kognition universale Schubladen besitzt (wie Objekte, Zustände, Relationen, Handlungen)68. Konzeptklassen sind Bündel verwandter Konzepte, die durch ein übergeordnetes Merkmal (Hyperonym) definiert werden. Von Croft (1991) übernimmt er hierbei: Objects, Properties, Quantifiers, States, Relations, Actions.
Problematisch bei ontologischen Kriterien ist, dass diese wieder einmal Annahmen sind, die aus einer speziellen Sprache stammen, sich teilweise nicht ausschließen müssen und viel zu grob definiert sind (z.B. können viele Dinge Objekte sein). Er meint aber, dies sei für alle Sprachen gültig, jedoch zunächst nur im Groben, müsse also noch verfeinert werden. Aber auch wenn ein Lexem Referenz, Prädikation oder Modifikation als Semantik aufweist, heißt dies noch nicht, dass es eine der klassisch diesen zugeordneten Wortklassen sein muss.
Als Beispiel für seine Kritik nimmt er das ‚Nomen‚, das entweder (traditionell im Latein) als referenzfähig bezeichnet wird, in anderen Sprachen aber auch mal nur über Determinatoren (Griechisch) oder gar überhaupt nicht referenzfähig (Cayuga) ist – und in manchen Sprachen sind einige ‚Nomina‘ referenzfähig, andere nicht (Vietnamesisch, Chinesisch). Dies nimmt er als Beweis dafür, dass selbst bei Existenz einer lexikalischen Kategorie die, in Ontologie und Syntax, wie ein Substantiv wirkt, sie noch keines sein muss (vgl. Sasse 1993: 203).
3.4.2. Fallstudie Cayuga: Wurzeln statt kanonische Formen.
Sasses Fallstudie ist die Sprache Cayuga. Ihre Rede teilt sie nicht in Sätze, sondern ihm zufolge in ‚Strings‘, wobei syntaktische Funktionen über die Morphologie angezeigt werden. Er unterteilt die Lexeme der Sprache in Funktions- und Inhaltseinheiten. Erstere sind oft festgelegt und einsilbig. Zweitere unterteilen sich in sogenannte Simplizia (=S), die bereits allein ein Wort bilden (sind unflektiert und monomorphemisch) und Wurzeln, die dazu durch Affixe erweitert werden müssen. Diese haben wiederum zwei Subklassen, wobei eine (=R2) TAM und Pronomen, die andere (=R1) nur die 3. Person und POSS annimmt. R1 analysiert er als Subklasse von R2. R2 sind nicht komplementativ und verbähnlich, weil sie TAM, NEG und andere Affixe nehmen und konjugierbar sind, daher keine klassischen „Nomen“ darstellen. Aus der Ontologie wird ersichtlich, dass R1 eher Individualkonzepte und Zustände beschreibt. Inkorporierbar wiederum sind nur R1 in R2. Formal erkennt er aus beiden Wurzeltypen zwei verschiedene lexikalische Kategorien (vgl. Sasse 1993: 207), z.B. R1 Tür und R2 satt werden. Nun können R2 aber konventionalisiert werden und sind dann ambig zu gleichzeitig benutzten produktiven Formen, so z.B. konventionalisiert ‚Pferd‘ und produktiv ‚es schleppt Baumstämme‘.
Traditionell werden diese beiden R-Typen natürlich als Substantiva und Verba betrachtet. Der wichtige Punkt nun ist aber, dass Sasse meint, dass die dort angenommen Typen deklarierte Flexionsformen sind, die zu kanonischen Formen erklärt werden. In Wahrheit aber sind die Wurzeln die lexikalischen Einheiten und daher zu betrachten (vgl. Sasse 1993: 209)69. Der Grund, warum er R1 nicht als Substantive bezeichnen will, ist, dass ihre Eigenschaften nur einen Ausschnitt der Kriterien von R2 bilden. Auch sind R1 durchaus verbähnlich im Verhalten und auch prädikativ nutzbar. Ontologisch kommt man hier auch nicht weiter, da alles, was man in unserer Sprache als Substantiv auffassen würde, im Cayuga durch Eigenschaften vermittelt wird und die ‚Substantive‘ auch wie ein Verb nutzbar sind: ‚er großelterte mich‘, ‚Mensch sein‘.
Simplizia wiederum sind eine kleine und geschlossene Klasse, die prädikativ wie die R-Formen verwendet werden können und daher keine klassischen „Nomina“ sind. Sie bezeichnen meist Tiere und einige Lehnwörter. Man könnte sie vielleicht zu ‚Substantiven‘ erklären, doch dies wäre ein Dorn im Auge aller universalen Theorien. Eine distributionelle Analyse bringt einen laut Sasse hier auch nicht weiter. Allerdings sollen R2 sich im Laufe der Zeit zu S entwickeln.
Überblickend, welche ’nominalen Begriffe‘ durch welche Wurzeln ausgedrückt werden: Menschen, Naturerscheinungen, Lokalitäten und Zustände durch statische R2; Ereignisse und Prozesse durch dynamische R2. Pflanzen sind R1 und Simplizia. Tiere und ‚Anfassbares‘ sind R1, konventionalisierte R2 oder Simplizia.
Im Fazit erkennt Sasse im Cayuga keine typische N-V-Distinktion und keine übergeordnete Syntax. Er schlussfolgert, dass sie keine Nomina hat bzw. diese sich auf gleich 4 Klassen verteilen, die man teilweise klassisch auch als Verben bezeichnen könnte. Seine Forderung ist es daher, die alten Methoden nicht auf andere Sprachen zu übertragen sondern ihre Annahmen und Kriterien zu entflechten und nach den geforderten einzelnen Kriterien zu suchen, die aber immer noch zu unscharf seien.
3.4.3. Partizipien
Sasse (2009) untersuchte Partizipien, speziell im Aramäischen, einer semitischen Sprache. Ihm zufolge zeigen Partizipien spezielle aspektuelle Nuancen wie Progressiv und Resultativ auf, während der ’normale‘ Tempus durch finite Verben ausgedrückt wird. Wortklassen definiert er hier als lexikogrammatikalische Kategorien, basierend auf Beziehungen zwischen zwei Dimensionen: lexikal-semantische (Prototypen und Ontologie) sowie morphosyntaktische (Slots). Verben definiert er als universell mit einem Ereignis verbunden; ein Substantiv70 ist universell mit einer Entität verbunden.
Partizipien nun seien ontologisch ambig. Er sieht sie als eigene Kategorie an, weder richtig Verb noch Substantiv, mit mehr als einer ontologischen Orientierung, die in verschiedenen syntaktischen Slots verschiedene semantische Lesarten erlaubt. Sie können eine Entität als Ereignis denotieren, eine Eigenschaft als Ereignis oder mit einer Kopula auch das Ereignis selbst. Weiter haben sie die Freiheit in jeder der Hauptslots zu erscheinen; Argument, Prädikat oder Attribut. Partizipien entstehen aber aus Verben; nämlich, wenn finite Verbformen verloren gehen, so Sasse, was er an seinem Fallbeispiel demonstriert.
Letztlich beruft er sich noch stark auf Croft (2000), demzufolge Sprachen dazu tendieren ihre Lexeme auf der Basis der drei ontologischen Kategorien zu sortieren. Wenn eine Sprache hierbei zu strikt ihre Lexeme den Kategorien zuordnet, könnte man erwähnte Nuancen nicht mehr ausdrücken, wofür sie dann neue Kategorien bräuchte, wie die Partizipien, welche auch das morphologische System simplifizieren sollen. Beim Akkadischen begegnen uns noch oft Partizipien.
3.5. Luuk: Nur flexible Wortklassen?
Luuk (2009) könnte man als Unterstützer von Hengeveld auffassen, meint er doch, dass es in Sprachen die Möglichkeit gibt, dass Lexeme ambig sind auf die Möglichkeit hin Substantiv71 oder Verb zu sein, was er dann die Klasse der ‚Flexiblen‘ nennt.
Zunächst definiert er N & V als lexikalische Kategorien, die von deren Stämmen – und nicht funktionalen Köpfe – getragen werden und die funktional motiviert sind mit distinktiven semantischen und vor allem grammatischen Funktionen. Ersteres hat er mit Hengeveld gemein, zweiteres nur teilweise. Syntaktische und propositionale Funktionen sind hierbei P & A, also Prädikation und Argument.
Achtet man bei dem Beispiel aus der Sprache Nootka nur auf den funktionalen Kopf, gäbe es hier vier verschiedene Lexeme in zwei Wortklassen. Tut man es nicht, sind es zwei Lexeme in einer Wortklasse, die erst durch den funktionalen Kopf definiert werden. Dies nennt er Unterspezifikation, was heißt, dass der Stamm unterspezifiziert ist für die Unterscheidung N oder V, stattdessen aber flexibel. Testen könne man diese Hypothese nicht, doch findet er sie von allen möglichen am leichtesten.
(7) Beispiel Nootka:
1. mam:k-ma qu:ʔas-ʔi
work-indic man-the
‚The man is working.‘
2. qu:ʔas-ma mamu:k-ʔi
man-indic work-the
‚The working one is a man.‘
Die Wortklasse der Flexiblen (F) ist per Definition notwendigerweise flexibel in Bezug auf die N/V-Unterscheidung und möglicherweise flexibel in Hinsicht auf andere Unterscheidungen, wie V/Adj. Anders als Hengeveld nimmt er also keine Hierarchie an. Die Flexiblen würden weiter häufig dazu tendieren eine bestimmte Klasse / Form besonders oft einzunehmen.
Kurz geht er auch auf Croft ein, nach dem N & V prototypische Korrelationen von propositionalen Funktionen und semantischen Klassen seien, wobei V für Prädikate und Aktionen, N für Referenzen und Objektive bestimmt sei. Es gäbe keine Implikationen für die Morphosyntax. Und nur die untersucht Luuk.
Im Weiteren gibt er Beispiele für Sprachen, in denen klassisch angenommene Distinktionen von N & V eigentlich eher flexible Wortklassen sein sollten, wie dem Englischen. Ihm zufolge kann eine Sprache auch mehr als eine flexible Wortklasse haben, z.B. N/V, Adv/Adj, usw. Im Gegensatz zu Sasse (1993) ist er der Auffassung, dass die N-Version häufiger ist denn eine V-Version.
Um arbeiten zu können definiert er für N, dass ihre Stämme mindestens einen LA (Marker für linguistische Argumente: DET, POSS, Wortstellung) nehmen, aber kein LP (Marker für linguistische Prädikate: TAM, Diathese, Wortstellung), V umgekehrt und Flexible (F) können beides. Oder übersichtlicher:
N = Stämme können LA aber nicht LP aufnehmen.
V = Stämme können LP aber nicht LA aufnehmen.
F = Stämme können LA und LP aufnehmen.
Ein Wort definiert er (vgl. Luuk 2009: 6) als minimale Einheit einer Sprache die ohne Kontext verstanden wird. Sie entsteht aus einer Wurzel, die durch Derivation zum Stamm wird und durch Flektion zum Wort. LA werden markiert durch Determinatoren, Possessiva und die Wortreihenfolge, LP durch TAM, Diathesen und ebenfalls Wortreihenfolge. Das mag ihm zufolge für Einzelsprachen unzureichend sein, doch sein Ziel ist die Universalität. Genus, Numerus usw. lässt er außen vor, da diese auch andere Klassen markieren können und oft durch Kongruenz übertragen werden. Ein F kann auch LA und LP gleichzeitig haben, wobei hier der syntaktisch markantere wichtiger wäre; z.B. lässt sich dies in einigen Fällen durch Juxtaposition erklären. Wie gesagt arbeitet er aber mit dem Stamm, der noch keine Derivation oder Flexion trägt. In seinen Erweiterungen bis zum Wort kann die Einheit anderen Wortklassen angehören, weshalb es wichtig ist, zunächst nur auf den Stamm zu achten – ähnlich wie es auch Hengeveld verlangt. Die Hierarchie ist:
- Wurzel
- Stamm = Wurzel + Derivation → Ausgangsbasis
- Wort = Stamm + Flexion
Da dies noch nicht unbedingt reicht, z.B. wenn sich die Marker nicht direkt mit dem Lexem verbinden, erweitert er sein System noch um die Regel, dass der syntaktisch am weitesten außenstehende Marker für die Identität eines Elementes ausschlaggebend ist (vgl. Luuk 2009: 7).
Ein größeres Problem sieht er darin, wie man distributionelle Daten erklärt, was schon bei vielen Sprachen durch verschiedene Untersucher zu verschiedenen Ergebnissen führte, obwohl sie dieselben Ausgangsdaten hatten. Die Möglichkeiten nennt er exklusiv und inklusiv. Erstere liegt vor, wenn man sagt, dass ein Stamm F ist, wenn er mindestens 1 LA und mindestens 1 LP tragen kann. Zweitere unterteilt sich in zwei Untergruppen, wobei die erste vorliegt, wenn ein Stamm alle LA und einige LP trägt; die zweitere, wenn ein Stamm die meisten LA und wenig LP trägt – bzw. jeweils für LA und LP umgekehrt. Luuk meint, das Ergebnis einer Analyse hängt davon ab, welche Variante man theoretisch bevorzugt und möchte sich nicht genau festlegen, spricht sich jedoch vorsichtig für das Exklusive aus (vgl. Luuk 2009: 9). Ein weiteres Problem für ihn ist, ob man die theoretische Annahme ‚Pervasiveness‚ (Durchdringung) zulässt, die aussagt, dass es z.B. reicht bereits ein einziges festlegbares N zu haben, um in einer Sprache auch eine Klasse N bilden zu können. Das wäre z.B. ein Argument gegen Hengeveld, der solche Mini-Klassen gerne auslässt. Diesen erwähnt Luuk zwar nicht, doch spricht er sich deutlich für die Annahme aus (vgl. Luuk 2009: 9).
Schließlich stellt er noch vor, welche Typen von Sprachen logisch möglich wären, wenn man von N, V und F ausgeht. Es ergäben sich da die folgenden Sprachtypen:
1. N/V/F – alle drei Klassen vorhanden
2. N/F – nur N und F vorhanden
3. V/F – nur V und F vorhanden
4. N/V – nur N und V vorhanden
5. F – nur F vorhanden
Nicht möglich sei es, dass es nur N oder nur V gibt und eine Klasse wie N/Adj/Adv sieht er als solche, aber nicht als F an.
Für ihn wäre noch eine großangelegte Untersuchung notwendig um herauszufinden, welche Möglichkeiten in den Sprachen der Welt wirklich realisiert werden, doch einige der Typen kann er bereits unterstützen. So soll die Mehrheit der Sprachen oder sogar alle Klasse 1 sein. 2 und 3 bieten das Problem, dass, sobald auch nur ein N bzw. V gefunden wird, die Sprache zu einer anderen Klasse gehört. Bei 3 ist er gegen Sasses Annahme, dass das Cayuga kein N hat, was es zu Klasse 1 macht. 4 soll bisher nur in künstlichen Sprachen realisiert sein. Für 5 gibt es viele Behauptungen, doch gehen diese ihm zufolge darauf zurück, dass der Untersucher nicht alle Ebenen der Analyse berücksichtigte – und letztlich könnten nur Muttersprachler genau sagen, was richtig ist. Wenn in F-Sprachen auch nur ein Lexem feststellbar ist, das klar N oder V ist, wechselt die Sprache bereits die Klasse. Nach Luuk gibt es also nur Sprachen N/V/F und eventuell auch F (vgl. Luuk 2009: 10). Kriterien für eine Wortarteneinteilung sind für ihn also die jeweilige Ebene der Analyse (Wurzel, Stamm, Wort, Phrase), klare Definitionen (N, V, F), distributionelle Kriterien (müssen gleich sein für alle Klassen) und die Pervasiveness-Theorie.
3.6. Fazit
Wir sahen eine Übersicht verschiedener Theorien zum Problem der Wortklassen.
Schachter & Shopen (2007) definieren Wortarten als den traditionellen Terminus für die Hauptklassen von Wörtern, die eine Sprache unterscheidet. Sie variieren in Zahl und Art stark in den Sprachen. Kriterien sollen grammatisch und nicht semantisch sein. Die Klassen unterteilen sie in offene und geschlossene. Erstere haben eine praktisch nicht limitierte Anzahl von Einheiten, die daher variieren. Zweitere sind meist klein und für alle Sprecher gleich, wobei sie sich fragen, ob es diese Klassen in allen Sprachen gibt. Sie finden es schwer zu unterscheiden, ob zwei Klassen Subklassen oder unabhängige Hauptklassen sind, was auch daran liegt, dass sie die Klassen durch Eigenschaftscluster einteilen. Dabei kann es sehr leicht klassenüberschneidende Kriterien geben. Nicht alle Einheiten einer Wortart müssen dieselben Eigenschaften haben, doch immerhin dieselben Obereigenschaften. So z.B. nicht FEM, aber Genus. Substantive und Verben werden nach ihnen in allen Sprachen unterschieden.
Hengeveld & Rijkhoff (2005) unterteilen die Sprachen der Welt in rigide und flexible Systeme, was Hengeveld im Laufe der Jahre aber mehrfach abwandeln musste, um korrekte Voraussagen zu treffen. Sie definieren vier Wortarten funktional: V kann nur Prädikatsphrasen-Kopf sein, N ist meist Kopf der Referenzialphrase, ADJ sind Modifikatoren des Kopfes der Ref-Phrase und ADV selbiges beim Kopf der Präd-Phrase. In seiner zweiten Revision erzielt Hengeveld 7 Sprachtypen sowie 6 Zwischentypen, in der dritten sind es 17 Typen. Die Flexibilität einer Sprache stellt man fest durch distributionelle Äquivalenz, bidirektionale Flexibilität, strikte semantische Komposionalität für Argument und Prädikat sowie eine Exhaustivität durch das ganze Lexikon. Flexible Lexeme sind semantisch vage und haben eine allgemeine Bedeutung, die auch spezifische abdeckt. Sie nehmen eine Korrelation zwischen Sprachtyp und Wortarten-System an, da die Grammatik einer flexiblen Sprache bestimmte Merkmale enthalten soll, die dem Hörer hilft, die Funktion eines Lexems festzustellen.
Sasse (1993) bezweifelte die Universalität der Wortklasse Substantiv. Allgemein sagt er, dass Kategorien der Linguistik nur Gültigkeit besitzen, wenn sie empirisch gerechtfertig sind. Die Literatur zur N/V-Distinktion beschäftigt sich primär mit dem Problem der Unterdifferenzierung, aber nichts anderem. Etiketten für Wortklassen sind sprachspezifisch und dürfen daher nicht leichtfertig universell genutzt werden, da sie nie vollständig übertragbar sind und in Teilen meist nur – eben teilweise, durch ähnliche Bündelungen von Kriterien. Diese Bündelungen sind komplementär. Lexikalische Kategorien müssen formal und nicht allein semantisch bestimmt werden. An Kriterien zur Bestimmung nimmt er alles an: formal (Flexion, Derivation, Distribution), syntaktisch (Slots), ontologisch-semantisch, diskurs-pragmatisch (Referenz, Prädikation, Modifikation), morpholexikalisch (Phonotaktik und Affixe). Distributionelle Analyse ist nützlich für grundsätzliche Einsichten aber ergibt keine endgültigen Lösungen. Er stellt vier Sprachtypen auf, von denen er eine, repräsentiert durch die Sprache Cayuga, als Fallstudie vorstellt. Dort gibt es das Problem, dass traditionell zwei verschiedene Wurzeln als Verba und Substantiva angenommen werden, man aber nicht die kanonischen Formen sondern die Wurzeln selber betrachten muss, welche sich äußerst verbähnlich verhalten. Maximal könnte man die kleine geschlossene Klasse der Simplizia als Substantiv annehmen, was aber allen traditionellen Definitionen ebenso widerspricht.
Luuk (2009) nimmt flexible Lexeme in vielen Sprachen der Welt an, die weder N noch V sind. Er sagt, dass solche Einheiten (ohne Derivation) unterspezifiziert sind. N sind Stämme, die LA-Marker (DET, POSS, Wortstellung) nehmen können, V können LP-Marker (TAM, Diathese, Wortstellung) nehmen und F beide. Man muss also die Stämme ohne funktionale Köpfe betrachten. Die Identität eines Elements wird durch seinen syntaktisch äußersten Marker bestimmt. Wenn ein Lexikon auch nur eine Einheit hat, die N oder V ist, hat sie auch diese Wortklasse. Er stellt 5 logische Sprachtypen auf, von denen er letztlich sagt, dass es entweder auch F oder nur N/V/F gibt.
Lediglich Schachter & Shopen sagten also, dass es immer einen Unterschied von N und V gibt. S&S sowie Sasse gehen von Kriterien-Cluster aus, derweil Hengeveld und Luuk Definitionen aufstellen. Und S&S sind die einzigen, die auch geschlossene Wortklassen betrachten, was die anderen scheinbar nicht interessiert.
4. Die Wortarten des Akkadischen
Wie wir in den vorherigen Abschnitten gesehen haben, gibt es eine klassische Einteilung der Wortarten des Akkadischen sowie eine große Diskussion unter Linguisten, was Wortarten überhaupt sind beziehungsweise wie man sie kategorisieren und benennen kann. Hier nun möchte ich analysieren, wie die Wortarten des Akkadischen eingeteilt werden sollten, wendet man die vorgestellten Theorien auf sie an. Dies soll auch gleichzeitig Stärken und Schwächen der Theorien aufzeigen. Als Textbeispiele werde ich dafür klassische Schriften der altbabylonischen Zeit anführen. Vor allem wäre da der Codex Hammurapi, der die standardisierteste Form der Sprache schlechthin darstellt. Weiterhin greife ich auf Beschwörungen zurück, die zwar eher in den Bereich der Literatur einzuordnen sind, doch gibt es da auch probate Beispiele72. Die Übersetzungen stammen von mir. Die originale Keilschrift werde ich dabei außen vor lassen. Die Reihenfolge der angewandten Theorien ist dieselbe, wie schon zuvor, auch wenn Sasse den Höhepunkt darstellen wird. Zuletzt ziehe ich ein Fazit aus dem Gesehenen und eigenen Ansichten.
4.1. Schachter & Shopen: Die klassischen akkadischen Wortarten.
Wie auch schon zuvor bieten sich S&S ideal als Einstieg an, vertreten sie doch die klassischen Definitionen, auf deren Basis die Wörter einer Sprache eingeteilt werden. Und diese Definitionen wurden, teils abgewandelt aus der semitistischen Tradition, auch bei bisherigen Grammatiken des Akkadischen angewandt. Jedoch lehnen sie semantische Gesichtspunkte ab, auf die der GAG sich aber zum Teil beruft. Zur Erinnerung, mögliche Kriterien sind: Wortdistribution, syntaktische Funktionen, morphologische und syntaktische Kategorien. Da S&S bereits vordefinieren, welche Wortarten es gibt, kann jetzt nur überprüft werden, welche davon auch im Akkadischen vorkommen.
4.1.1. Die offenen Klassen
Substantive. Sie sind permanente Charaktere die referieren. Enthalten meist Namen, Orte und Plätze. Kriterien sind Kasus und grammatische Funktionen, Numerus, Genus und Definitheit. Soweit die Definition von S&S. Nun zum Akkadischen.
Bei den Nominal- und Verbalformen kann man eigentlich nie klar sagen, ob sie von einer rein verbalen Wurzel stammen oder von einer nominalen. Diesem Problem können wir uns aber bei S&S nicht stellen, da ihren Annahmen zufolge eine Distinktion von Substantiv und Verb immer gegeben ist und sie Wurzeln nicht betrachten. Also muss man die Wurzeln ignorieren und die Betrachtung gleich auf die ‚fertigen‘ Stämme lenken. An diesen überprüfen wir die Kriterien und Definitionen von S&S.
Leicht zu identifizieren sind Numerus und Kasus.
(8) šumma awīl-um awīl-am ubbir-ma
Wenn Mann-NOM Mann-ACC beschuldigen.D.3m.PST-KONJ
‚Wenn ein Mann einen (anderen) Mann beschuldigt.‘ (KH §1)
Als Subjekt steht das Lexem awīl- mit der Endung -um im Nominativ. Als Objekt steht das Lexem mit der Endung -am im Akkusativ. Der Genitiv -im ist vor allem zu finden, wenn das Lexem in Abhängigkeit zu einer Präposition oder einem Status Constructus steht.
(9)a) ina ṣir-im iṣbat-ma
Im Feld-GEN ergreifen.G.3m.PST-KONJ
(Wenn er) ‚Im Feld ergreift.‘ (KH §17)
b) bēl ḫulq-im
Herr.SC Verlorenes-GEN
‚Herr des Verlorenen.‘ (KH §9)
Das, was man allgemein als Substantiv bezeichnen würde, ist aber nicht das Einzige, das Kasus nehmen kann. Partizipien und Infinitive stammen von Wurzeln, deren Nutzen eigentlich verbal ist – aber die Wurzel ist hier egal.
(10)a) ina lā epēš-im
Im NEG tun.G.INF-GEN
‚Im Nicht-tun‘ oder ‚dass er nicht getan hat‘ (GAG: 111)
b) aššat mu-nabt-im
Ehefrau.f.SC PTZ-fliehen.N.PTZ-GEN
‚Die Ehefrau des Flüchtlings.‘ (KH, § 136)
Genera gibt es zwei. Das erste können wir in Beispiel (8) sehen: awīlum und awīlam sind beide maskulin, das heißt unmarkiert. Nun ist dies aber nicht das einzige Genus. In (11) hat das Lexem ašš- das Suffix -at-, welches das Femininum anzeigt73. Einige Lexeme zeigen ihr Genus aber nicht an, wie das Lexem ummu ‚Mutter‘.
(11) šumma awīl-um ašš-at-am iḫuz-ma
Wenn Mann-SG-NOM Eherau-f-AKK nimmt-KONJ
‚Wenn ein Mann eine Ehefrau nimmt.‘ (KH, § 128)
Adjektive zeigen auch Genus, jedoch leicht abgewandelt; dazu unten. Auch Numeralien verfügen über Genus, aber in ihrer eigenen Form. Die Formen des Genus für Verba sehen gänzlich anders aus. Kurz gesagt: alle Formen außer den ‚Partikeln‘ und Adverbien zeigen Genus an in Kongruenz zum Subjekt.
An Numeri kennt das Akkadische nur noch Singular und Plural. Ersterer ist an Substantiven unmarkiert (s.o.), zweiterer hat für die Kasus unterschiedliche Endungen. Numerus taucht ebenfalls in Kongruenz bei allen Formen außer den Partikeln und Adverbien auf. So finden wir Numerus auch bei Adjektiven, Numeralien und Verben, jedes Mal wohl in Kongruenz zum Subjekt (vorhanden oder nicht vorhanden).
als Gott-SG.NOM erhoben-SG.NOM
‚Als der erhobene Gott‘ bzw. ‚Als der erhobene Anu‘ (KH Prolog)
Die größte Besonderheit der Substantive sind die Stati, in denen sie stehen können. Diese findet man nicht bei ‚reinen‘ Verbalformen, jedoch können auch Numeralia in zweien von ihnen stehen – jeweils wieder in Kongruenz.
(13) a) samāne šanātim
8.f.SA Jahr-GEN
‚8 Jahre.‘ (GAG: 194)
b) ištēnum
1.SR
Definitheit kann man im Akkadischen höchstens implizit aus dem Kontext oder anhand der Determinativa erkennen. ‚Richtige‘ Artikel wie in anderen Sprachen gibt es hier nicht, auch keine morphologische Definitheit. Die Demonstrativa jedoch kommen nur mit Substantiven vor. Im Sinne von Belebtheit findet sich kein Unterschied.
(14)a) šumma šamall-ûm
Wenn Vertreter-NOM
‚Wenn der Vertreter‘ (schon vorher erwähnt) (KH §105)
b) šumma tamkar-um
Wenn Verkäufer-NOM
‚Wenn ein Verkäufer‘ (noch nicht erwähnt) (KH § 104)
c) kalb-um ull-ûm
Hund-NOM jenes-NOM
‚jener Hund.‘ (konzipiert)
Ein Problem für die Frage der Trennung von Nominalia und Verbalia sind stets die sogenannten nominalen Formen des Verbes: Partizip, Infinitiv und Stativ.
Das Partizip stammt eindeutig von einer verbalen Wurzel, hat jedoch mit den ‚typischen‘ Funktionen eines Verbes nichts zu tun sondern ist vollkommen nominal. Nach S&S wäre es eine Zwischenform von Substantiv (s.o.) und Adjektiv.
(15) šīb-ī mu-d-ī
Zeuge-PL.OBL PTC-wissen.PTC-PL.OBL
‚Die Zeugen die es kennen‘ (oder: die wissenden Zeugen)76 (KH §10)
Der Infinitiv kann je nach Nutzung sowohl verbal als auch nominal sein.
(16) a) ana māt-im ūs-im šū-ḫuz-im
um Land-GEN Führung-GEN Š-nehmen.INF-GEN
O1 O2 P
‚Um dem Land Führung zu geben (lit.: geben lassen).‘ (KH Prolog)
b) u râm-ka lī-diš
KONJ lieben.INF.SC-2m.POSS PRK-erneuern.PST
A P
‚…und deine Liebe (lit: dein Lieben) möge sich erneuern.‘ (Wilcke 1985)
Der Infinitiv als ‚Crossover‘ spricht eigentlich stark für eine Verbindung von Nominalen und Verbalen und ist wie immer ein Problem für eine klare Klassifizierung, sofern man ihm nicht die Zugehörigkeit zu zwei Klassen erlaubt. Infinitiv und Partizip sind also zwei Problemfälle. Dass theoretisch auch Substantive in den Stativ gesetzt werden könnten, ist kein Argument, sie nicht als eigene Wortklasse zu betrachten. Die Besonderheiten gegenüber verbalen Formen sind nach den Kriterien von S&S groß genug um zumindest die Nominalen als eigene Klasse zu definieren.
Adjektive. Diese müssen nicht vorhanden sein, sind Modifikatoren von Substantiven in Art der Qualität oder des Attributes und können auch Prädikat sein. Eine feste Kategorie ist der Grad. Weiter haben sie meist Kongruenz mit dem Subjekt.
Adjektive im Akkadischen sind an ihrer Nominalform erkennbar; die Form ist PaRS-um. Sie scheinen gänzlich von verbalen Ausdrücken abgeleitet zu sein; per Definition hier, und weil wir nicht Wurzeln sondern Stämme betrachten, zählen sie aber zu den nominalen Ausdrücken. Selbst Adjektive, die man als Primäradjektiv erwarten würde, wie Farben, leiten sich ab, so z.B. warqum ‚grün-gelb‘ von warāqum ‚grün-gelb sein‘. Nicht umsonst wird die entsprechende Verbalform im Allgemeinen auch Verbal-Adjektiv genannt. Die Frage hier wäre, was zuerst da war: das Adjektiv oder das Verb? Laut Definition von S&S müssen wir sie hier aber als eigene Klasse annehmen, die allerdings relativ begrenzt zu sein scheint; zumindest in den Wörterbüchern finden sich nur wenige Einträge und auch in Texten sind sie eher selten, da meist bevorzugt ein Stativ oder Partizip genutzt wird. Ein Argument, anzunehmen, dass die Adjektive doch eine eigene Klasse bilden, ist, dass sie im Plural eigene Kasusendungen haben, die sich von den Substantiven und anderen Formen unterscheiden: –ūtum im Nominativ und –ūtim für Genitiv-Akkusativ. Am ehesten erinnern diese Endungen noch an die entsprechenden femininen Endungen, jedoch mit u statt a.
(17) mâr-ê maḫr-ūtum
Kind-PL.NOM vorne.sein-PL.NOM
‚Die späteren Kinder‘ (KH § 173)
Auch zeigen die Adjektive Genus und Numerus in Kongruenz zum Subjekt, was aber kaum besonders ist. Nun können die Adjektive aber auch häufig im Stativ stehen, von dem gesagt wird, dass er ein verbales Phänomen ist. Meiner Meinung nach macht der Stativ aber erst ein Attribut aus, genau was das Adjektiv ist, womit es eine Art Adjektivisierer darstellt. Trotzdem würde ich sagen, dass Adjektive hauptsächlich von den Verbalwurzeln stammen, doch nach der Definition von S&S als Modifikator und da sie morphologische Besonderheiten aufweisen, haben sie ihre Berechtigung als Klasse.
Verben. Nun zu den kompliziertesten Formen. Für die Verbalformen gilt dasselbe wie für die Nominalformen: Nur bereits ‚fertige‘ Stämme werden betrachtet. Die Definition lautet, dass sie Handlungen und dergleichen beschreiben, wozu im Akkadischen zwangsweise auch die Zustände gehören, wenngleich ihr Sinn eher attributiv ist.
Die Verbalformen teilen sich semantisch in zwei Gruppen (statisch und durativisch bzw. dynamisch) auf, die anhand ihrer Form gut erkennbar sind. Dies ist typisch für semitische Sprachen, wenngleich das Akkadische hier nicht so strikt wie andere ist. Meist kann man durch Vokalisation und andere Besonderheiten (z.B. einem w-Präfix) erkennen zu welcher Art die Verbalform gehört. Auf jeden Fall unterscheidet die Verbalform die generierten Verben aber von den Nominalformen.
(18) a) mu-bbir-šu i-ddak
PTC-werfen.PTC-3.POSS 3-N.töten.PRS
‚Sein Anschuldiger wird getötet.‘ (KH §1)
b) in77 Igigi u-ša-rbe‘-ū-šu
Unter I.-AKK 3-Š–groß.sein.PST-PL-3.AKK
‚Unter den Igigi machten sie ihn groß.‘ (KH Prolog)
Da eine Verbalform als Prädikat auch gleichzeitig das Argument anzeigen kann, nehmen sie wie die Substantive Numerus (Singular und Plural), Person und Genus (feminin und maskulin). Diese werden aber durch Affixe realisiert, die sich völlig von denen der Nomina unterscheiden.
(19) nadin i-ddin-u-šum
geben.PTC 3.geben.PST-SBJV-3.DAT
‚der Verkäufer verkaufte ihm‘ (etwas). (KH §9)
Im Gegensatz zu den Nominalformen und sämtlichen anderen Wortklassen zeigen die Verbalformen Tempus an mit Hilfe einer bestimmten Form.
(20) a) nert-am elī-šu i-ddi-ma
Verbrechen-AKK über-3 3-werfen.PST-KONJ
‚ihn des Verbrechens beschuldigte‘. (KH §1)
b) mârat-ka ul a-ḫaz
Tochter-2.SG.POSS NEG 1-nehmen.PRS
‚deine Tochter nehme ich nicht.‘ (KH §159)
c) zinništ-im šanīt-im u-ptallis-ma
Frau-GEN andere-GEN 3.D-D.PF.günstig.ansehen.3-KONJ
‚eine andere Frau mit Verlangen angesehen hat.‘ (KH §159)
Auch Modus können nur die Verbalformen ausdrücken, wie Imperativ und die Wunschformen. Für die Wunsch- und Verbotsformen braucht es auch Partikel, welche die Nominalformen nicht nehmen können.
(21) li–ḫdû libbu-ki
PRK-glücklich.sein.PST Herz-2.POSS
‚Möge dein Herz glücklich sein.78‚ (Wilcke 1985)
Sogenannte Objekt-Suffixe, die das Ziel einer Handlung anzeigen im Akkusativ oder Dativ, können auch nur die Verbalformen aufnehmen; dagegen kommen gleichlautende Possessiva auch an substantivischen Formen vor.
(22) ana mārūt-ī-šu ilqu-šu-ma
zu Sohn-PL-3.POSS 3.G.nehmen.PRS-3.AKK-KONJ
‚ihn zu seinen Söhnen nimmt.‘ (KH $190)
Letztlich noch bekommt nur die Verbalform eines subordinierten Nebensatzes den Subjunktiv, den man aber nicht sieht, wenn die Verbalform einen u-Auslaut hat.
(23) inuma ilqû-šu
wenn 3.G.PRS.SBJV-3.AKK
‚Wenn er ihn nimmt.‘ (KH § 186)
Schließlich ist eine Besonderheit der Verbalformen den Ventiv zu nehmen.
(24) ṣên-ê u-ša-l-am-ma
Kleinvieh-PL 3-Š-gut.machen-VNT-KONJ
‚das Kleinvieh gut machen.‘ (KH § 267)
All dies unterscheidet die Verbalformen klar von den Nominalformen. Doch haben sie auch einiges gemeinsam, bei dem man sich bezüglich Zugehörigkeit streiten kann. Zunächst einmal zeigen die Verbalformen, wenn sie in verschiedenen Stämmen stehen, bestimmte Diathesen und Aktionsarten an.
(25) ina tarbaṣ-im u-ša-bšû
Im Stall-GEN 3-Š(KAUS)-machen.PST-SBJV
‚Im Stall anrichtete (lit.: machen ließ).‘ (KH § 267)
Jedoch gibt es auch zahlreiche Nominalformen, die in diesen Stämmen vorkommen. Sind sie also von den Verbalformen abgeleitet?
(26) a) mu-šā-kil-um
PTZ-Š(KAUS)-essen-NOM
‚Futtermeister (lit.: der, der essen lässt oder: der, der füttert).‘ (GAG: 65)
b) dunnun-um
stark.sein.D.ADJ-NOM
‚verstärkt (bzw. ‚besonders stark‘)79. (GAG: 62)
In Grammatiken wird der Stativ zu den Verbalformen gerechnet, vielleicht weil er am häufigsten von deren Wurzeln gebildet wird.
(27) balṭ-āku
leben.STAT-1.STAT
‚Ich bin am Leben (lit.: Ich bin lebend).‘ (GAG: 101)
Jedoch kann man auch nominale Ausdrücke in den Stativ setzen. Der GAG nennt ihn sogar ein konjugiertes Nomen. Jedoch findet man den Stativ von Substantiven fast nur bei Personennamen, auch wird er nicht vom Infinitiv gebildet. Da der GAG den Stativ auch als Tempus bezeichnet, widerspräche dies der Aussage, dass Tempus nur an den Verbalformen vorkommt. Jedoch muss ich wiederum dieser Annahme widersprechen, denn der Stativ ist vom Sinn her ein Attribut80 und damit eher ‚adjektivisch‘.
Der Infinitiv ist die Form, nach der Verbalformen in den Grammatiken zitiert werden. Er ist jedoch nicht wirklich auf eine Wortklasse festgelegt und steht deshalb wie Stativ und Adjektiv etwas zwischen den Fronten. Je nachdem, wie man ihn erweitert, ist sein Sinn substantivisch, adjektivisch oder neutral. Mit einem abhängigen Genitiv ist er nominal, mit einem Objekt im Akkusativ oder Subjekt im Nominativ ist er verbal.
(28) u râm-ka lī-diš
KONJ lieben.INF.SC-2m.POSS PRK-erneuern.PST
A P
‚…und deine Liebe (lit: dein Lieben) möge sich erneuern.‘ (Wilcke 1985)
Schließlich gibt es noch das Partizip. Dieses ist adjektivisch oder substantivisch und somit nominal. Auch Endungen und Gebrauch sind gleich.
(29) nadin iddin-u-šum
geben.PTC 3.geben.PST-SBJV-3.DAT
‚der Verkäufer verkaufte ihm (lit: der Geber gab ihm).‘ (KH §10)
Besonders das Partizip ist ein Problem für die Theorie von S&S, sofern sie nicht die Zugehörigkeit zu zwei Wortklassen erlauben. Da S&S nicht die möglichen Überlegungen bezüglich Wurzeln zulassen, kann man sie entweder aufgrund ihrer Herkunft nur als Verb oder aufgrund ihrer Funktion und Distribution als nominal bezeichnen. Vielleicht noch schlimmer ist der Infinitiv, der auf keiner Seite klar steht, was aber für die Unterscheidung von Nominalen und Verbalen allgemein gilt. Wären diese Formen nicht, könnte man, sofern man die Wurzeln ignoriert, sehr gut eine Wortklasse der Verben anhand ihrer Besonderheiten wie Affixen und Tempora bilden.
Lässt man jedoch die Überlegungen bezüglich der Wurzeln zumindest ansatzweise zu, insofern als das im Groben scheinbar die verbalen und nominalen Formen von denselben stammen (können), wäre es auch möglich die drei Klassen als eine zusammenzufassen die jedoch drei große Subklassen hat.
Adverbien. Laut Definition von S&S unterteilen sich diese in viele Subklassen die nur gemeinsam haben, dass sie Modifikatoren (alles außer dem Substantiv) sind und oft phonetische Besonderheiten besitzen.
Zunächst zu dem letzten Kriterium: Phonetische Besonderheiten der Adverbien des Akkadischen lassen sich nicht ausmachen. Sie verwenden dieselben phonologischen Regeln und Phoneme wie die restliche Sprache. Das liegt unter anderem auch daran, dass sie größtenteils von anderen Wörtern abgeleitet werden, meist mit einem enklitischen Partikel oder dem Akkusativ-Kasus. Der GAG und andere Grammatiken ordnen sie auch gänzlich den Partikeln zu. Der Grund dafür ist, dass ein und dieselbe Form verschiedene syntaktische Funktionen haben kann, die man traditionell unterschiedliche Wortklassen nennen würde. Diese Klassen fassen die Grammatiken als Subklassen der Partikel zusammen.
Die ursprünglich abgeleiteten Formen sind rar und man könnte sie als geschlossene Klasse bezeichnen. Die Möglichkeiten aus Substantiven Adverbien abzuleiten sind aber nahezu unbegrenzt und schienen auch sehr produktiv zu sein, allerdings hauptsächlich in poetischen Texten und mit der Terminativ-Adverbial-Endung -iš. Diese erstellt hauptsächlich Modifikatoren für substantivische und verbale Ausdrücke und ließe sich im Deutschen mit -haft, -gleich und ähnlichem übersetzen (ochsenhaft, ochsengleich, rötlich, …). Einige Adverbien wie arḫiš ’schnell‘ kommen sehr häufig vor, jedoch leiten auch diese sich ab, meist von Adjektiven (arḫu ’schnell‘) oder Substantiven, wobei mindestens erstere81 sich jedoch problemlos auf ‚verbale‘ Wurzeln zurückführen lassen (arāḫu ’schnell sein, beeilen‘). Vermutlich nehmen die Grammatiken sie nur als eigenes Lexem auf, weil sie einigermaßen häufig sind. Auch ist die Menge dieser Lexeme, die man als fast schon festen Ausdruck bezeichnen kann, sehr gering.
Ließe man also außer acht, dass sie stets von anderen Wurzeln abgeleitet und mit einer speziellen Endung versehen wurden82, käme man trotzdem nur auf eine geschlossene kleine Klasse, die sich jedoch (fast) beliebig aus den Hauptklassen erweitern ließe. Insofern wäre diese Wortklasse unter den geschlossenen Klassen jedoch falsch.
Da die Menge der bereits erstarrten ursprünglich abgeleiteten adverbialen Ausdrücke gering ist, rechne ich sie trotzdem zu den geschlossenen Wortklassen – sofern man sie als abgeleitete Wörter überhaupt als eigenständige Klasse betrachten darf. Die Menge der produktiv abgeleiteten Formen ist aber schier unbegrenzt, weshalb ich hier noch kurz die entsprechenden Endungen aufzählen möchte:
-a(m) (Akkusativ) bildet Adverbien des Zeites und des Ortes.
-iš (Terminativ) bildet Adverbien von Adjektiven, Substantiven und Pronomen
-ānum bildet Adverbien meist von Pronomen.
-išam könnte eine Verbindung von –iš und -am sein, jedenfalls bildet es Adverbien des Ortes meist von Pronomen.
-attam bildet auch einige Adverbien.
Nun zur Kategorisierung. Am wichtigsten ist festzuhalten, dass die Adverbien keine offene sondern eine geschlossene Klasse darstellen, wenngleich sie produktiv durch Ableitungen erweiterbar sind. Sofern eine dieser Formen erstarrt im Lexikon blieb, wurde die Klasse dadurch noch erweitert, aber eine offene sollte man sie deshalb doch nicht nennen, da dies erst über lange Zeiträume und nicht so einfach wie bei ‚typischen‘ offenen Klassen geschieht. Die ‚richtigen‘ Adverbien sind extrem selten und definitiv geschlossen. Ob es Lehnwörter im Bereich der Adverbien gibt, ist mir unbekannt. Aufgrund der Tatsache, dass sie auch andere, meist präpositionale, Funktionen haben83, könnte man sie auch nicht einzeln als Adverbien betrachten, sondern mit diesen zusammenfassen. Mindestens Adverbien und Präpositionen wären dann also eine geschlossene Klasse und dabei gleichzeitig auch die größte. Abgeleitete Lexeme haben meist eine klar adverbiale oder präpositionale Bedeutung, die kleine Menge der ‚festen‘ Lexeme jedoch hat (fast) immer mindestens zwei Bedeutungen. Womöglich findet man hier doch eine Berechtigung für die größere geschlossene Klasse der Partikel mit ihren Subklassen, die die Grammatiken annehmen.
4.1.2. Die geschlossenen Klassen
Pro-Formen. Die knappe Definition von S&S zu den Pronomen lautet: Personal-Pronomen sind anaphorisch, wenn Referent bekannt, sonst emphatisch, sind oft Klitika und haben distributionelle Besonderheiten.
Zunächst mal: Tatsächlich unterscheidet das Akkadische zwischen selbständigen und enklitischen Formen. Erstere sind selten im Einsatz, da die Verbalform bereits Person usw. ausdrückt und sie deshalb nur emphatisch oder als selbständiges Argument benutzt werden.
(30) atta ta-lqe
Du.m 2-nehmen.PST
‚Du (selbst) nahmst.‘ (GAG: 40)
Ausnahme sind Nominalsätze, wo selbständige Pronomen als Prädikat fungieren.
(31) Ḫammurapi anāku
H. Ich
A P
‚Ich bin Hammurapi.‘ (KH Prolog)
Die 3. Person der selbständigen Personalpronomen soll vom anaphorischen Pronomen stammen und wird sowohl adjektivisch als auch substantivisch gebraucht.
(32) awīl-um šū i-d-dak
Bürger-NOM ANAPH 3-N-töten.PRS
‚Dieser (erwähnte) Bürger wird getötet.‘ (KH §3)
Die Pronomen kennen andere Kasus als die Nominalformen: Akkusativ und Genitiv sind ebenso vorhanden, der Nominativ nur eingeschränkt (auf die selbständigen Pronomen), Terminativ und Lokativ sind nicht vorhanden – dafür kennen sie einen Dativ.
(33)a) i-štanaḫiṭ-am84 kalbān-iš
3-anspringen.Gtn.PRS-1.DAT Hund-TERM
‚Er springt mich immer wieder an wie ein Hund.‘ (Wilcke 1985)
b) jašim
Mir
Die Affixe suffigieren an die Verbalform und sind nur nötig wenn ein anderer Kasus als der Nominativ gebraucht wird.
(34) i-dukk-ū–šu-ma i-ḫallal-ū–šu
3-töten.PRS-PL-3.AKK-KONJ 3-werfen.PRS-PL-3.AKK
‚töten sie ihn und werfen (sie ihn) hinein.‘ (KH §21)
Interrogativ-Pronomen sind laut S&S universal. Ob das stimmt kann nicht falsifiziert werden, denn tatsächlich hat das Akkadische welche. Sie sind entweder substantivisch oder adjektivisch, wobei erstere an ihrer Form erkennbar sind (mVnV), während das Adjektivische aus der Reihe fällt. Beide Formen können auch erweitert werden.
(35) ajj-iš libba-ka i-llak
wo-TERM Herz.SC-2m.POSS 3-gehen.PRS
‚Wohin geht dein Herz?‘ (Wilcke 1985)
Weitere Pronomen (nicht unbedingt Pronominal-Formen) sind die Demonstrativa, die zwei Deixis ausdrücken können und wie Substantive die normalen Kasus, Genus und Numerus haben. Jedoch können sie in keinem anderen Status stehen. Es gibt annû ‚hier‘ und ullû ‚dort‘. Diese sind jedoch eher Nominale: Sie nehmen Person, Genus, Numerus, Status und Possessiv-Suffixe. Meist stehen sie aber nicht frei, sondern als Attribut (adjektivisch) zu einem anderen Substantiv.
(36) a) annīt-ka
dieses.f.SC-2m.POSS
‚Dieses von dir.‘ (GAG: 46)
b) kalb-um ull-ûm
Hund-NOM jenes-NOM
‚jener Hund.‘ (konzipiert)
Indefinita ergeben sich aus einer Reduplikation bzw. Erweiterung von Demonstrativa oder Interrogativa. Auch sie verhalten sich substantivisch, können aber in keinem anderen Status stehen. Beispiele sind mamman ‚irgendwer‘ und ajjumma ‚irgendein‘.
(37) mimma šum-šu
irgendwas Name.SC-3.AKK
‚Was (auch immer) (lit.: Irgendwas (ist) sein Name.‘ (KH §7)
Schließlich spricht man noch von dem Determinativ-Pronomen. Dieses wirklich als Pronomen zu bezeichnen ist jedoch leicht fragwürdig. Ursprünglich mag es zwar solche Determinativa gegeben haben, von denen sich dieses Pronomen ableitete, jedoch sind seine Funktionen synchron syntaktisch und praktisch kaum noch pronominal, höchstens in der Übersetzung. Selten jedoch wird es auch als Ersatz für einen Hauptsatz bzw. ein Argument benutzt.
(38) amas-su ša mâr-ê u-ld-u-šum
Sklavin-3.POSS DET Kind-PL 3.-D.bären.PST-SBJV-3.DAT
’seine Sklavin, die ihm Kinder gebar.‘ (KH §119)
An Pro-Sätzen letztlich sind nur wenige Formen belegt, die sämtlich als Ellipse bezeichnet werden, welche Satzteile, die als bekannt gelten, weglassen. Dies kommt z.B. vor in Sätzen, die eine Antwort auf eine vorhergehende Frage sind, bei denen man die Wiederholung des Satzes auslässt. Auch sonst wird die Ellipse meist genutzt, um Wiederholungen zu vermeiden, gerne auch bei bekannten Redewendungen.
Im Bereich der Pronomen treffen also die meisten der Definitionen von S&S durchaus zu. Personal-Pronomen gibt es selbständig und suffigiert, wobei erstere meist emphatisch sind. Sie unterscheiden sich in Details von den normalen Nominal-Formen, vor allem aufgrund der Kasus. Auch die angeblich universalen Interrogativa findet man. Die anderen Pronominal-Formen gehören eng zusammen, da sie teilweise aufeinander aufbauen und sich wiederum von den Personal-Pronomen unterscheiden, als dass sie fast substantivisch (und adjektivisch) sind, jedoch die besonderen Stati vermissen lassen. Auch das Determinativ-Pronomen ist ein eigener Sonderfall, insofern es kaum pronominal sondern meist rein syntaktisch ist.
Nominal-Adjunkte wie Klassifikatoren, Quantoren, Rollenmarker (außer Kasus) und Artikel gibt es nicht. Die Artikel muss man aus dem Kontext und dem Kasus erschließen. Verbal-Adjunkte wie Auxiliare kommen auch nicht vor.
Konjunktionen sind Koordinationen, Subordinationen, Relativpartikel. Diese sind im Akkadischen durchaus gut vertreten. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie Hauptsätze miteinander oder Nebensätze mit Hauptsätzen verbinden; seltener auch einzelne Wörter miteinander.
Koordinationen: Das u erstellt keine logischen Zusammenhänge, verbindet aber zwei Formen als ‚und‘, ‚auch‘ oder seltener ‚aber‘. Das ū verbindet nur einzelne Wörter als ‚aber‘. Ganze Sätze in der Form ‚aber‘ verbindet dagegen das ū lū. Sätze als ‚entweder – oder‘ verbindet das ūlu – ūlu. Dasselbe gilt für einzelne Wörter mit lū – lū. Letztlich gibt es auch das Klitikum -ma, welches an Verbalformen gehängt eine logische Verbindung zu einer folgenden Verbalform erstellt.
(39) ṣên-ê u-ša-l-am-ma
Kleinvieh-PL 3-Š-gut.machen-VNT–KONJ
‚das Kleinvieh gut machen und… .‘ (KH § 267)
Subordinationen werden in der Akkadistik Subjunktionen genannt. Sie ersetzen einen Genitiv und stellen stattdessen einen gleichwertigen Satz in den ‚Subjunktiv‘ (mit -u an der Verbalform). Sie kommen größtenteils auch als Präposition vor. Beispiele für jede Form würden hier den Rahmen sprengen: inūma (als, wenn), ištu (als, nachdem, seit), kīma (als, wenn, dass, wie), aššum (weil, dass) – sind besonders häufig.
(40) inūma aḫḫ-ū i-zuzz-ū
wenn Bruder-PL 3-stehen.PRS-PL
‚Wenn die Brüder stehen.‘ (KH §165)
Im Akkadischen findet sich nur ein Relativpartikel, das aber sehr häufig verwendet wird. Laut den Grammatiken stammt es von dem Determinativ-Pronomen ab und wird teilweise auch immer noch so bezeichnet. Es drückt eine Zugehörigkeit (das des) im Sinne eines Genitivs oder auch einen anderen Nebensatz (dass) aus.
(41) Nudun-am ša mus-sa i-ddin-u-šim
Geschenk-AKK DET Ehemann-3f.POSS 3-geben.PST-SBJV-3f.DAT
‚Das Geschenk, welches ihr Ehemann ihr gab.‘ (KH §172)
S&S fassen diese drei Gruppen als eine Klasse zusammen, weil sie zwei Ausdrücke (Sätze und Wörter) miteinander verbinden. Davon abgesehen sind sie aber recht unterschiedlich in ihren Eigenschaften. Das Relativpronomen stammt vom Determinativ-Pronomen ab, die Subordinationen sind meist auch Präpositionen, die Koordinationen gleichen keinem anderen Partikel. Als einzelne Gruppen haben sie ihre Berechtigung, sollten aber nicht zu einer zusammengefasst werden. Die Subordinationen stehen den Präpositionen näher, die anderen dürften Subklassen der Partikel darstellen.
Klitika gibt es viele. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie zusammen mit einer anderen Form ein phonologisches Wort bilden und nicht alleine stehen können. Da die Klitika in ihren Funktionen aber meist mit anderen Wortklassen zusammenfallen, ist es fraglich, warum man sie als eigene Klasse ansehen sollte. Das häufigste und wichtigste Klitikum ist das -ma. Es begegnet einem eigentlich pausenlos und hat zahlreiche Funktionen. Besonders häufig fungiert es als Konjunktion, wenn es sich an einer Verbalform befindet. Im Gegensatz zu den anderen Konjunktionen stellt es dabei eine logische Verbindung her. Auch an Prädikate von Nominalsätzen wird es öfters gehängt. Manchmal benutzt man es einfach als Topikalisierer oder Betonungspartikel. Und schließlich formt es aus Frage-Pronomina Indefinit-Pronomina. Die ähnliche Partikel -mā dient als Question-Marker.
(42) irabbiṣū–mā
G.NPST.PL-Q
‚werden sie sich lagern?‘ (GAG)
-mi kommt auch hin und wieder vor, um in Texten – und vermutlich auch der normalen Sprache – eine wörtliche Rede zu markieren.
Klitika allein aufgrund syntaktischer und phonologischer Besonderheiten als eigene Klasse anzusehen, ist kaum gerechtfertigt. Als Subklasse eventuell. Da sie jedoch allesamt andere Funktionen ausüben und abgesehen von ihrer Form als Klitika wenig gemein haben, sind sie in anderen Klassen besser aufgehoben: -ma ist eine Koordination, die anderen erfüllen Rollen mit denen sie relativ allein stehen. Sie alle sollten zu den einfachen Partikeln gezählt werden, eventuell jeweils mit einer eigenen Subklasse.
Emphatische Partikel. Solche hat das Akkadische nur wenige. Die enklitische Partikel -ma zur Betonung kennen wir schon. Eine zweite, vor allem in Königsinschriften oder zur Beteuerung eingesetztes Partikel ist das lū, welches man mit ‚wahrhaftig‘ oder ‚fürwahr‘ übersetzen kann und eine Verbalform betont. Davon abgesehen hat die Partikel vor allem aber eine wichtige Funktion um Prekative zu bilden.
(43) anāku lū šarr-um
Ich PTCL König-NOM
‚Ich bin wahrhaftig der König.‘ (GAG: 205)
Die beiden emphatischen Partikel lassen sich gut als Subklasse mit anderen einfachen Partikeln zusammenfassen.
Negationen. Im Akkadischen wird strikt zwischen zwei Arten von Negationen unterschieden. Die erste, lā, negiert einzelne Satzteile und Wörter, ist die Negation von Nebensätzen, Prohibitiven und Wortfragen. Dagegen dient ul für ganze Sätze. Beide gibt es auch verdoppelt als ‚weder x – noch y‘.
(44) ana wardut-im ul i-raggum
zu Knechtschaft-GEN NEG 3-Anspruch.erheben.PRS
‚(darf) nicht zur Knechtschaft verpflichten.‘ (KH §175)
Weiter gibt es auch noch die Negationen aj und ē, die jedoch nur im Vetitiv verwendet werden. Negationen sollten aufgrund ihrer geringen Zahl als Subklasse der einfachen Partikel gesehen werden.
Interjektionen. Diese in einer toten Sprache zu finden gestaltet sich immer schwierig, doch zählen die Grammatiken einige auf. Die meisten sind erstarrte Kurzsätze oder Verbalformen. Interessanterweise wird auch eine sumerische Verbalform genutzt. Nur bei einem ist die Herkunft unklar: aḫulāp ‚genug!‘. In Texten die nicht gerade umgangssprachliche Briefe oder eine Geschichte sehr anschaulich schildern, begegnet man so etwas aber extrem selten. Das ē ‚he!‘ scheint einer ‚richtigen Interjektion‘ noch am nächsten zu kommen. Man kann sie als eigene Klasse ansehen, doch da ihre Zahl gering und ‚richtige‘ Interjektionen kaum bekannt sind, wäre es vielleicht gerechtfertigter, sie als Subklasse der Partikel anzusehen.
Modalpartikel. Diese zählt zumindest der GAG zu den Interjektionen. Viele sind es auch nicht: anna ‚Ja‘, ulla ’nein‘. Eventuell könnte man noch agana ‚wohlan‘ und ajji ‚wehe!‘ hinzuzählen. Weitere sind qišam ‚gewiss‘ und pīqat ‚vielleicht‘. Da sie zahlenmäßig schwach sind, sollte man diese Klasse als Subklasse zusammen mit Partikeln zählen.
Präpositionen. Von S&S werden diese nicht erwähnt, dabei sind sie neben den Adverbien die größte der geschlossenen Klassen. Wie geschildert gibt es kaum reine Präpositionen, sondern die meisten nehmen noch andere Aufgaben war, wie z.B. Subordination. Weiterhin kann man unterscheiden zwischen den eigentlichen und einfachen Präpositionen und präpositionalen Ausdrücken. Letztere werden ähnlich wie die Adverbien aus anderen Wortklassen abgeleitet, meist dabei mit einer ‚richtigen‘ Präposition. Alle Präposition regieren den Genitiv, woran man sie gut erkennen kann.
Die ‚richtigen‘ Präposition stammen laut GAG von Deuteelementen und haben eine Vielfalt von präpositionalen Funktionen. ina ist meist lokativ (in, an), seltener instrumental (mit), noch seltener partitiv (unter) oder ablativ (von). Das Gegenstück ana ist meist allativ (nach, zu), temporal (bis) oder kausal (zwecks). Das ina ist wesentlich häufiger.
(45) ina qāt mu-šeniḫ-t-im i-mtut
in Hand.SC PTC-pflegen-f-GEN 3-G.PF.sterben.PST
‚In der Hand der Amme starb (er).‘ (KH §194)
Weitere häufige Präposition sind kīma ‚wie‘, lāma ‚vor‘, adi ‚bis‘, ištu ‚von, seit‘, eli ‚auf, über‘, itti ‚mit‘, mala ‚entsprechend‘, aššum ‚wegen‘.
(46) adi balṭ-at
bis leben-STAT.3f
‚Solang sie lebt.‘ (KH §181)
Die zusammengesetzten Präpositionen bestehen aus einer substantivischen (?85) Wurzel samt adverbialer Endung oder dem adverbialen Akkusativ oder werden mit einer anderen Präposition gebildet. So gibt es warkānum ’nach‘, qerbēnum ‚innerhalb‘, ullânu ‚außer‘ von anderen Wurzeln; ina libbi ‚innerhalb (wörtl.: im Herzen), ana libbi ‚hinein‘, ina muḫḫi ‚auf, über (wörtl.: auf den Schädel) usw.
(47) warkānum amt-um šī itti bēlti-ša u-šta-ta-mḫir
nach Dienerin-NOM ANAPH mit Herrin-3f.POSS 3-Št-PF-konfrontieren.PST
‚…später diese Dienerin (sich) mit ihrer Herrin ranggleich macht…‘ (KH §146)
Egal, ob zusammengesetzt oder einfach; gemein ist den Präpositionen allen, dass sie eine folgende nominale Genitivform regieren. Aus diesem Grunde kann man sie mindestens als Subklasse zusammenfassen. Da viele von ihnen auch adverbiale oder koordinierende Funktionen ausüben, sollte man sie mit diesen Klassen zu einer Wortklasse zusammenfassen.
Numerale. Diese scheinen von S&S gar nicht erwähnt zu werden. Man kann sie auf den ersten Blick nur schwer als offen oder geschlossen bezeichnen, da ihre eigentliche logische Anzahl unendlich ist, jedoch die Anzahl der für Komplexa zusammenfügbaren Grundelemente (und vor allem auch die Textbelege) sehr begrenzt sind. Da sie auch nur sehr schwer (wenn nicht gar unmöglich) Lehnwörter und Neubildungen bekommen, würde ich sie als geschlossen bezeichnen, auch wenn sie mehrere Subklassen haben (Kardinale, Ordinale, Multiplikativa, Bruchzahlen, Zahladjektive). Nun scheinen sie aber ausgerechnet vom Verhalten her nominal zu sein, also enge Verbindungen zu den offenen Klassen zu haben – was für Pronomen aber auch gilt. Sie können in zwei Stati stehen (jedoch nicht in drei!) und sie können beide Genera anzeigen.
(48) a) kīma apl-im ištēn
wie Erbe-GEN 1.m.SA
‚Wie ein einziger Erbe.‘ (KH §137)
b) samāne šanātim
8.f.SA Jahr-GEN
‚8 Jahre.‘ (GAG: 194)
c) ištēnum
1.SR
Sie können auch adjektivisch sein, wie ištēnûm ‚einzeln‘. Wenngleich man auch sagen kann, dass dies Adjektive sind, die von den Numeralia abgeleitet wurden, also zu den Adjektiven gehören.
Jedoch ist ihre Besonderheit, dass sie allein Multiplikativa bilden und als Zeitangabe geschrieben werden.
(49) seb-î-šu
7-ADV-3.POSS
‚Siebenfach (lit.: sein siebtes.)‘ (GAG: 94)
4.1.3. Fazit
Schachter & Shopen unterscheiden in ihrer Theorie zwischen offenen und geschlossenen Wortklassen, für die sie jeweils relativ klare Definitionen liefern.
Im Bereich der geschlossenen Klassen treffen diese Definitionen noch einigermaßen gut zu, besonders bei den Pro-Formen. Die Partikel sind eventuell ein wenig zu stark differenziert, vor allem Klitika passen aufgrund ihrer Funktionen besser in andere Klassen. Womöglich sollte man aber diese Partikel, deren Umfang eh sehr gering ist, zu einer Klasse zusammenfassen: den Partikeln, womit wir den Grammatiken hier im Groben Recht geben. Schwierig wird es mit den Präpositionen, die ganz offensichtlich eine geschlossene Klasse bilden, jedoch viel mit den Adverbien und auch Subjunktionen gemeinsam haben. Nimmt man die von S&S aufgestellten Wortklassen hier nicht als Haupt- sondern als Subklassen, ist es leichter zu akzeptieren, dass einzelne Lexeme mehreren Klassen zugehören. Demnach hätten wir eine kleine Gruppe Partikel und eine größere geschlossene Klasse von Präpositionen und Adverbien.
Ein weiteres Problem ist die Klasse der Konjunktionen. Funktional gehören Koordinatoren und Subordinatoren eng zusammen, jedoch gibt es schon syntaktisch einen Unterschied, da erstere gleichrangige Sätze verbinden, derweil zweitere Neben- und Hauptsätze verbinden und den Nebensatz dabei in den Subjunktiv setzen – und außerdem haben die gleichen Lexeme meist auch präpositionale oder adverbiale Funktionen. Deshalb würde ich die Subordinatoren zu Präpositionen und Adverbien zählen, derweil Koordinatoren entweder eine eigene Klasse bilden, oder – wenn man den Grammatiken folgt – sie auch zu den Partikeln rechnen. Diese ‚einfachen‘ Partikel sowie Präpositionen, Adverbien und Subordinatoren zusammenzufassen, wäre aber wohl ein wenig ‚zu viel‘ des Guten, vor allem, da sie nur noch wenig gemeinsam haben. Da stimme ich den Grammatiken also nicht zu. Ein letztes Problem sind vielleicht die Numeralien, aber nur auf den ersten Blick. Diese haben viel gemeinsam mit den Nominalen. Stati und Genus bekommen sie aber nur in Kongruenz – und ihre Adjektive sind abgeleitet -, weshalb das noch kein Argument ist sie dort hinzuzurechnen. Da sie auch kaum erweiterbar sind/waren, rechne ich sie zu den geschlossenen Klassen.
Die offenen Klassen bereiten aber bei genauer Betrachtung der Theorie von S&S Probleme – doch dies noch nicht auf den ersten Blick. Zunächst einmal findet man nämlich viele der Definitionen und Kriterien von S&S erfüllt. Substantive mit Kasus, Genus, Numerus sowie im Akkadischen auch mit Stati; Adjektive in Kongruenz zu ihnen als ihre Modifikatoren; Verbalformen mit TAM, Aktionsarten, Diathesen. Formen wie Infinitiv, Partizip und Stativ können sie aber nur als klassenübergreifend bezeichnen und die Besonderheit des Systems von Wurzeln, die je nach Form eine andere Bedeutung haben nicht erklären.
4.2. Hengeveld: flexibel oder nicht?
Hengeveld erschuf ein System der in der Welt vorhandenen Sprachen; jetzt ist es an der Zeit zu sehen, welcher Typ das Akkadische ist und ob es überhaupt in dieses System passt.
Zur Identifizierung von Wortklassen sind bei Hengeveld syntaktische Slots das Entscheidende. Morphologie darf nur der Identifikation dienen; auch wird nur die Basis eines Wortes betrachtet. Es wird also der sogenannte Stamm betrachtet, nicht klassenverändernde Affixe. Hiermit sieht man sich auch wieder mit dem ersten Problem konfrontiert: der Stamm. In der Semitistik wird zwischen Stamm und Wurzel unterschieden: die Wurzel trägt die Bedeutung, derweil der Stamm die Grundform eines noch zu bildenden Wortes ist. Wenn Hengeveld also vom Stamm ausgehen möchte, übersieht auch er die Ambiguität der bloßen Wurzel.
Weiter wichtig ist, dass im Akkadischen kaum Affixe eine Klassenänderung herbeiführen, sondern vor allem die Form eines Ausdrucks. Stämme werden hier wohl die normalen temporalen finiten Verbalformen sowie nominale Ausdrücke ohne Endungen sein86. Insofern gehören dann auch nominal benutzte Verbalformen zu letzteren.
4.2.1. Die Wortklassen
Verben definiert Hengeveld als Kopf einer Prädikatsphrase. Wichtig ist hierbei die Erweiterung, dass sie nur Kopf einer Prädikatsphrase sein können, sonst nichts.
Denn was kann alles im Akkadischen Prädikat sein? In Nominalphrasen sind Prädikate jeweils eine Nominalform oder eine ganze weitere Phrase. Phrasen kommen nicht in Betracht und Nominalformen können auch anderes als bloß Kopf einer Prädikatsphrase sein. Außerdem stehen sie dann immer in einer anderen Form, z.B. Substantive im Status Rectus (ohne Endungen).
Weiterhin können auch Adverbien Prädikat sein. Als erstes muss man sich festlegen, ob die Adverbien nun abgeleitete Verbalformen oder eine eigenständige Klasse sind. Sind sie zweiteres, bedeutet dies, dass auch Adverbien Prädikat sein können (s.u.). Da Hengeveld abgeleitete Formen nicht in Betracht zieht, kann nur Fall 2 zutreffen. Weil sie aber auch andere Funktionen haben, fallen sie trotzdem raus.
Auch Pronomen können Prädikat sein, sogar recht häufig. Jedoch sind sie meist eher Kopf einer referentiellen Phrase (s.u.).
(50) Ḫammurapi anāku
H. Ich
‚Ich bin Hammurapi.‘ (KH Prolog)
In Verbalsätzen ist das Prädikat eine Verbalform. Die Wortstellung ist einigermaßen fix und nur in der Poesie wirklich frei, trotzdem ist es ein häufiger Fehler zu glauben, dass die Verbalform immer am Satzende zu finden ist, wenngleich der GAG sagt, dass das Prädikat „fast ausnahmslos am Ende des Satzes steht“ (GAG: 183). Nicht immer reicht allein die Wortstellung zur Identifizierung, denn sie kann auch zur Betonung verändert werden. Das Prädikat zeigt Kongruenz mit dem Subjekt.
(51) tarbit-um šī ana bît ab-i-šu i-tar
Ziehsohn-NOM ANAPH zum Haus.SC Vater-GEN-3.POSS 3-zurückkehren.PRS
‚wird dieser Ziehsohn zum Haus seines Vaters zurückkehren.‘ (KH §189)
Das erste Gegenbeispiel ist, dass auch Nominale in den Stativ gesetzt werden können und damit eine Prädikatsposition in einem Verbalsatz einnehmen, wenn man den Stativ als Verbalform ansieht. Die Grammatiken bezeichnen den Stativ zumindest als verbale Form. Was vielleicht aus der Nutzung einer Kopula in der Übersetzung herrührt.
(52) zikar-āku
Mann.SC-STV.1SG
‚Ich bin ein Mann.‘ (GAG: 100)
Jedoch ist dies auch kein Argument, denn der Stativ scheint eine Erweiterung des Stammes zu sein, die wir bei der Betrachtung außer Acht lassen müssen.
Die Frage ist, ob der Infinitiv hier zählt oder nicht, denn auch er kann Prädikat sein. In dem Fall ist seine Bedeutung aber verbal und er kein Gegenargument gegen eine Klasse von Verben. Es ist nur deshalb die Frage, weil er nicht wie die normalen verbalen Formen geformt ist sondern eine andere Form hat. Man kann also entweder sagen, dass er als abgeleitete Form gar nicht zählt oder aufgrund seiner auch referentiellen Möglichkeiten ein Substantiv ist (s.u.). Da Verben nur Prädikat sind, ist der Infinitiv ein Substantiv.
(53) u râm-ka lī-diš
KONJ lieben.INF.SC-2m.POSS PRK-erneuern.PST
‚…und deine Liebe (lit: dein Lieben) möge sich erneuern.‘ (Wilcke 1985)
Partizipien fallen als Gegenbeispiel ebenso heraus, da sie zwar Prädikat sein können, aber selbst wenn man sie als eigenständige Formen zulässt und nicht als Unterform verbaler Formen ansieht ist ihre eigentliche Verwendungsweise referentiell (s.u.).
Substantive definiert er als Kopf einer referentiellen Phrase, was andere Autoren vielleicht Nominalphrase nennen würden87. Wie wir ja schon wissen, gibt es im Akkadischen Nominalsätze, bei denen allesamt ein nominaler Ausdruck Kopf der Phrase ist88. Mehrere Arten von Ausdrücken kommen hier in Betracht: Substantive, Partizipien, Infinitive sowie eigenständige Pronomen.
(54) a) anākū-ma rē‚-ûm mu-ša-llim-um
Ich Hirte-NOM PTZ-Š-heil.bringen.PTZ-NOM
‚Ich bin der heilbringende Hirte.89‚ (KH Prolog)
b) pāris puruss-ê
PTZ.trennen.SC D.PTZ.trennen-GEN
‚der Entscheidungen-Entscheidene.90‚ (GAG: 201)
c) šu-lput māti-šu
Š-INF.stürzen.SC Land.SC-3m.POSS
‚Das Stürzen seines Landes.‘ (KH Epilog)
d) Ḫammurapi anāku
H. Ich
‚Ich bin Hammurapi.‘ (KH Prolog)
Gegenbeispiele scheint es keine zu geben. Wenn Infinitive und Partizipien aufgrund ihrer veränderten Form aus der Bewertung herausfallen, bleiben nur Substantive und Pronomen. Wenn nicht, muss man die anderen, sonst ‚verbal‘ genannten Formen nun als Substantiv betrachten, wobei es bei den Partizipien weitere Probleme gibt (s.u.). Ein solches sind auch Numeralia, sofern eine geschlossene Klasse mit in Betrachtung kommt. Denn sie können sowohl substantivisch als auch adjektivisch sein.
(55) ištēn-um
1.m-NOM
S
‚Der Eine.‘ (GAG: 91)
šalašt ūm-ī
3.SA.f Tag-PL.OBL
Mod S
‚Die drei Tage.‘ (GAG: 91)
Adjektive modifizieren eine referentielle Phrase. Im Akkadischen werden referentielle Phrasen durch Attribute modifiziert, die entweder adjektivisch oder numeral oder eine ganze Relativphrase sind. Letztere fallen aus unserer Betrachtung hinaus. Morphologisch erkennbar sind Attribute dadurch, dass sie in Genus, Numerus und Kasus mit dem Modifizierten kongruieren. Syntaktisch stehen sie hinter dem Modifizierten, sofern der Modifikator nicht extra betont wird. Im Gegensatz zu den Attributen stehen die erklärenden Appositionen und die genitivische Annexion. Beide modifizieren die referentielle Phrase nicht im eigentlichen Sinne, sondern erweitern sie.
(56) šum-šu ṣir-am
Name.SC-3.POSS erhaben-AKK
’sein erhabener Name.‘ (KH Prolog)
šalašt ūm-ī
3.SA.f Tag-PL.OBL
‚Die drei Tage.‘ (GAG: 91)
Die akkadischen Adjektive sind nach Hengeveld tatsächlich Adjektive, auch wenn ihre semantisch ambigen Wurzeln dabei ignoriert werden. Andere ‚adjektivische‘ Ausdrücke sind abgeleitete Numeralia und der Stativ, die aber eben aufgrund ihrer Abgeleitetheit hier keine Möglichkeit darstellen. Das Problem: Auch Adverbien können Nominalphrasen modifizieren, während Adjektive nur solche modifizieren.
(57) ṣibûtum mādiš
Bedürfnis-NOM groß (bzw.: groß.sein-TERM)
‚Das Bedürfnis ist groß.‘ (GAG)
Und letztlich: wenn man Adjektive nicht als Grundwörter sondern aufgrund ihrer Nominalform als abgeleitet betrachtet, wären die Adverbien sogar die einzigen Modifikatoren. Wenn man das tut, würde man aber wohl auch die Adverbien als abgeleitet ansehen und damit gäbe es gar keine nicht-abgeleiteten Modifikatoren. Da die Wurzeln hier aber ignoriert werden, gibt es eine Klasse Adjektive.
Adverbien modifizieren eine Prädikatsphrase. Adverbiale Lexeme brauchen teils eine Präposition, teils nicht. Da eine Wortklasse dabei nicht verändert zu werden scheint, kommen sie beide in Betracht; jedenfalls, solange man die adverbialen Formen nicht als abgeleitet ansieht. Einige bestimmen eine ganze Prädikatsphrase und stehen (sofern nicht anders betont) am Satzbeginn.
(58) šapal-šu Idiglat nār-um
unter-3m.SG Tigris Fluss-NOM
‚Unter ihm der Tigris-Fluss.91‚ (Wilcke 1985)
Andere betonen einzelne Wörter und folgen diesen. Das Problem hierbei: Adverbien können auch Nominalphrasen modifizieren (s.o.).
Damit eine Wortklasse nach Hengeveld flexibel ist, muss sie die Funktion von mindestens einer weiteren übernehmen. Sie ist dann semantisch und kategoriell vage und wird durch Kontext und syntaktische Slots definiert. Finden sich im Akkadischen Formen, die semantisch vage sind? – Eigentlich kann man dies nur von Wurzeln sagen, denn ihre jeweilige Form hat sie bereits disambiguiert. Einige Partikel könnte man als vage bezeichnen, ohne bestimmenden Kontext. Ansonsten gäbe es als Kandidaten lediglich die Adverbien, die beide Arten von Phrasen modifizieren können.
4.2.2. Die Einordnung ins System
Verben wurden klar identifiziert – sie können nur Prädikat sein.
Substantive wurden auch identifiziert. Selbst wenn man die Infinitive hier als Substantiv aufnimmt, bedeutet das keinen Bruch mit der Theorie, wenn sie auch Prädikat sein können, denn Substantive werden nicht nur als Argument definiert.
Adjektive gibt es, sofern man sie nicht als abgeleitete Formen betrachtet, was man dann aber auch für Substantive (teilweise?) tun müsste.
Adverbien gibt es auch, jedoch können sie Modifikator beider Arten von Phrasen sein.
Zunächst in Hengevelds altem System.
|
Möglichkeit 1: Verben, Substantive, Adjektive, Adverbien – Typ 4 rigides System. |
|
Möglichkeit 2: Verben, Substantive, keine Adjektive da abgeleitet, Modifikatoren – Typ 3 flexibles System. |
|
(Möglichkeit 3: Verben und Nicht-Verben – Typ 2 flexibles System. Dies dürfte aber nicht möglich sein, da es a) mindestens eine kleine Anzahl ‚richtiger‘ Substantive geben müsste und b) es trotzdem eine kleine Gruppe nicht-abgeleiteter Adverbien gibt. Diese mit den anderen Formen zu vermischen wäre zu viel.) |
Da mir kein Adjektiv unterkam, dass ich nicht als Ableitung von einer Verbalform betrachten würde, bevorzuge ich Möglichkeit 2, nach Hengeveld wäre es aber 1, also Typ 4.
Und nun zu seinem zweiten System.
|
Möglichkeit 1: Verben, Substantive, Adjektive, Adverbien – Typ 4 rigides System. |
|
Möglichkeit 2: Verben, Substantive, Adjektive und eine kleine Gruppe ‚richtiger‘ Adverbien – Typ 4/5 rigides System. |
|
Möglichkeit 3: Verben, Substantive, Modifikatoren mit einer kleinen Gruppe Adverbien – Typ 3/4 flexibles System. |
|
Möglichkeit 4: Verben, Substantive, Modifikatoren – Typ 3 flexibles System. |
|
Möglichkeit 5: Verben, Nicht-Verben und eine kleine Gruppe Modifikatoren. – Typ 2/3 flexibles System. |
|
(Möglichkeit 6: Verben und Nicht-Verben – Typ 2 flexibles System) |
Feststellen lässt sich, dass das Akkadische zumindest eine kleine Gruppe echter Adverbien und wohl auch echter Substantive hat. Da wir von den Wurzeln aber sowieso nicht ausgehen können in Hengevelds Theorie, bleiben also eine große Gruppe Substantive und mindestens eine kleine Gruppe Adverbien. Abgeleitete Formen haben nicht unbedingt weniger Möglichkeiten als ihre Basisform (so nach der Definition von Hengeveld), weshalb ein flexibles Zwischensystem wohl nicht in Frage kommt. – Auch hier lande ich bei Typ 3 (bzw. Typ 4, wenn man die Adjektive als ‚echt‘ zählt – aber das würde die Flexiblität der Adverbien nicht erklären), nach Hengeveld bei 4/5 bzw. 3/4.
4.2.3. Fazit
Berücksichtigt man alle Möglichkeiten, kommt die Theorie von Hengeveld überraschend gut damit klar, das Akkadische als Typus einzuordnen, ohne dass es zu größeren Schwierigkeiten kommt. Jedoch muss man hierfür vieles übergehen und übersehen und kann die ganzen Feinheiten – besonders der ambigen Wurzeln und solche erweiterten Formen wie das Partizip und den Infinitiv – nicht wirklich erklären. Aber dafür kann man die Sprache gut in eine Schublade pressen.
Bei Croft werden wir dies anders angehen und markierte und unmarkierte Wortklassen finden und überprüfen und zu Prototypen und abweichenden Formen kommen.
4.3. Croft: prototypisch und nicht-prototypisch
4.3.1. Die unmarkierten Wortklassen
Unmarkiert sind Substantive (N) als Referenten von Objekten, Verben (V) als Prädikat einer Handlung, Adjektive als Modifikator einer Eigenschaft. Sie haben mindestens soviel grammatisches Verhalten wie markierte Klassen.
Objektreferenten – Viele Substantive referieren auf Objekte. Beispiele sind pûm ‚Mund‘, kalbum ‚Hund‘, muḫḫum ‚Schädel‘. Objekte können greifbar sein, wie eqlum ‚Feld‘ oder abstrakt wie malkum ‚Rat‘, lebendig oder unbelebt. Auch die Partizipien sind für gewöhnlich Referenten, allerdings meist Handlungsreferenten, wenngleich einige Partizipien sehr ‚greifbar‘ scheinen, wie z.B. nādinum ‚Verkäufer, wobei hier die eigentliche Bedeutung aber ‚der, der gibt‘ ist, also auch ein Handlungsreferent.
(59) šumma awīl-um bīt-am i-pluš
Wenn Bürger-NOM Haus-AKK 3-einbrechen.PST
S O P
‚Wenn ein Bürger in ein Haus einbricht (lit.: einbrach)92.‘ (KH §21)
Handlungsprädikate – Typische Verbalformen beschreiben eine Handlung, wie iprus ‚er trennte ab (bzw. er entschied)‘. Viele beschreiben aber auch einen Zustand, wie irbib ‚er war schwach (auch: er war unterwürfig)‘. Nach Croft sind dies ‚prädikative Adjektive‘, keine Handlung. Wie so oft ist der Infinitiv ein Problem, denn er kann auch ein Handlungsprädikat sein, dessen Übersetzung dann je nach Kontext eines der drei Tempora ausdrückt. Jedoch tritt er vor allem als Handlungsreferent auf.
(60) a) šumma awīl-um i-ggar
wenn Bürger-NOM 3-mieten.PST
‚Wenn ein Bürger (etwas) mieten will (lit: mietete).‘ (KH §274)
b) ana māt-im ūs-im šū-ḫuz-im
um Land-GEN Führung-GEN Š-nehmen.INF-GEN
‚Um dem Land Führung zu geben93.‘ (KH Prolog)
Eigenschaftsmodifikatoren – adjektivische Formen bestimmen ausschließlich eine Eigenschaft näher, wie z.B. damqum ‚gut‘. Jedoch modifiziert auch der Stativ das Subjekt. Als Abform des Verbes wären sie aber eine prädikative Eigenschaft. Problematischerweise kann auch (selten) ein Substantiv im Stativ stehen; wäre dann also ein modifizierendes Objekt.
4.3.2. Die markierten Wortklassen
Markiert sind deadjektivierte Substantive als Referent einer Eigenschaft sowie Aktions-Substantive, Infinitive und Komplemente als Referent einer Handlung; Genitive, Adjektivisierer und Präpositionalphrasen als Objektmodifikator sowie Partizipien und Relativsätze als modifizierende Handlung; prädikative Substantive und Adjektive sowie Kopula als prädikative Objekte bzw. Eigenschaften – so Croft.
Eigenschaftsreferenten – Tatsächlich gibt es einige Eigenschaften, die referieren, wie sāmtu ‚Röte‘ von siāmu ‚rot sein‘ bzw. sāmu ‚rot, braun‘, und werden mit Hilfe des Feminins -t- als Abstrahierer gebildet.
(61) ṣuḫār-um
Kleiner-NOM
‚der Kleine94 (o.: der Diener).‘ (GAG: 61)
Handlungsreferenten – Diese sind sehr beliebt im Akkadischen. An erster Stelle käme hier das Partizip, dass aber auch Modifikator sein kann.
(62) wāšib maḫar šarr-im
sitzen.PTZ.SC vor König-GEN
‚der Sitzende vor dem König (der vor dem König Sitzende).‘ (GAG: 201)
Auch Infinitive sind tatsächlich hauptsächlich Handlungsreferent.
(63) ana šanīt-im aḫāz-im
zum jemand.anders-GEN nehmen.INF-GEN
‚eine andere zu nehmen.‘ (KH §148)
Objektmodifikatoren – Substantive können in den Stativ gesetzt werden, wenngleich es selten geschieht. Die Frage ist aber, ob man sie als Modifikator oder Prädikat betrachtet. Semantisch modifizieren sie einerseits – andererseits kann man sie auch als referierend ansehen. Klarheit hätte hier nur eine Befragung der Sprecher ergeben.
(64) sinniš-a
Frau-STAT.3
‚(Sie) sind Frauen.‘ (GAG: 100)
Einen leicht zu identifizierenden Adjektivisierer gibt es nicht, jedoch lassen sich viele Wurzeln in eine adjektivische Nominalform setzen. Das Problem der Frage, ob es sich hierbei dann ursprünglich um Adjektive oder abgeleitete Adjektive handelt, ist bekannt. Eine Einordnung folgt hierbei den Annahmen, die man zu treffen bereit ist.
Präpositionalphrasen im Korpus zu finden ist auch nicht schwer.
(65) ina ḫall-ī-ja
auf Hüfte-PL-1.POSS
‚Auf meine Hüften.‘ (Wilcke 1985)
Letztlich gibt es noch Genitive, die häufig genutzt werden. Eigentlich drücken sie ein Besitzverhältnis aus; man kann sie auch als Modifikator eines Objektes betrachten.
(66) ina muḫḫi nūn-im warq-im
Im Schädel.SC Fisch-GEN grüngelb-GEN95
‚Im Schädel des grünen/gelben Fisches.‘ (Wilcke 1985)
Handlungsmodifikatoren – Tatsächlich werden Partizipien (die von einer Handlung gebildet werden) häufig adjektivisch als Modifikator genutzt, doch ist ihre Hauptfunktion die referierende. Und auch Relativsätze, gebildet mit dem Determinativ-Pronomen, gibt es zuhauf. Auf diese Weise modifiziert auch eine Handlung.
(67) ša a-prus-u
DET 1-trennen.PST-SBJV
‚welche ich entschied.‘ (KH Epilog)
Letztlich kann auch der Stativ von einer Verbalform gebildet werden, womit sie dann eine modifizierende Handlung ist.
(68) balṭ-āku
leben.STAT-1.STAT
‚Ich bin am Leben.‘ (GAG: 101)
Objektprädikate – Wie gesagt können Substantive in den Stativ gesetzt werden und es ist eine Frage der Interpretation, ob sie dann eine prädikative oder modifizierende Form darstellen.
(69) sinniš-a
Frau-STAT.3
‚Sie sind Frauen.‘ (GAG: 100)
Eigenschaftsprädikate – Wenn der GAG Recht damit hat, dass von Adjektiven Verben abgeleitet werden, so fallen sie (statische Verben) in diese Kategorie. Aber per Definition sind sowieso alle Zustandsverben solche Eigenschaftsprädikate, weshalb der Streit, ob Adjektive oder Verben zuerst da waren, hier entfallen kann.
(70) li-ḫdû libbu-ki
PRK-glücklich.sein.PST Herz-2.POSS
‚Möge dein Herz glücklich sein.96‚ (Wilcke 1985)
Da es im Akkadischen keine Kopula gibt, entfällt diese semantische Möglichkeit.
4.3.3. Die semantischen Prototypen
Prototypen haben einen universellen Kern einer Kategorie, derweil ihre Grenzen unscharf sind. Semantische Klassen werden durch vier semantische Eigenschaften definiert: Relationalität (ob die Definition eines Konzepts Referenz zu einem anderen Konzept benötigt), Stativität (ob das Konzept Status oder Prozess beschreibt), Zeitlichkeit (welchen Zeitstatus das Konzept hat), Graduierbarkeit (ob es skalar graduiert wird).
Objekte sind nicht relational, sind statisch, permanent und nicht graduierbar.
Im Akkadischen können substantivische Formen allein stehen, ohne dass eine andere Form benötigt wird, also sind sie nicht relational. Auch Partizipien und Infinitive können alleine stehen.
(71) Kalb-um
Hund-NOM
‚Der Hund.‘
ālik-um
gehen.PTZ-NOM
‚Der Wanderer.‘
Stative und Verbalformen können zwar (optisch) allein stehen, haben jedoch ein (verdecktes) semantisches Subjekt, das beim Stativ und optional beim Verb mit Affixen gekennzeichnet wird. Auch Pronomen beziehen sich eigentlich auf ein anderes Objekt, können aber allein stehen und die Frage ist, ob sie sich nicht nur in derselben Weise auf ein Konzept beziehen wie es Substantive tun. Adjektive, Adverbien und andere Partikel können sich nur auf ein anderes Objekt bzw. eine Handlung beziehen.
Substantive sind statisch, egal ob konkret oder abstrakt. Partizipien und Infinitive dagegen können prozesshaft sein, besonders wenn sie von einer entsprechenden Verbalwurzel abstammen. Hierin zeigen sie also schon, wie sie sich vom Prototypen entfernen. Pronomen wiederum sind ebenso statisch.
(72) ālik-um
gehen.PTZ-NOM
‚Der Wanderer.‘ oder: ‚der, der geht.‘
tabāk napištī-šu
hinschütten.INF.SC Leben-3.POSS
‚das Hinschütten seines Lebens.‘ (GAG: 203)
Auch in der Zeitlichkeit erfüllen Substantive das Kriterium permanent zu sein – jedenfalls soweit man das auch von Abstrakta oder Begriffen wie ‚Krankheit‘ sagen kann, während Partizipien, Stative und Infinitive wohl beides sein können – permanent oder begrenzt.
Letztlich sind Substantive, Pronomen, Infinitive, Partizipien aber auch Stative nicht graduierbar.
Eigenschaften sind relational, statisch, entweder permanent oder zeitlich und graduierbar.
Wir haben schon festgestellt, dass einige Formen nicht graduierbar sind. Diese können demnach keine (prototypischen) Eigenschaften sein, wenngleich sie einen Ausschnitt der Kriterien erfüllen. Dies wären Partizipien, Stative und Infinitive. Hierbei erfüllen Infinitive nicht (lediglich als Genitiv) das Kriterium der Relationalität und Partizipien und Infinitive können auch prozesshaft sein.
Der Prototyp wäre das Adjektiv. Adjektivische Formen sind stets relational und statisch, das was sie beschreiben kann permanent (wie ‚klein‘) oder zeitlich (wie ‚krank‘) sein. Das Kriterium der Graduierbarkeit ist im Akkadischen ein Problem, denn sie haben weder Komparativ noch Superlativ als morphologische Form – abgesehen vom intensivierenden D-Stamm. Jedoch kann man sie syntaktisch umschreiben. Zusammen mit der Präposition eli ‚über‘ ergibt sich der Komparativ. Eine D- oder Š-Stamm-Nominalform muss herangezogen werden, um einen Superlativ zu erzielen – man kann es allerdings auch umschreiben. Semantisch wird mit allen Möglichkeiten ein veränderter Grad des Adjektivs ausgedrückt, also ist es graduierbar, wenngleich etwas umständlicher.
(73) ša elī-šu rab-û
DET über-3m groß-NOM
‚welcher größer ist als er.‘ (GAG: 90)
šu-rb-um
Š.ADJ-groß-NOM
‚gewaltig groß‘ (GAG: 90)
Auch Adverbien modifizieren etwas auf das sie sich relational beziehen. Sie sind eindeutig statisch und die Eigenschaft auf die sie sich beziehen kann permanent oder zeitlich sein. Graduierbar sind sie jedoch nicht.
Handlungen sind relational, prozesshaft, zeitlich und nicht graduierbar.
Zunächst die ’normalen‘ Verbalformen. Dynamische Verben sind relational (beziehen sich stets auf ein offenes oder verdecktes Subjekt), sehr eindeutig ein Prozess und damit zeitlich. Der D-Stamm liefert kein Problem, stellt er bei dynamischen Verben doch meist kaum semantische Veränderung dar; dagegen macht er aus statischen Verben dynamische.
(74) damāqum → dummuqum
gut.sein gut.machen
Statische Verbalformen sind relational, absolut kein Prozess sondern eben statisch, können zeitlich oder permanent sein und sind ebenso graduierbar. Man sieht – dies ist Crofts Definition eines Eigenschafts-Prototyps. Möglicherweise sind solche Überlegungen der Grund, warum auch der GAG annimmt, dass diese Verbalformen von Adjektiven abgeleitet sind. Das würde bedeuten, dass Adjektive doch eindeutig eine Wortklasse darstellen und nicht eine abgeleitete Verbalform.
Schließlich gibt es noch markierte unscharfe Zwischenformen: Infinitive können (müssen aber nicht) relational sein, können statisch oder dynamisch sein, zeitlich oder permanent, und sind (beschränkt) graduierbar. Sie überschneiden sich also größtenteils mit den Verbalformen, aber auch mit anderen. Partizipien können relational sein, sind statisch, zeitlich oder permanent und nicht graduierbar. Sie nehmen damit eine Stellung zwischen Substantiv und Adjektiv ein. Stative sind relational, statisch oder prozesshaft, permanent oder zeitlich und graduierbar. Damit nehmen sie eine Stellung zwischen Adjektiv und Verb ein.
(75) waṣi-at
rausgehen.STAT-3f.Stat
‚Sie ist ausgehend.‘ (KH §143)
Numerale können relational sein, sind statisch, permanent und nicht graduierbar. Sie sind also größtenteils Substantive mit leichtem Hang zum (nicht-graduierbaren) Adjektiv.
4.3.4. Fazit
Mit den Prototypen von Croft konnten tatsächlich einige interessante Einsichten gewonnen werden. Seinem alten System nach erwarten wir Tab. 5 und erhielten Tab. 6.
|
Referenz |
Modifikation |
Prädikation |
|
|
Objekte |
Unmarkiertes N |
GEN, Adjektivisierer |
Prädikats-N, Kopula |
|
Eigenschaften |
Deadj. N |
Unmarkierte Adj |
Eigenschafts-Adj, Kopula |
|
Aktionen |
Aktions-N, INF, Komplemente |
PTZ, Relativsätze |
Unmarkiertes V |
(76) Tab. 5: Prototypen von Croft.
|
Referenz |
Modifikation |
Prädikation |
|
|
Objekte |
Substantiv |
GEN, Präpositionalphrase, STAT, (adjektivische Nominalformen) |
(verbalisierte Nominalwurzeln) |
|
Eigenschaften |
Abstrakte ADJ bzw. ADJ von Substantiven |
Adjektiv |
Stat. Verben, (stat. INF) |
|
Aktionen |
INF, PTZ |
PTZ, Relativsätze, STAT |
Dyn.Verben, (dyn. INF) |
(77) Tab. 6: Ergebnis der Prototypen nach Croft.
Damit lässt sich folgendes sagen: Die Prototypen stimmen im Groben, besonders bei Substantiven und Adjektiven. Es ist aber nur ein Teil der Verbalformen prototypisch und (für Croft) unerwarteterweise können auch Infinitive prädikativ genutzt werden. Bei den markierten Formen treffen abstrakte Adjektive, die Hauptverwendungsweise von Infinitiven (referierend), der Genitiv, Präpositionalphrasen und Relativsätze zu. Ob es adjektivisierte oder verbalisierte Substantive gibt, darüber lässt sich streiten. Der GAG sagt ja. Unerwartet sind die Möglichkeitsvielfalt des Infinitivs, das auch referierende Verhalten von Partizipien sowie die Möglichkeit des Akkadischen zum Stativ.
|
Relationalität |
Stativität |
Zeitlichkeit |
Graduier. |
|
|
Objekte |
Nicht-Rel. |
Status |
Permanent |
Nicht-grad. |
|
Eigenschaften |
Rel. |
Status |
Perm./zeitl. |
Grad. |
|
Aktionen |
Rel. |
Prozess |
Zeitlich |
Nicht-grad. |
(78) Tab. 7: Semantische Klassen nach Croft (vgl. van Lier 2009: 34).
In seinem neuen System sahen die Erwartungen wie in Tab. 7 aus, während das Ergebnis so lautet: Seine Voraussage für Substantive – und auch Pronomen – sowie Adjektive ist wieder zutreffend. Auch in diesem System stellen aber nur dynamische Verben ‚wahre‘ Verben dar, und selbst das nur unzureichend, denn sie sind graduierbar, wenngleich man dies auch als Aspekt betrachten kann. Adverbien sind fast Adjektive (vermutlich wie erwartet). Dieses System ist jedoch sogar noch krasser darin, statische Verben den Eigenschaften und damit Adjektiven zuzuordnen. Weiter gibt es einige von den Prototypen abweichende Formen. Der Infinitiv steht hier zwischen Substantiv und Verb, das Partizip zwischen Substantiv und Adjektiv, der Stativ zwischen Adjektiv und Verb und die Numeralien sind größtenteils substantivisch mit einem Hang zum Adjektivischen.
Größtenteils lassen sich akkadische Formen Crofts Prototypen zuordnen. Die unscharfen Grenzen zeigen ungewöhnliche Formen auf und zwischen welchen ‚Hauptformen‘ diese stehen. Konkret sagen, zu welcher Wortart sie aber gehören (falls sie nicht eigenständige sind), tut Crofts System aber nur teilweise, denn es gibt auch einige problematische bzw. unerwartete Fälle, vor allem den Infinitiv, das Partizip und den Stativ. Interessant ist aber die Einsicht, wie tief auch hier die Kluft zwischen statischen und dynamischen Verben ist; ähnlich wie es auch die Akkadistik beschreibt.
4.4. Sasse: Untersuchung auf allen Ebenen
Das Akkadische ist eine gute Studie, um Sasses Überlegungen betreffs der Distinktion von Substantiv und Verb zu überprüfen, denn wie wir schon gesehen haben, basieren die meisten Lexeme auf gemeinsamen Wurzeln. Kategorien soll man einzelsprachlich als Bündelung von Kriterien festlegen. Die Kriterien sind der Reihe nach: Formal (Derivation, Flexion, Distribution), syntaktisch (Slots), morpholexikalisch (Phonotaktik, Affixe), semantisch-ontologisch, diskurstechnisch (Referenz, Prädikation, Modifikation). Gehen wir diese nun der Reihe nach durch. Hierbei sparen wir uns aber eine Wiederholung von semantischen und diskurstechnischen Kriterien, die schon bei Croft erfolgte. Wichtig ist zu erwähnen, dass Sasse nur Inhaltswörter betrachtete. Trotzdem möchte ich sogenannte Funktionswörter auch kurz untersuchen.
4.4.1. Formale Untersuchung
Formale Kriterien sind Flexion, Derivation und Distribution.
Derivation. Die wichtigste Form der Wortbildung im Akkadischen sind die Formen, die Wurzeln annehmen können. Hier nochmal eine kleine Auswahl.
(79) V šumma awīl-um awīl-am u-bbir-ma
wenn Bürger-NOM Bürger-AKK 3-D.umarmen.PST-KONJ
‚Wenn ein Bürger einen (anderen) Bürger beschuldigt97.‘ (KH §1)
N awīlum
‚Der/Ein Bürger‘ (KH §1)
ADJ šum-šu ṣir-am
Name.SC-3.POSS erhaben-AKK
’sein erhabener Name.‘ (KH Prolog)
Wenngleich im Akkadischen kein richtiges Inhaltswort, kann man aus einigen solcher Formen mithilfe des Akkusativs oder Terminativs auch Adverbien bilden.
(80) uzz-um i-llak-am rīmān-iš
Wut-NOM 3-gehen.PRS-VNT Wildstier-TERM
‚Wut kommt zu mir wie ein Wildstier/wildstierhaft98.‘ (Wilcke 1985)
Abgesehen hiervon gibt es keine speziellen Derivationsmöglichkeiten.
Flexion99.
a) Deklination.
Substantive zeigen Genus (unmarkiert für maskulin, -t- für feminin), Numerus und Kasus (z.B. -um für Singular Nominativ und –ī für Plural Obliquus). Eine Besonderheit ist ihre Fähigkeit in bestimmten Stati (SR, SA, SC) zu stehen; um Adverbiale zu bilden oder einen Genitiv oder Possessiv zu nehmen bzw. ebenfalls zu bilden.
Adjektive zeigen Kongruzenz, können aber kein Possessiv, selten nur einen Genitiv nehmen und nicht zu einem Adverbial werden. Auch Numeralien stehen in Kongruenz (Genus, Status), kommen aber auch allein vor. Pronomen haben teilweise andere Kasus als Substantive, haben keine Stati und sind selbständig oder suffigiert. Partizipien können wie Substantive oder Adjektive, Stative auch adjektivisch genutzt werden. Infinitive zeigen meist dieselben Flexionsmuster wie Substantive, haben jedoch kein Genus und eine adverbiale Form ist mir auch nicht bekannt.
Zusammengefasst heißt das: Einige Formen deklinieren durchaus wie man es ‚erwarten‘ würde, doch gibt es auch Formen, deren Wurzeln eine Handlung beschreiben und die nominal genutzt werden (können).
b) Konjugation.
Auch zur Konjugation gehören bestimmte Formen. Die Stämme drücken Diathesen, Aktionsarten und in geringem Maße Aspekt aus. Verbalformen stehen in einer bestimmten Form samt zugehöriger Vokalisation, um Tempus auszudrücken. Durch Affixe kongruiert die Verbalform mit dem Subjekt in Genus, Person und Numerus.
Von einer Verbalwurzel (samt Stamm) können aber auch Nominalformen gebildet werden, von denen nur der Infinitiv auch verbal genutzt werden kann. Diese Formen können dann ganz normal deklinieren. Und zuletzt können Verbalwurzeln ebenso wie Nominalwurzeln (falls man da unterscheiden kann) in den Stativ gesetzt werden.
Die formale Ebene allein reicht also noch nicht aus, um Wortklassen klar zu identifizieren.
4.4.2. Syntaktische Untersuchung
Syntaktische Kriterien sind Slots. Die Kategorien sind entweder phrasal oder funktional definiert.
Bestimmte Slots für bestimmte Wortarten kommen nur sehr beschränkt vor. Es gibt zwar eine normale Wortreihenfolge SOV, jedoch kann diese zur Betonung verändert werden. Geht man aber von dieser normalen aus, so lässt sich zumindest sagen, dass Prädikate am Satzende, Objekte vor ihnen und Subjekte wiederum vor diesen stehen. Adverbien sind vor dem zu Modifizierendem, also am Satzanfang für den ganzen Satz oder vor dem Prädikat, jedoch halten sie das nicht immer ein.
(81) aššumī-ka imēr-am ul a-šām
wegen-2m Esel-AKK NEG 1-kaufen.PST
‚Deinetwegen kaufte ich keinen Esel.‘ (GAG: 185)
Attribute folgen dem Substantiv, jedoch kann ein Attribut sowohl ein Genitiv-Objekt (auch Partizip), ein (Neben-)Satz, ein Adjektiv oder auch eine Verbalwurzel im Stativ sein; also sämtliche großen Klassen. Man kann aber andersherum sagen, dass nur an einem Substantiv ein Attribut stehen kann, wenngleich dazu dann auch Partizipien und Infinitive gehören.
Topikalisiert (meist Satzanfangsstellung) können nur Substantive (Subjekt oder Objekt) und Verbalformen vorkommen. Zumindest sind mir keine anderslautende Beispiele bekannt.
Eine bessere Bestimmung ist Kasus. Dieser tritt für gewöhnlich nur an nominalen Formen auf, wobei das Substantiv den eigentlichen Kasus besitzt, derweil andere Formen nur kongruieren. Jedoch ist klar, dass auch dieses Kriterium dem Infinitiv eine Rolle als Substantiv zuschreibt, wobei dieser aber verbalisiert immer noch einen Kasus trägt, nämlich den Nominativ. Und auch der Kasus -am tritt an anderen Formen auf, nämlich adverbialen, die dadurch erst gebildet werden. Beim -am nimmt man aber für gewöhnlich einen Synkretismus von Akkusativ und Adverbial an. Ähnliches gilt auch für den Kasus -iš (Terminativ). Lediglich die Kasus -ūm (Lokativ) und -um (!) (Vokativ) sind exklusiv substantivisch.
Funktionswörter als syntaktische formale Bestimmung gibt es nur wenige. Adverbiale Formen modifizieren Sätze oder Verbalformen, Präpositionen bestimmen Adverbien oder Objekte, Pronomen nehmen den Platz von Substantiven ein, modale Partikel modifizieren Verbalformen.
Funktional gesprochen lässt sich noch sagen, dass je nach Phrasenart sowohl Substantive als auch Verbalformen Prädikat sein können, wobei in Verbalphrasen auch Infinitive als Prädikat möglich sind. Argument ist in einer Verbalphrase stets ein Substantiv oder eine Pro-Form. Absolute Klarheit ergeben funktionale Kriterien jedoch noch nicht.
Letztlich gibt es noch phrasale Kriterien. In Nominalphrasen erkennt man Nominale (und Pronominale) sowohl als Prädikat als auch als Argument. In Adjektiv-Phrasen sind ganz klar Adjektiv-Formen Kopf der Phrase, in Adverb-Phrasen Adverbien, in Präpositionalphrasen Präpositionen etc. Phrasal lassen sich die Wortklassen hier am leichtesten bestimmen.
(82) anākū-ma rē‘-ûm
Ich-TOP Hirte-NOM
A P
‚Ich bin der Hirte.‘ (KH Prolog)
mārās-su i-dukk-u
Tochter.SC-3.POSS 3-töten.PRS-PL
A P
‚Sie töten seine Tochter.‘ (KH §210)
4.4.3. Morpholexikalische Untersuchung
Morpholexikalische Kriterien sind Phonotaktik und Affixe.
a) Affixe. Substantivische Formen können Genus (-t-), die Affixe für Kasus-Numerus-Person, Possessiv-Suffixe (sofern sie im SC stehen), den Terminativ sowie die Betonung -ma tragen. Außerdem haben einige Substantive den speziellen Plural-Marker –ānu. Eigennamen, besonders geographische, können Abstrahierer wie –ī– nehmen, um Völker- bzw. Bürgerbezeichnungen zu bilden (‚X, der Aramäer‘ u.ä.).
Adjektivische Formen haben fast dieselben Genus und K-N-P-Affixe, jedoch unterscheiden sie sich im Plural, der –ūtu (maskulin) bzw. -ātu (feminin) lautet. Letztlich bildet das Infix -ūt- Abstrakta. Davon abgesehen kann das Adjektiv keine weiteren Affixe nehmen.
Verbalformen nutzen die Affixe (nur Präfix oder Präfix mit Suffix kombiniert) für Person-Numerus-Genus. Auch können sie die Infixe vom Perfekt (-ta-) sowie den t- und tan-Stämmen (-ta- bzw. -t(a)n-) nehmen. Und schließlich können auch sie mit dem Infix -ūt- Abstrakta bilden.
Adverbien werden u.a. mit den Endungen -iš (Terminativ) und -am (Akkusativ) konstruiert, nehmen jedoch auch vollkommen eigene, wie -attam.
Numerale können durch adverbiale oder adjektivische Endungen auch solche Formen bilden, derweil Kardinale und Ordinale sich an den Substantiven orientieren, können jedoch nicht alle Kasus nehmen.
(83) erb-ûm
4-NOM
‚Die Vier.‘ (GAG: 91)
kibrāt erbett-im
Weltecke.PL.SC 4.SA-GEN
‚Die vier Weltecken.‘ (KH Prolog)
Wiederum gibt es Problemformen. Der Infinitiv hat einen Großteil der substantivischen Möglichkeiten (außer Terminativ, Lokativ, –ānu), kann aber in dieser Form (mit dem Nominativ) auch verbal konstruiert werden. Partizipien haben die meisten der Möglichkeiten von Adjektiven und Substantiven. Und schließlich gibt es noch den Stativ, der von einer nominalen oder verbalen Basis gebildet wird und völlig eigene Suffixe besitzt. Größtenteils scheinen Affixe im Akkadischen ein gutes Mittel zu sein, eine Wortart zu identifizieren.
b) Phonologie ist für das Akkadische wichtig, da die Bedeutung auch oft an der Form eines Lexems hängt. Einige phonologische Regeln treffen auf alle Formen zu, z.B. die Assimilationen, auch können (so gut wie) nie drei kurze offene Silben hintereinander stehen; hierbei wird der zweite Vokal ellidiert, genauso wie ein zusätzlicher eingefügt wird, wenn zuviele Konsonanten nebeneinander stehen würden.
Jedoch gibt es auch einige spezielle Regeln, so die Wandlung m- zu n- bei Partizipien, wenn in der Wurzel ein Bilabialer enthalten ist.
(84) nā-maru-um
PTZ-sehen.PTZ-NOM
‚Der Spiegel.100‚ (GAG: 64)
Das Perfekt oder -ta-Stamm -ta- sowie das -t(a)n- assimilieren sich an bestimmte Konsonanten, was aber als Assimilation nicht ungewöhnlich ist.
(85) kīma qaqqar-im lu-tettiq-ka
wie Erde-GEN PRK-Gtn.überqueren.PRS-2m.AKK
‚Wie den Erdboden will ich dich immer wieder übertreten.‘ (Wilcke 1985)
Spezieller ist die Regel der Metathesis, wenn das -t(a)-Infix einer -ta-Stamm-Verbalform die Position tauscht mit dem ersten Radikal.
(86) ti-dabbab101
Gtn-reden.INF.SC
‚das Immer-wieder-Reden.‘
Davon abgesehen sind mir keine phonotaktischen Begrenzungen oder phonologische Regeln bekannt, die sich nur auf bestimmte Formen beschränken.
4.4.4. Ontologische Untersuchung
In die ontologische Untersuchung gehören Zuordnungen zu ontologischen Kategorien bzw. Bedeutungsklassen. Wie schon erwähnt hat das Akkadische die Tendenz, so wie andere semitische Sprachen auch, seine Nominal- und Verbalformen anhand von bestimmten Konsonanten- und Vokalmustern so zu gestalten, dass zugehörige Lexeme meist eine gemeinsame Bedeutungsklasse bilden. Dies stimmt zwar nicht immer, da es im Laufe der Zeiten auch zu Bedeutungs- und Lautverschiebungen kam, doch lassen sich auf diese Art einige Gruppen ausmachen.
Bei den Nominalformen gibt es die zwei großen Subklassen Substantiv und Adjektiv. Alle Formen samt Bedeutungen aufzulisten schafft selbst der GAG nicht, deshalb hier nur eine kleine Auswahl. Hierbei ist interessant, dass ‚Gegenstandssubstantive‘ keine Bedeutungsklassen bilden (GAG: 57). Die Form pars gibt es für Abstrakta, pirs für (konkrete) Handlungssubstantive von Verbalwurzeln, purs für Adjektiv-Abstrakta, paris als Adjektiv-Normalform, parās für den G-Infinitiv, parāst für deverbale Abstrakta, parīs für Adjektiv-Abstrakta, purās für substantivierte Adjektive, pāris für G-Partizipien, parras für sogenannte Steigerungsadjektive (Superlativ), parris für substantivierte Partizipien, purrus für D-Infinitiv, purarīs, pursās, parassūs, purusiss für Tiere, itaprus für den Ntn-Infinitiv, maprast für instrumentale Substantive, mupras für Tageszeiten, Ausdehnungen und Wegbezeichnungen, muparris für D-Partitzipien, mupparis für N-Partizipien, mušapris für Š-Partizipien, naplus für den N-Infinitiv, tapras für Ortssubstantive von Adjektiven, taprus(t) für Verbalabstrakta, parrusī für Adjektive ’schlechter Gewohnheit‘, paspass und paspasī für (einige) Superlativ-Adjektive.
Damit finden sich also einige Nominalformen für Infinitive und Partizipien, substantivierte Adjektive und Verba, Superlativ-Adjektive und Abstrakta. Auffällig sind Formen für Tiere, Tageszeiten, Ausdehnungen, Wegbezeichnungen, instrumentale Substantive und Adjektive ’schlechter Gewohnheit‘. Da aber nicht alle Nominale solcher Bedeutung in eine dieser Klassen fallen, sollte man diese nicht zu stark bewerten.
Auch für Verbalformen gibt es Bedeutungsklassen, die von drei Faktoren abhängen: a) welche Radikale die Wurzel hat, v.a. ob sie einen ’schwachen‘ Radikal (Alef, w, j, n) dabei hat, b) welche(n) Wurzelvokal(e) die Form aufweist, c) ob die Bedeutung eine dynamische oder statische ist. Ursprünglich soll es wohl in der Sprache möglich gewesen sein, je nach Bedeutung für die Wurzel entsprechende Formen zu nutzen. Später jedoch galt es jedoch selbst für die noch vorhandenen Bedeutungsklassen nicht immer, dass man sie an der Form ablesen kann und umgekehrt.
Verben II Geminate bezeichnen als dynamisches Verb durative Handlungen und Kettendurative. Bei Verben I n beschreiben dynamische Wurzeln lautmalerische Geräusche oder Richtungshandlungen. Die dynamischen I w bezeichnen unfreiwillige und Bewegungshandlungen. Dynamische Verben II‘ bezeichnen Zustandsübergänge, Bewegungen, Körperfunktionen oder terminative Handlungen. Bei III‘ lassen sich keine Bedeutungsklassen erkennen. Bei den Wurzelvokalen beschreibt ein i meist ein statisches Verb. Die dynamischen haben dagegen 4 Wurzelvokalklassen. Tätigkeiten am Objekt haben meist a/u, seltener nur a. Momentan resultative Tätigkeiten haben meist ein i, jedoch besitzen dies auch einige Bewegungsverben. Letztlich gibt es noch das u, das in Verben vorkommt die Vorgänge nicht momentaner Art beschreiben.
Statische Verbalformen haben meist ein klares Muster, egal ob ’schwach‘ oder nicht und ein Wurzelvokal i führen. Die dynamischen sind schwerer zu klassifizieren, wobei vor allem Objekttätigkeiten und nicht-momentane Handlungen am ehesten eine Klasse bilden, derweil die Bewegungsverben mehrere Optionen haben.
Obige Aussagen beziehen sich aber nur auf Formen ab der Stamm-Ebene aufwärts. Was aber ist mit der reinen Wurzelebene? Wie wir schon erfahren haben, basieren Inhaltslexeme semitischer Sprachen auf Wurzeln, die zwei bis vier Radikale haben sowie teilweise einen Wurzelvokal. Betrachtet man nur diese Wurzeln, so findet man einige Bedeutungen, die auf konkrete Objekte referieren, die meist grundlegende Bedeutungen ausdrücken, z.B. klb (kalbum) ‚Hund‘, p‘ (pûm) ‚Mund‘, ‚ḫ (aḫu) ‚Bruder‘, ‚b (abu) ‚Vater‘, mm (ummu) ‚mutter‘, rtt (rittu) ‚Hand‘. Dem entgegen gesetzt findet man zahlreiche Wurzeln, deren hauptsächliche Bedeutung die einer Handlung (dynamische Verben) oder eines Zustandes (statische Verben oder Adjektive) sind. Letztlich gibt es noch Formen, die sich nicht auf Wurzeln zurückführen lassen bzw. deren Wurzeln allein man keine Bedeutung entlocken kann: die geschlossenen Klassen bzw. Funktionswörter, wie Pronomen und die Partikel.
Synchron lassen sich nur Zusammenhänge zwischen einzelnen Formen nachweisen, wie sāmtu ‚Röte‘ zu siāmu ‚rot sein‘ und sāmu ‚rot, braun‘. Die Bedeutung der Wurzel ist hier die abstrakte Eigenschaft rot zu sein. Welche der konkreten Ausformungen einer Eigenschaft hierbei die wesentliche ist, lässt sich synchron nicht sagen, da aber eine davon prototypische Adjektive darstellt, bietet sich kein Argument diese Wortklasse zu leugnen. Damit hätten wir drei Klassen von Wurzeln: eine kleine Gruppe von Objekten, eine große Gruppe von Handlungen und eine große Gruppe von Eigenschaften. Auf dieser Ebene finden wir somit alle drei großen Klassen von Inhaltswörtern: Substantive, Verba und Adjektive.
4.4.5. Diskurstechnische Ergebnisse
Da wir diese Bereiche bereits bei Croft untersucht haben und Sasse sich auf Croft beruft, reicht es die Ergebnisse kurz zu rekapitulieren. Wie wir sahen, stimmten Crofts Annahmen über Prototypen mit den Ergebnissen des Akkadischen besonders bei Substantiven und Adjektiven überein. Bei Verbalformen aber sind nur die dynamischen prototypisch und die prädikative Nutzung des Infinitivs ist ein Problem. Ebenso stellen die Formen des Partizips und Stativs Probleme dar. Da Sasse sich nur auf das alte System berief, sind die Ergebnisse aus dem neueren System irrelevant.
4.4.6. Fazit
|
Kriterium |
Subst. |
Num. |
Ptz. |
Adj. |
Stat. |
Stat. Verb |
Inf. |
Dyn.Verb |
Adv. |
|
Deriv. |
Nom. Form, Abstr. |
N/A |
Nom. Form |
Nom. Form |
Form |
Verb. Form |
Nom. Form |
Verb. Form |
-am, -iš |
|
Dekl. |
Gen, Num, Kasus, POSS, Stati, Adv. |
Gen, Stati |
Gen, Num, Kasus, POSS, Stati |
Kongr. (Gen, Num, Kasus), selten GEN |
N/A |
N/A |
Num, Kasus, POSS, Stati |
N/A |
N/A |
|
Konj. |
N/A |
N/A |
Diath., Aktion. |
N/A |
N/A |
Diath., Aktion., Asp., TEMP, Kongr. (Gen, Pers, Kasus) |
Diathesen, Aktionsart |
Diath., Aktion., Asp., TEMP, Kongr. (Gen, Pers, Kasus) |
N/A |
|
Wortfolge |
S: Anf.; O: Mitte |
S: Anf.; Attr: nach Subst. |
S: Anf.; Attr: nach Subst. |
nach Subst. (Attrib) |
Attr: nach Subst; P: Ende |
P: Ende |
S: Anf.; O: Mitte; P: Ende |
P: Ende |
Anf. o. vor Modifiziertem |
|
Kasus |
alle |
S: alle; Attr: Kongr. (Haupt.) |
S: alle; Attr: Kongr. (Haupt.) |
Attr: Kongr. (Haupt.) |
N/A |
N/A |
Haupt. |
N/A |
Adv. |
|
Mögl. F- Wörter |
Adv., präp. |
S: Adv.; A: N/A |
S: Adv., präp.; A: N/A |
N/A |
N/A |
Adv., |
Adv., präp. |
Adv. |
Präp. |
|
Funktionen |
NP: A, P; VP: A |
NP: A, P, Mod.; VP: A, Mod. |
NP: P, Mod; VP: A, Mod. |
Mod. |
NP: P |
VP: P |
NP: P; VP: A |
VP: P |
Mod. |
|
Phrasenkopf |
NP |
NP, AdjP |
NP, AdjP |
AdjP |
NP |
VP |
NP, VP |
VP |
AdvP |
|
Affixe |
Gen, Kasus, Num, Pers, POSS, TERM, -ma, –ānu |
Adv, Adj, subst. Endungen |
Gen, Kasus, Num, Pers, POSS, -ma |
Kongr. (Num, Pers, Kasus, Gen -eig. PL!), Abstr., selten GEN |
Stativ |
Kongr. (Pers, Num, Gen), -t(a)-, -t(a)n-, Abstr. |
Kasus, Num, Pers, POSS, TERM, -ma, -t(a)-, -t(a)n-, Abstr. |
Kongr. (Pers, Num, Gen), -t(a)-, -t(a)n-, Abstr. |
Adv. (TERM, AKK, -attam) |
|
Phono |
Form |
N/A |
Form, m>n |
Form |
Form |
Form, Metath. |
Form |
Form, Metath. |
(Form) |
|
Onto. |
einige Konkr. & Abstr.,Substantivierte |
N/A |
Ptz |
Superl. |
N/A |
Wurzel i |
Inf |
Wurzel a/u, a, u; einige Klassen |
N/A |
|
Diskurs. |
Proto.: ref. Obj. |
Proto.: ref. Eig., mod. Eig. |
Proto.: ref. Eig., mod. Eig. |
Proto.: mod. Eig. |
Proto.: mod. Akt. |
Proto.: präd. Eig. |
Proto.: ref. Eig., präd. Eig./Akt. |
Proto.: präd. Akt. |
N/A (Mod.) |
(87) Tab. 8: Ergebnisse der Untersuchung nach Sasse.
Nun wollen wir alle Ergebnisse zusammenfassen. In Tab. 8 sieht man Sasses Kriterien zur Bestimmung von Wortarten und in welcher Ausformung sie zutreffen.
Diskurstechnische Kriterien bieten klare prototypische Wortarten sowie die üblichen Problemfälle. Deutlich erkennbar sind prototypische Substantive, deren nicht-abgeleitete ‚reine‘ Formen aber begrenzt sind. Bei prototypischen Adjektiven ist die Frage, ob sie sich von den entsprechenden statischen Verben ableiten oder umgekehrt; Argumente gibt es für beide Möglichkeiten102. ‚Richtige‘ prototypische Verben sind demnach nur die dynamischen. Der Grenzfall Stativ ist noch unkompliziert, aber für Partizipien, Numeralien und Infinitive gibt es je nach Einsatzart mehrere Möglichkeiten.
Rein ontologische Kriterien sind für das Akkadische ab der Stammebene aufwärts kaum nützlich. Jedoch lassen sich anhand von Formen und damit Bedeutungsklassen die Grenzfälle leicht identifizieren, derweil es für Substantive und dynamische Verben zwar einige Bedeutungsklassen gibt, diese aber nicht konsequent durchgeführt sind. Es lässt sich aber festhalten, dass nur Adjektive eine Superlativform haben und die statischen Verben anhand ihrer Wurzelklasse gut zu identifizieren sind. Auf der Wurzelebene dagegen fand sich ontologische Evidenz für Objekte, Handlungen und Eigenschaften, also die Wortklassen Substantiv, Adjektiv und Verb.
Phonologische und phonotaktische Kriterien spielen kaum eine Rolle, da die meisten Regeln auf alle Formen zutreffen. Lediglich die mögliche Metathese der Verbalformen sowie das m zu n der Partizipien ist hervorzuheben.
Sehr gute Kriterien dagegen sind die Affixe. Es lässt sich sagen, dass nur Substantive auch die vollen substantivischen Möglichkeiten haben, während Numeralien, Adjektive, Partizipien und Infinitive nur einen Ausschnitt davon nehmen, teils aus Kongruenz. Adjektive zeichnen sich aber durch ihren eigenen Plural aus. Verbalformen haben exklusiv typische Affixe. Zwar können auch Infinitive einen Ausschnitt hiervon nehmen, aber eben nicht die volle Palette. Stative wiederum haben gänzlich exklusive Affixe. Schließlich haben Adverbien, selbst wenn man einen Teil ihrer Affixe als denen der Substantive entsprechend nimmt, noch einen eigenen Adverbialisierer103.
Syntaktische Kriterien stellen sich als teilweise problematisch heraus. Was Kopf einer Phrase sein kann, sagt noch nicht zwangsläufig viel aus. Lediglich in AdvP können nur Adverbiale Kopf sein. In der VP findet man zwar die Verben, jedoch auch den Infinitiv als Kopf. AdjP lassen gar Adjektive, Numerale und Partizipien zu; analysiert man sie als Modifikator, dann auch den Stativ. Sonst steht dieser in der NP, ebenso wie Substantive, Numerale, Partizipien und Infinitive.
Auch syntaktisch/semantische Funktionen bringen uns nur unwesentlich weiter, da viele Formen Argument, Prädikat oder Modifikator sein können, dabei meist aber abhängig von der Phrasenart sind. Immerhin kann man wieder betreffend die Kasus sagen, dass nur Substantive sämtliche nehmen können. Andere nominale Formen können nur einen Ausschnitt haben und Attribute kongruieren nur mit den Hauptkasus. Die Wortfolge trifft nur Aussagen, wenn man von der normalen Reihenfolge ausgeht. Dann kann man die Hauptformen aber leicht identifizieren: Prädikate am Satzende, Objekte davor, Attribute nach den Objekten. Das macht aber noch keine Aussage darüber, was Objekt, Attribut oder Prädikat ist.
Derivation bietet kaum Einsichten; höchstens, dass verbale Formen eine andere Form annehmen als Nominalformen. Nominalformen scheinen also eng zueinander zu gehören. Deklination trifft auf alle Nominale zu, wobei Adjektive hauptsächlich kongruieren. Partizipien und Infinitive besitzen nur einen Ausschnitt der substantivischen Möglichkeiten, ebenso wie Numerale. Konjugation betrifft die statischen und dynamischen Verben in vollem Umfang, derweil Infinitive und Partizipien einen Ausschnitt nehmen.
Das Endergebnis bietet erstmal nur wenig neues. Die Wortarten des Akkadischen unterteilen sich auf der Stamm- bzw. Wortebene grob in nominale und verbale Formen sowie einige kleine geschlossene Klassen. Die Adverbien können hier schon mal als (kleine) Wortklasse identifiziert werden, unterscheiden sie sich doch in den meisten Bereichen stark von den anderen. Substantive sind die einzigen Nominalformen, die einen kompletten Ausschnitt der Deklination sowie der Kasus104 haben. Die anderen Nominalformen unterscheiden sich vor allem durch ihre Funktionen von den Substantiven. Weiterhin sind Verbalformen die einzigen, welche die komplette Bandbreite der Konjugation samt Affixen haben können. Besonders im Diskurs sowie ontologisch lassen sich aber zwei große Subklassen von Verben unterscheiden; dynamische sind die ‚echten‘ Verben, derweil bei statischen die Diskussion bleibt, ob sie oder die Adjektive zuerst da waren. Diachron waren es womöglich die Adjektive, synchron spricht mehr für die Verbalformen. Demnach hätten wir an Hauptklassen bisher eine (beschränkt große) Gruppe von Substantiven und eine (sehr) große Klasse von Verben sowie davon abgeleitete Adjektive. Von den Verben leiten sich aber auch Partizipien und Infinitive ab, die funktional meist nominal sind, diskurstechnisch zwischen den Prototypen stehen und einen Ausschnitt der Deklination und Konjugation besitzen.
Ordnen wir das Ganze noch einmal kurz den Ebenen der Analyse folgend. Auf der Wurzelebene finden wir Wurzeln mit abstrakten Bedeutungen, die sich Objekten, Handlungen und Eigenschaften zuweisen lassen. Ab der Stammebene lassen sich durch Nominal- und Verbalformen diese beiden Oberklassen feststellen: Nominale und Verbale. Jedoch gibt es ab dieser Ebene auch flexible Formen: Partizip, Infinitiv und den Stativ. Ab der Wortebene lässt sich sagen, dass Substantive, Adjektive und Verben sich durch ihre Affixe unterscheiden. Die flexiblen Formen bleiben weiterhin Zwischenformen, die jeweils nur ein Subset der Marker nehmen können und deshalb nicht völlig zu einer der Klassen gehören sondern zu jeweils beiden. Höhere Ebenen bringen keine weiteren Einsichten, nur zusätzliche Details.
Damit gibt es auch unabhängig von der Analyseebene übergreifend genug Evidenz zwischen den drei hauptsächlichen Inhaltsklassen Substantiv, Verb und Adjektiv zu unterscheiden. Zusätzlich gibt es drei flexible Klassen: Partizip, Infinitiv, Stativ. Möchte man sie in eine Oberklasse zwängen, so muss man dies nach ihren hauptsächlichen Funktionen tun. Der GAG sagt hierbei, dass Partizipien Adjektive sind, derweil mir mehr Substantive unterkamen. Der Infinitiv ist dann eindeutig Substantiv, der Stativ Adjektiv. Will man sie nicht zwängen, so muss man sie als jeweils zwei Klassen zugehörig ansehen oder eigene Klassen schaffen, wie es auch Sasse (2009) für das Partizip vorschlug. Dass man dies tun sollte, dafür spricht auch, dass viele der Partikel mehreren Subklassen angehören. Neben den drei Hauptklassen sowie den Partikeln und (abgeleiteten) Adverbien finden sich noch die kleinen Klassen der Pronomen und Numeralien.
|
Offen |
Geschlossen |
||||||||||
|
Nominale |
Verbale |
||||||||||
|
N |
PTC |
ADJ |
PTC/INF/STAT105 |
V |
ProN |
NUM |
PTCL |
||||
|
dyn |
stat |
Sub. |
Sub. |
ADV |
SUBJ |
PTCL |
|||||
(88) Tab. 9 Wortklassen des Akkadischen von der Wurzel zu den Subklassen.
4.5. Luuk: flexibel oder nicht?
Nun wollen wir noch untersuchen, welcher Sprachtyp das Akkadische nach Luuk wäre. Lexikale Kategorien sieht man an Stämmen, nicht funktionalen Köpfen. Die Kriterien sind semantisch und grammatisch. Luuks Theorie betrachtet nur Stämme. Die bedeutet vor allem auch, dass er wie Hengeveld und Schachter & Shopen keine Aussagen über Wurzeln treffen kann bzw. will. Dass die Wurzeln des Akkadischen vage/ambig und damit flexibel sind, kann man hier nicht sagen, auch wenn – sogar in Luuks Theorie selbst – einiges dafür sprechen würde, dies anzunehmen. Wir müssen also die Stämme betrachten, die aber bereits in bestimmten Nominal- oder Verbalformen vorliegen. Wie viel sich dann noch sagen lässt, werden wir sehen.
4.5.1. Verben
Verben nehmen an ihren Stamm nur LP (gekennzeichnet durch TAM, Diathesen und Wortstellung).
Sehr leicht lassen sich Beispiele finden, in denen TAM am Lexem gezeigt wird.
(89) kīma qaqqar-im lu-tettiq-ka
wie Erde-GEN PRK–Gtn.überqueren.PRS-2m.AKK
‚Wie den Erdboden will ich dich immer wieder übertreten.‘ (Wilcke 1985)
Tempus wird an akkadischen Verbalformen durch eine bestimmte morphologische Form ausgedrückt. Vollständig ist diese erst mit den Markern für Person, Genus und Numerus, doch werden diese in Luuks Theorie zunächst nicht berücksichtigt. Hierdurch ergibt sich das Problem, dass wir eigentlich nur eine Verbalform, einen Stamm an sich betrachten können, ohne zusätzliche Marker.
(90) i-d-dak
3-N.töten.PST
‚wird er getötet.‘ (KH §1)
Ohne Marker: ddak ‚wird getötet‘106
Jedoch bietet das Perfekt, wenn als Tempus angenommen, ein Infix -ta-.
(91) i-t-ta-ṣbat
3-N-PF-packen.PST
‚Er ist gefangen worden.‘ (KH §22)
Aspekt wird in semitischen Sprachen vor allem in der Distinktion Imperfektiv – Perfektiv durch entsprechende Verbalformen ausgedrückt. Ursprünglich zeigten semitische Sprachen ‚Zeit‘ nur durch Aspekt. Das Akkadische ist da etwas anders, als das man seine Tempora auch als solche annehmen könnte. Insofern wurden sie bereits oben betrachtet. Als weiteren Aspekt kann man jedoch das Iterativ des tan-Stammes ansehen, der ein ‚immer wieder‘ oder ‚permanent‘ ausdrückt und für seine Form definitiv einen Marker, nämlich ein Infix nimmt.
(92) kīma qaqqar-im lu-tettiq-ka
wie Erde-GEN PRK-Gtn.überqueren.PRS-2m.AKK
‚Wie den Erdboden will ich dich immer wieder übertreten.‘ (Wilcke 1985)
Aber auch wenn man das Perfekt noch als Aspekt und nicht als Tempus betrachten möchte, findet man durch sein -ta-Infix einen Marker (s.o.).
Modus wird nicht am Stamm selbst ausgedrückt, sondern mit Partikeln. Lediglich der Imperativ nutzt kein Partikel, zeigt aber auch nur den bloßen Stamm und keinen Marker, sofern es sich um die 3.m.Sg. Handelt.
(93) šeḫit uzz-um ša Nanāja
springen.IMP Wut-NOM DET N.
‚Spring, oh Zorn der Nanāja!‘ (Wilcke 1985)
dilp-ī mušīt-am
schlaflos.sein.IMP-f Nacht-AKK
‚Sei schlaflos in der Nacht!‘ (Wilcke 1985)
Modi mit Partikel gibt es aber gleich mehrere, hier zwei Beispiele.
(94) kīma askuppat-im lu-kabbis-ka
wie Türschwellplatte-GEN PRK-trampeln.PRS-2m.AKK
‚Ich will wie auf eine Türschwellplatte auf dich treten.‘ (Wilcke 1985)
urri ē ta-ṣlal-i
tagsüber NEG 2-schlafen-f
‚Tagsüber schlafe nicht!‘ (Wilcke 1985)
Diathesen werden durch die verschiedenen Stämme ausgedrückt und damit wieder bloß durch einen Stamm, der erst mit Person, Numerus und Genus vollständig ist.
(95) i-d-dak
3-N(PASS).töten.PST
‚wird er getötet.‘ (KH §1)
Die Wortstellung sagt nicht immer klar aus, welcher Teil eines Satzes das Prädikat ist. Hier sollten wir aber von normalen Prosa-Texten ausgehen; dann steht das Prädikat in ‚Verbalsätzen‘, sofern es nicht betont wird, am Satzende.
(96) mārās-su i-dukk-u
Tochter.SC-3.POSS 3-töten.PRS-PL
A P
‚Sie töten seine Tochter.‘ (KH §210)
Dies gilt für Verbalphrasen mit Subjekt und eventuellen Objekten.
Der Infinitiv, der im richtigen Stamm womöglich auch aspektuelle (-tan-) oder diathetische LP-Marker aufnimmt, kann ebenfalls in der prädikativen Stellung stehen.
Gegenbeispiele: Fragen müssen wir uns nun noch, ob die betrachteten Kriterien auch an Formen vorkommen, die man klassischerweise als ‚Substantiv‘ bezeichnen würde. Gehen wir dazu von hinten vor. Dass ein Lexem laut Wortstellung Prädikat ist, sagt noch nicht, ob es auch ein ‚Verb‘ ist. Das Problem hierbei: Auch nominale Formen können Prädikat sein, wie in vielen anderen Sprachen.
(97) a) anākū-ma rē‘-ûm
Ich-TOP Hirte-NOM
A P
‚Ich bin der Hirte.‘ (KH Prolog)
b) šum-šu ṣir-am
Name.SC-3.POSS erhaben-AKK
A P
’sein erhabener Name.‘ (KH Prolog)
Hier gibt uns Luuk jedoch ein weiteres Kriterium an die Hand: Es geht um den Marker, der syntaktisch am äußersten steht. Aber – ist die Wortreihenfolge nicht automatisch am äußersten?
Weiter: Dass ein Lexem einen bestimmten Stamm (Diathese, Aspekt) zuzuordnen ist, sagt noch nichts darüber aus, ob es ‚verbal‘ oder ’substantivisch‘ ist. Der Stamm einer Form ist zunächst nur Grundlage, von der aus auch Partizipien und Adjektive gebildet werden. Nach Luuks Kriterien müssen wir diese Formen nun aber streng als verbal annehmen, sofern sie nicht als Gegenbeispiel gelten sollen.
(98) mu-šaḫḫin-um
PTZ-D.PTZ.heiß.sein-NOM
‚Ofen (lit.: Heißwerder oder Der-heiß-wird/ist)107.‘ (GAG: 65)
Modus-Partikel kommen nicht mit den substantivischen Formen vor. Auch Tempus scheint ein klares Anzeichen für eine ‚verbale‘ Form zu sein.
4.5.2. Substantive
Substantive nehmen an ihren Stamm nur LA (gekennzeichnet durch Determinative, Possessiva und Wortstellung). Determinative im Sinne von Artikeln gibt es im Akkadischen nicht. Das Determinativ-Pronomen ša hat vor allem syntaktische Funktionen und leitet einen Nebensatz ein; zum Teil ersetzt es auch den Hauptsatz ganz. Er muss nicht in Verbindung mit einem Substantiv stehen. An Possessiv-Konstruktionen kennt das Akkadische drei Möglichkeiten. Die häufigere Variante sieht den Einsatz einer Genitivkonstruktion vor. Dabei wird das Argument in den Status Constructus gesetzt, derweil das Prädikat im Genitiv steht. Eigentlich ist hierbei das Prädikat nur Attribut des Argumentes, doch ähnelt es genug einer Possessiv-Konstruktion um es hier zu betrachten.
(99) bīt awīl-im
Haus.SC Bürger-GEN
‚Haus des Bürgers.‘ (KH §151)
Die zweite Möglichkeit nutzt die sogenannten Possessiv-Pronomen. Diese kommen nur an substantivischen Formen vor, welche hierfür auch im SC stehen müssen.
(100) mārās-su
Tochter.SC-3.POSS
‚Seine Tochter.‘ (KH §210)
Als letztes schließlich kann man eine Genitivverbindung auch aufsprengen durch den Determinator und erhält eine andere Form der possessiven Genitivverbindung. Auch diese syntaktische Möglichkeit ist nur mit Substantiven möglich, die jedoch sowohl Subjekt als auch Objekt oder Genitiv sein können.
(101) ina eql-im kir-êm u bît-im ša ilkī-šu
von Feld-GEN Garten-GEN KONJ Haus-GEN DET Lehen-3.POSS
‚Von Feld, Garten und Haus seines Lehens.‘ (KH §38)
Die Wortstellung kann wieder nur etwas über das betrachtete Lexem aussagen, wenn die normale Wortstellung vorkommt. Hierbei steht das Substantiv als Subjekt am Anfang eines Satzes, als Objekt dahinter – und vor dem Prädikat. Zwar sind noch Partikel, Adverbien und Adjektive möglich, doch lässt sich festhalten, dass Substantive standardmäßig dem Prädikat vorausgehen.
(102) šumma awīl-um bīt-am i-pluš
Wenn Bürger-NOM Haus-AKK 3-einbrechen.PST
Subjekt Objekt Prädikat
‚Wenn ein Bürger in ein Haus einbricht (lit.: einbrach)108.‘ (KH §21)
Gegenbeispiele bzw. Fälle zum Nachdenken finden sich auch hier einige. Zunächst einmal sind Possessivkonstruktionen mit sämtlichen Substantiv-Formen möglich, wozu aber auch Partizipien gehören. Das Problem mit Partizipien ist, dass sie im Gegensatz zu ‚richtigen‘ Substantiven Aspekt und Diathese anzeigen können.
(103) mu-šā-kil-um
PTZ-Š(KAUS)-essen-NOM
‚Futtermeister (lit.: der, der essen lässt oder: der, der füttert).‘ (GAG: 65)
Ein wirkliches Problem ist das aber nicht, wenn man Luuks Kriterium beachtet, dass der syntaktisch äußerste Marker zählt, was hier wieder die Wortreihenfolge wäre. Das Partizip ist also ein Substantiv. Auch in der Wortstellung sind substantivische Verbalformen ein Problem. Das Partizip muss man hierfür nicht wiederholen, aber ein Infinitiv wäre interessant. Dieser kann problemlos Argument sein.
(104) epēš-um ul i-bašši
tun.INF-NOM NEG 3-sein.PRS
A P
‚(Da ist) nichts zu machen.‘ (GAG: 203)
Zusätzlich tauchen hier auch Pronomen auf, die an entsprechender Stelle ein Substantiv ersetzen können. Muss man diese also auch zu den Substantiven rechnen? – Dazu gibt uns bereits Luuk selber die Antwort: ja. Pronomen sind nominale Formen, was hier also auch für das Akkadische gilt.
4.5.3. Flexible
Flexible Wortklassen nehmen sowohl LA als auch LP. Wieviele Lexemklassen gibt es wohl im Akkadischen, die beide Marker nehmen können? Zur Erinnerung: es geht um TAM, Diathesen, Wortstellung und Possessiva.
Infinitive – Da sie von verschiedenen Stämmen gebildet werden, besitzen sie sowohl Aspekt als auch Diathesen. Man müsste sie nun als Flexibel bezeichnen. Doch es gilt noch das Kriterium des äußersten Markers. Dieser ist aber (natürlich) stets die Wortstellung, und da Infinitive sowohl in Prädikats-, als auch in Argumentsstellung (ohne zusätzlicher Erweiterung) stehen können, muss man sie als Flexibel bezeichnen.
(105) aššum ṣāb-um ana ṣērī-ka lā alāk-im
wegen Truppe-NOM zum Rücken-2m NEG gehen.INF-GEN
P
‚Wegen dem, dass Truppen nicht zu dir kommen.‘ (GAG: 202)
Partizipien – Auch sie können Aspekt und Diathesen zeigen und dienen entweder als Argument oder Attribut, sind also nominal.
Der Stativ – Was machen wir mit ihm? Ist er ein Tempus wie der GAG sagt, ein eigener Nominalsatz oder eine völlig eigene Form? Auch er kann Diathesen und Aspekt anzeigen, steht aber immer in der prädikativen Stellung. Damit ist er eine Verbalform.
Adjektive – Auch diese zeigen Diathesen in den entsprechenden Stämmen, kommen aber stets nur (wenn nicht gar nur als Attribut) in der prädikativen Stellung vor. Gelten sie damit also als verbale Form?
(106) dunnun-um
stark.sein.D.ADJ-NOM
‚verstärkt (bzw. ‚besonders stark‘)109. (GAG: 62)
Letztlich bietet sich als echtes Problem das Substantiv, welches einen Gutteil der LA-Marker, aber auch einen LP-Marker (die Wortstellung eines Prädikats) aufnimmt. Hier muss man nun untersuchen, wie die verschiedenen von Luuk vorgeschlagenen Annahmen sich auswirken würden. Folgende Möglichkeiten gibt es:
a) Luuk hat das Kriterium Wortstellung nicht klar genug definiert. Eigentlich meint er die Wortstellung in sogenannten Verbalsätzen. Damit gäbe es kein Problem bei Verbal- und Nominalformen. Verbalformen sind Verben und Adjektive, Nominalformen sind Substantive, Infinitive sind flexibel.
b) Luuks Definition (9): Akzeptiert eine Form mindestens ein LA und mindestens ein LP, so ist es eine flexible Form. Damit wären Substantive und Infinitive flexibel.
c) Luuks Definition (10): Akzeptiert eine Form alle LA aber nur einige LP, dann ist sie N (und umgekehrt V). Keine Form des Akkadischen nimmt alle Marker, weshalb diese Definition überhaupt nicht praktikabel ist.
d) Luuks Definition (11): Akzeptiert eine Form die meisten LA und die wenigsten LP, so ist es N (und umgekehrt V). Diese Definition scheint am nützlichsten. Damit wären Substantive N, Partizipien N, Adjektive V, Verbalformen V – und da sie ungefähr gleich viele LA (Wortstellung, Possessiva) und LP (Aspekt, Wortstellung) nehmen bleiben Infinitive flexibel – wenngleich die LA leicht stärker wiegen.
An sich war es dies auch mit den problematischen Formen. Bleibt der Infinitiv, der eine flexible Wortart sein muss.
4.5.4. Der Sprachtyp
Luuk sieht fünf logisch mögliche Sprachtypen, von denen er denkt, dass zwei in der Welt vorkommen: entweder nur N/V/F oder diese sowie F.
|
Nach a) hätte das Akkadische klar abgetrennte N, V und F, also Typ N/V/F. |
|
Nach b) hätte die Sprache V und F, wäre also V/F. |
|
Nach d) hätte sie ebenso klar N, V, und ein F, also Typ N/V/F. |
Damit ergibt sich zumindest schon, dass es egal ist, ob a) zutrifft, denn d) liefert dasselbe Ergebnis.
Laut Luuk wird für wenige Sprachen ein Typ V/F angenommen, unter anderem von Sasse für das Cayuga. Luuk widerlegt alle diese Annahmen und sagt, dass es keinen evidenten Beweis für einen Typ V/F gibt. In diesem Fall ignoriert Annahme b), dass Substantive mehr LA nehmen als LP, weshalb ich d) für evidenter halte. Demnach wäre das Akkadische ein Typ N/V/F und kann Luuks Annahmen nicht falsifizieren, höchstens unterstützen.
5. Fazit
Zeit zu rekapitulieren, was wir erfahren haben. Zur Erinnerung: Wir wollten das Akkadische anhand einiger ausgewählter typologischer Wortarten-Theorien untersuchen und gleichzeitig umgekehrt diese Theorien anhand des Akkadischen überprüfen. Angenommen wurde, dass einerseits das Akkadische für einige Theorien Probleme bringt, andererseits die klassische Einteilung der Wortarten des Akkadischen nicht perfekt sein würde.
Zur Grammatik des Akkadischen beruft man sich noch immer vor allem auf den GAG, der aber seit Jahren nur noch korrigiert wird. Vor allem betreffend der Wortarten sowie der Problemfälle wie Infinitiv und Partizip finden sich auch keine Untersuchungen. Der GAG unterteilt die Wortarten des Akkadischen nach diskurstechnischen Kriterien: Substantive bezeichnen etwas, Verben sind Handlungen und Adjektive modifizieren. Trotzdem führt er auch viele formale Kriterien an. Die Probleme betreffend der ‚Zwischenformen‘ sowie der ambigen Wurzeln übergeht er aber größtenteils. An geschlossenen Formen kennt er Pronomen, Numeralien und Partikel. Für seine Einteilungen fanden wir größtenteils zwar Berechtigung, aber auch viele Korrekturen.
Schachter & Shopen gaben klare Definitionen von Wortklassen mit zugehörigen Kriterien vor. Diese Kriterien sind mal stärker, mal schwächer in Sprachen zu finden, weshalb die jeweilige Bündelung sprachspezifisch zu erstellen ist. Trotzdem geben sie Klassen vor, in welche man die Formen einer Sprache einteilen muss. Auch die klassischen akkadischen Grammatiken benutzen diese Wortklassen mit nur teils veränderten Kriterien. Die Grammatiken sehen das Problem der offenen Klassen, beharren aber auf eine Unterscheidung zwischen Substantiven, Adjektiven und Verben. Wie wir gesehen haben, ist dies aber anhand der Kriterien von S&S kaum gerechtfertigt, da es Formen gibt die zu zwei Klassen gehören könnten. Oberflächlich treffen bei synchroner Betrachtung viele Kriterien zwar zu, jedoch gibt es dann zuviele Ausnahmefälle: Stativ, Partizip und Infinitiv. Noch schwieriger ist es mit den geschlossenen Klassen. Die Grammatiken fassen alle (außer Numerale und Pronominale) schlicht als ‚Partikel‘ zusammen, was vielleicht sogar gerechtfertigt ist, da viele ihrer Formen klassenübergreifend sind und viele Gemeinsamkeiten haben. Funktional kann man aber viele der von S&S postulierten Subklassen erfassen.
Hengevelds Theorie kam erstaunlich gut klar mit dem Akkadischen, berücksichtigt man die viele Kritik, die an ihr verübt wird (z.B. von Croft110). Sie identifiziert klar Verben und Substantive, wozu dann auch Infinitive gehören. Auch Adjektive und Adverbien werden postuliert. Ignoriert werden dabei aber natürlich alle Feinheiten der Sprache, vor allem die Wurzeln, was auch bei S&S vorkam. Die Sprache wäre bei Hengeveld am ehesten ein Typ 3/4 flexibles System, wenn man Adjektive als abgeleitet ansieht, ansonsten Typ 4/5 rigide – also kaum etwas ‚besonderes‘.
Auch Luuk macht das Akkadische überraschend wenige Probleme. Zwar scheint es kleine Lücken in seiner Theorie zu geben, doch hat man diese überwunden, kann man seine Annahme bestätigen, dass es Sprachen des Typs N/V/F gibt. Nach ihm hätten wir im Akkadischen also klare Substantive, Verben und Flexible, wobei unsere ‚Problemfälle‘ diese Flexiblen sind und man sagen könnte, dass die Klasse der Substantive klein ist und sich auf die ursprünglichen beschränkt. Festhalten sollte man noch, dass auch Luuks Theorie keine Möglichkeit bietet die Feinheiten der Sprache zu bestimmen – und vor allem auch etwas über die geschlossenen Klassen auszusagen.
Durch Crofts Fokus auf Semantik konnten wir endlich tiefer in die Differenzierung vorstoßen. Es stellte sich heraus, dass akkadische Substantive und Adjektive prototypisch sind. Eine neue Überraschung fand sich aber bei den Verben, die man nun in zwei Subklassen unterteilen kann: dynamische und statische Verben. Das tun zwar auch die Grammatiken, aber nur sehr locker. Die dynamischen sind hierbei klare Prototypen, derweil die statischen an der Grenze zu Adjektiven stehen. Dies verschärft die Frage, ob nun die Adjektive von den statischen oder umgekehrt stammen. Die ‚Problemfälle‘ Stativ, Partizip und Infinitiv sind wenig überraschend keine Prototypen, aber nehmen auch keine klaren Stellungen, sondern teils mehrere Positionen ein. Der Stativ ist klar modifizierend, kann aber von Objekten oder Aktionen stammen. Das Partizip stammt von Aktionen, kann dabei aber entweder referieren oder modifizieren. Infinitive schließlich sind meist Aktionen, die entweder referieren oder prädizieren – doch so einfach ist es nicht, wenn man die statischen Verben als Eigenschaften ansieht. Crofts neues System vertieft die Kluft zwischen dynamischen und statischen Verben noch stärker. Vereinfacht lässt sich dadurch schlussfolgern, dass der Infinitiv zwischen Substantiv und Verb, das Partizip zwischen Substantiv und Adjektiv und der Stativ zwischen Adjektiv und Verb steht. So sind alle Möglichkeiten abgedeckt. Es lässt sich jedoch nur schwer sagen, wie man in Crofts System die Wortklassen genau einteilen sollte.
Letztlich haben wir Sasse folgend Kriterien betrachtet, welche die anderen Theorien außer Acht ließen. Die Grammatiken des Akkadischen setzen traditionellerweise auf semantische Kriterien, um die Wortklassen einzuteilen, was bei Sasse diskurstechnische Kriterien heißt und von Croft Prototypen genannt wurde. Wie schon erwähnt kann man daran aber nur einige klar ausmachen, derweil es viele Grenzfälle gibt. Ontologische Kriterien nützen kaum etwas, wenn man ab der Stammebene aufwärts die Formen betrachtet, da es zwar einige Bedeutungsklassen gibt, die aber nicht konsequent sind. Untersucht man jedoch nur die Wurzeln, so findet man Objekte, Handlungen und Eigenschaften, also die drei großen Inhaltsklassen. Am aufschlussreichsten ist interessanterweise die Morphologie: nur verbale Formen (prädizierende Aktionen und Eigenschaften) nehmen die typischen Verb-Affixe, während nur Substantive (fast) sämtliche Nominalaffixe nutzen, derweil die anderen nominalen Formen jeweils einen Ausschnitt nehmen und Adjektive sogar ihren eigenen Plural haben. Auf dieser Ebene entdeckt man ebenso Substantive und Verbalformen und muss Infinitive, Stative und Partizipien als Zwischenformen bezeichnen. Die syntaktische Ebene sagt nicht mehr aus, ebenso wie semantische Funktionen. Auch morpholexikalische Kriterien bringen keine neuen Erkenntnisse.
Wie wir sagten, fanden wir auf der abstrakten Wurzelebene durch ontologische Kriterien Objekte, Handlungen und Eigenschaften, die auf den höheren Ebenen ausdifferenziert sind in Nominal- und Verbalformen, wozu Substantive, Adjektive und Verben gehören, sowie dann weiterhin auch die Zwischenformen Partizip, Infinitiv und Stativ, oder schafft gleich neue Wortklassen für diese Formen. Neben den abstrakten Wurzeln sind hierbei vor allem morphologische Formen und Affixe entscheidende Kriterien. Neben diesen Hauptklassen finden sich auch noch unabhängige geschlossene Klassen: Pronomen sind klar getrennt von den anderen, Numerale haben Beziehungen zu Substantiv und Adjektiv und bei den Partikeln gehören viele mehreren Klassen an, so dass man besser eine Hauptklasse und mehrere Subklassen annimmt, als zuviele Hauptklassen.
Somit haben wir gesehen, wie einige Theorien Unzulänglichkeiten aufweisen (Schachter & Shopen), andere erstaunlich gut mit den Daten zurecht kommen (Hengeveld, Luuk), jedoch dabei auch kaum ins Detail gehen und konnten dank Croft und Sasse über verschiedene analytische Ebenen zu einem Ergebnis kommen.
Die Grammatiken scheinen größtenteils durchaus Berechtigung für ihre Einteilung der Klassen zu haben, jedoch beschreiben sie diese nicht Ebenen-differenziert. Es gibt aber noch einige Details, die kaum klar zu entscheiden sind, solange man sich nicht auf eine Analyseebene sowie eine Betrachtungsweise (diachron vs. synchron) festlegt. Hier haben wir uns auf die synchrone Ebene beschränkt, indem wir nur das Altbabylonische untersuchten. Eine Differenzierung der Ebenen nützt nur, wenn man zwischen Haupt- und Subklassen unterscheiden will.
Dank den Untersuchungen von Wurzel- und höheren Ebenen beschreibe ich nun mein Ergebnis, welche Wortarten das Akkadische hat: Substantive sind eine große Klasse, die zwei Subklassen haben. Die echten Substantive sind eine kleine Subklasse, derweil der Rest aus abgeleiteten Formen besteht. Echte Verben sind nur die dynamischen, derweil die statischen eine zweite Subklasse bilden. Es lässt sich synchron nicht sagen, ob statische Verben von Adjektiven kommen oder umgekehrt, durch eine Betrachtung der Wurzeln entscheide ich mich aber für ersteres. Drei Formen (Partizip, Infinitiv, Stativ) stehen zwischen den Hauptklassen als flexible Formen bzw. Klassen. Letztlich gibt es noch Pronominale und Numerale und eine Klasse von Partikeln, bei denen die Subklasse der Adverbien und Subjunktionen die größten sind. Siehe auch Tab. 9.
Für zukünftige Arbeiten wäre es interessant, die ‚Problemformen‘ genauer zu untersuchen und ihre Stellung zu definieren. Weiter wäre es an der Zeit, einen Nachfolger für das GAG zu finden.
6. Referenzen
-
Borger, Rykle (2006): Babylonisch-assyrische Lesestücke. Heft 1: Die Texte in Umschrift. Rom: Editrice Pontificio Istituto Biblico, 3. Auflage.
-
Bucccellati, Giogio (1968): „An interpretation of the akkadian stative as a nominal sentence.“ In: Journal of Near Eastern Studies, 1/27.
-
Caplice, Robert (2002): Introduction to Akkadian. Rom: Editrice Pontificio Istituto Biblico, 4. Auflage.
-
Croft, William (1991): Syntactic Categories and Grammatical Relations: The Cognitive Organization of Information. Chicago: University of Chicago Press.
-
Croft, William (2000): „Parts of speech as language universals and as language-particular categories“. In: Vogel, P.M. & Comrie, B. (eds.): Approaches to the typology of Word Classes. Berlin: de Gruyter.
-
Edzard, Dietz O. (2004): Geschichte Mesopotamiens. München: C. H. Beck.
-
Harper, Robert F. (1904): The Code of Hammurabi. Chicago: University of Chicago Press.
-
Hengeveld, Kees & Rijkhoff, Jan (2004): „Mundari as a flexible language”. In: Linguistic Typology 9/3:406-31.
-
Langacker, Ronald W. (1987): Foundations of cognitive grammar. Stanford: Stanford University Press.
-
Luuk, Erkki (2009): „Nouns, verbs and flexibles: implications for typologies of word classes“. In: Lang. Sci., doi: 10.1016/j.langsci.2009.02.001.
-
Sasse, Hans J. (1993): „Das Nomen – eine universale Kategorie?“ In: STUF 46, Berlin 1993, S. 187 – 221.
-
Sasse, Hans J. (2009): „Nominalism in Austronesian: A historical typological perspective“. In: Theretical Linguistics 35-1, 167 – 181. Berlin: de Gruyter.
-
Schachter, Paul (1985): Parts-of-speech systems. In: Shopen, Timothy (Eds.): Language typology and syntactic description, I. University of Cambrige: Cambridge.
-
Schachter, Paul & Shopen, Timothy (2007): „Parts of Speech“. In: Schachter, Paul (Eds.): Language typology and syntactic description, I. University of Cambrige: Cambridge.
-
Streck, Michael P. (2005): Sprachen des Alten Orients. Wiss. Buchges.: Darmstadt.
-
Tropper, Josef (2002): Ugaritisch. Kurzgefasste Grammatik mit Übungstexten und Glossar. Münster: Ugarit.
-
Van Lier, Eva (2009): Parts of Speech and Dependent Clauses. Utrecht: LOT.
-
Von Soden, Wolfram: Grundriss der akkadischen Grammatik. Rom: Pontificium Institutum Biblicum 1995, 3. Auflage.
-
Wierzbicka, Anna (2000). „Lexical prototypes as a universal basis for cross-linguistic identification of „parts of speech““. In: Vogel, P.M. & Comrie, B. (eds.): Approaches to the typology of Word Classes. Berlin: de Gruyter.
-
Wilcke, Claus (1985): „Liebesbeschwörungen aus Isin“. In: Zeitschrift für Assyriologie 75.
7. Abkürzungsverzeichnis
| A – Argument
aAKK – Alt-Akkadisch aB – Altbabylonisch ADJ – Adjektiv ADV – Adverb Akk. – Akkadisch AKK – Akkusativ C – Konsonant DA – Distributionelle Analyse DAT – Dativ DEM – Demonstrativ-Pronomen DET – Determinativ-Pronomen DISTRIB – Distributiv-Zahl DITR – Ditransitives Verb F – Flexibel FEM – Feminin FUT – Futurum GAG – Grundriss der akkadischen Grammatik GEN – Genitiv HS – Hauptsatz IMP – Imperativ INDF – Indefinit-Pronomen INTER – Interrogativ-Pronomen INTR – Intransitives Verb INTRJ – Interjektion jB – Jung-Babylonisch KH – Kodex Hammurapi KHR – Kohortativ KRD – Kardinalzahl LA – Linguistisches Argument LOK – Lokativ-Adverbialis LP – Linguistisches Prädikat MULT – Multiplikativzahl N – Nomina NEG – Negation |
NOM – Nominativ
NPF – Nonperfekt NS – Nebensatz NUM – Numerus O und OBJ – Objekt OB – Altbabylonisch OBL – Obliquus ORD – Ordinalzahl OS – Obersatz P – Prädikat PF – Perfekt PL – Plural POSS – Possessiv PPN – Personalpronomina PRK – Prekativ PRHB – Prohibitiv PRS – Präsens PST – Präteritum (Past) PTZ – Partizip RS – Relativsatz S und SUBJ – Subjekt SA – Status Absolutus SBJV – Subjunktiv SC – Status Constructus SG – Singular SR – Status Rectus Subst – Substantiv TAM – Tempus, Aspekt, Modus TERM – Terminativ-Adverbialis TR – Transitives Verb TS – Temporalsatz VADJ – Verbal-Adjektiv V – Verb bzw. Vokal (kontextabhängig) VET – Vetitiv VNT – Ventiv |
8. Tabellenverzeichnis
(3) Tab. 1: Das System der Sprachen der Welt nach Hengeveld. 38
(4) Tab. 2: Konzeptuelle Kategorien (Croft: 89). 41
(5) Tab. 3: Semantische Klassen nach Croft (vgl. van Lier 2009: 34). 42
(6) Tab. 4: Typen der Welt (vgl. Sasse 1993). 45
(76) Tab. 5: Prototypen von Croft. 86
(77) Tab. 6: Ergebnis der Prototypen nach Croft. 86
(78) Tab. 7: Semantische Klassen nach Croft (vgl. van Lier 2009: 34). 87
(87) Tab. 8: Ergebnisse der Untersuchung nach Sasse. 96
(88) Tab. 9 Wortklassen des Akkadischen von der Wurzel zu den Subklassen. 100
1Die z.B. Nomen als anfassbare Dinge und Verben als Tätigkeitswörter definieren.
2Für Noun.
3 Bzw. als Assyriologie und unter anderen Namen bekannt.
4Wie wir noch sehen werden rein semantische.
5Ebenfalls von 2002 gibt es noch eine Grammatik von Tropper zum Ugaritischen. Die eher allgemeingültigen Überlegungen zum Semitischen die er dort vornimmt, sind teilweise gute zusätzliche Denkanstöße.
6Hier wird davon ausgegangen, dass der Begriff Nomina alle Wortklassen umfasst, die deklinierbar sind, derweil Verben konjugiert werden. Natürlich ist das wieder nur eine starre Definition, doch reicht sie, um die Positionen der vorgestellten Autoren zu verstehen.
7Ein Wort zur Aussprache der verwendeten Zeichen der Umschrift: Es folgt zwar noch eine Erläuterung der akkadischen Phoneme, doch werden im Allgemeinen die Zeichen genauso ausgesprochen, wie die entsprechenden Phoneme im Arabischen, für die man diese Zeichen ursprünglich nutzte: š=sch (Zeichen Shin); ā, ī usw. sind lange Vokale; ṭ, ṣ spricht man emphatisch bzw. als Affrikate; q ist ein emphatisches K (also /q/); ḫ ist das /x/.
8Die Kehllaute, in den älteren Grammatiken werden diese noch Laryngale genannt.
9Assyrien stieg im Laufe seiner Geschichte (ca. 2000 bis 612 v. Chr.) von einem Handelsstadtstaat hin zu einem Reich auf, das zeitweise ganz Mesopotamien (also auch Babylonien) bis zu seinem Untergang beherrschte, derweil Babylonien (ab ca. 1900 v. Chr.) nur selten ein vereinter Staat war, vor allem unter Hammurapi (etwa 1728 bis 1686 v. Chr.) und später noch einmal nach dem Untergang Assyriens bis zum Einfall der Perser (539 v. Chr.). In der restlichen Zeit war es meist ein loses Bündnis von Stadtstaaten. Vgl. hierzu vor allem Edzard (2004), der einen kompletten Überblick bietet.
10In den deutschen Varianten wird der erste Buchstabe klein geschrieben; in den englischen groß.
11Es ist eine interessante Frage, inwieweit die Dialekte untereinander verständlich waren. Durch viele Kopierfehler von Schreibern die jahrtausendealte Texte kopierten kann man schließen, dass für neue Dialekte alte teilweise nicht mehr ganz verständlich waren; ebenso dürften die Babylonier Probleme mit den veränderten Vokalen in assyrischen Formen gehabt haben, die für die Babylonier nach völlig anderen Bedeutungsklassen klingen mussten.
12Und nach Sumerisch und Altägyptisch die älteste Sprache mit Schriftzeugnissen.
13Es ist umstritten ob Eblaitisch eine eigene Sprache oder ein Dialekt des Akkadischen ist. Ebenso ist umstritten, ob die Dialekte des Akkadischen eigene Sprachen oder wirklich Dialekte waren. Vgl. hierzu den GAG, Edzard (2004) und Streck (2005).
14Spätere Dialekte des Babylonischen verzichteten vor allem immer stärker auf klare Kasus und nutzten andere Schreibstile und Lexeme. Vgl. den GAG.
15ʾammu-rāpi ‚Der Onkel ist heilend‘ statt dem älter angenommen ḫammu-rābi ‚Der Onkel ist groß‘. Vgl. u.a. Edzard (2004).
16Zumindest in Briefen und persönlichen Texten. Offizielle und vor allem juristische Texte halten sich stärker an die Grammatik.
17Eine Plene-Schreibung bedeutet die graphische Darstellung einer Längung, z.B. ta-a = tā oder at-ta = atta und nicht ata.
18Dies sagt aber nur der GAG und wie er darauf gekommen ist teilt er kaum mit.
19Dem semitischen Aleph, fortan geschrieben: ‚
20Im normalem Umgang werden sie aber meist /s/, /ʃ/ und /z/ artikuliert, da ursprünglich in der Forschung auch diese Laute angenommen wurden.
21Möglicherweise kam er durch die Poetik auf diese Erkenntnisse. Dort sind Formen, Silbenlängen und wohl auch Akzente wichtig.
22Beide Klassen gehen größtenteils auf gemeinsame Wurzeln zurück; im Endeffekt sieht man sie aber als getrennte Klassen an.
23Jedoch ohne Zusatz nur in der 3. maskulin und um diese aussprechen zu können muss ein Vokal eingefügt werden: PvRvS. Außerdem gibt es eine Klasse, die zwei unterschiedliche Vokale in Präsens und Präteritum hat; man also nur einen Vokal erkennt.
24Synchron lässt sich aber nie sagen, ob ein ‚Substantiv‘ vom ‚Verb‘ oder umgekehrt stammt. Im Folgenden werde ich, da ich auch nur das Altbabylonische betrachte, synchron untersuchen.
25Aufgrund der zahlreichen Lautgesetze, die z.B. zwei Ejektive in einer Wurzel verbieten, kommen nicht alle logisch möglichen Varianten von Wurzeln in der Praxis vor.
26Im Großteil differenziert der GAG klar zwischen „Nomina ‚im Allgemeinen’“, zu denen Substantive und Adjektive gehören, und den eigentlichen Substantiven. Manchmal jedoch spricht er von „Nomen“, wobei dann nicht immer klar ist, was gemeint ist; Nomina oder Substantive?
27Natürlich könnte man hier auch eine Homophonie zwischen einem anaphorischen und einem substantivischen Pronomen annehmen, aber dagegen spricht auch die folgende Besonderheit im Bereich der Kasus.
28Zumindest beim PPN. Ansonsten hat es noch zahlreiche Funktionen.
29Wie es im Akkadischen und auch sonst im Semitischen üblich ist, nicht für sämtliche logische Möglichkeiten.
30Laut Tropper (2002) bilden die Nominalformen samt ihren Bedeutungsklassen erst Substantive und Adjektive; vorher sind die bloßen Wurzeln also ambig bzw. vage. Damit steht er im Gegensatz zum GAG und bietet gute Denkanstöße für später.
31Zu den Formen treten dann noch eventuelle Endungen, vor allem Kasus.
32Individuen aus Mengen. Mit dem natürlichen Geschlecht hatte es also nur wenig zu tun.
33Die adverbiale Funktion findet sich auch noch in der Prosa.
34Šamaš, Ištar, Enlil – dagegen Anum. Götter und viele Städte hatten noch ehesten das, was man (individuelle) Eigennamen nennen kann.
35Der GAG sagt, sie sind eigenständig und die anderen Formen aus ihnen abgeleitet. Das zu untersuchen ist hier auch Aufgabe, da ich ernsthafte Zweifel daran habe.
36Zu den Stämmen einmal Tropper (2002: 54) in seinen eigenen Worten, der es bereits gut ausdrückte: „Semitische Sprachen kennen eine große Anzahl unterschiedlicher Morphemtypen. Zum Ausdruck verbaler Aktionsarten (z.B. faktativ, kausativ, iterativ) sowie verbaler Diathesen (z.B. aktiv vs. passiv). Sie werden „Verbalstämme“ genannt. Der einfache Grundstamm des Semitischen ist morphologisch merkmallos. Zur Bildung bzw. Differenzierung der übrigen, „abgeleiteten“ Verbalstämme werden spezifische morphologische Merkmale eingesetzt.“
37Nach Tropper (2002) werden in der verwandten Sprache Ugaritisch TAM durch Konjugation, Diathese und Aktionsart durch die Stämme, Genus, Numerus und Person durch Affixe angezeigt. Für das Akkadische gilt dies parallel. Tropper unterscheidet für das Ugaritische finite (‚echte‘ Verben) und nominale Verbformen, wobei letztere auch Diathese und Aktionsart anzeigen, welche traditionell Kategorien der Verben sind.
38Tropper (2002) bezeichnet den Stativ des Ugaritischen als etymologisch nominale Prädikationskonstruktion (im Deutschen: x (ist) y), an die ursprünglich die Pronomen-Suffixe gehängt wurden, welche sich letztlich zu den bekannten Suffixen entwickelten. Für das Akkadische könnte man dasselbe annehmen.
39Oder vielleicht ist NPF besser, da er am ehesten das Gegenteil des Perfekts ist.
40Analog zu anderen semitischen Sprachen, die einen Perfekt aber kein Präteritum kennen.
41In seiner emphatischen Funktion kontrahiert es nicht mit dem Präfix.
42Der negative Imperativ.
43Dies ist eine der beiden Negationen.
44Ein starker negativer Wunsch; kein ‚richtiges‘ Verbot.
45Nach dem Vorbild klassischer Wörterbücher, auch wenn es meist sinnvoller ist nach einer Wurzel zu suchen.
46So zumindest der GAG. Mir persönlich sind mehr substantivische untergekommen.
47I‘, bei denen der Vokal e ist.
48Tropper (2002) zählt zu den Partikeln für das Ugaritische alles, was nicht flektiert (im Ugaritischen: Adverbien, Präpositionen, Konjunktionen, Anrufe, Affirmative, Wünsche, Negationen, Existenzialia und Klitika). Es ist also anzunehmen, dass dies für das Akkadische ebenso getan wurde.
49Für das Ugaritische unterscheidet Tropper (2002) zwischen zwei hauptsächlichen Satztypen, je nachdem, ob das Substantiv oder ein Verb Prädikat ist.
50Wobei strikt genommen der ursprüngliche Aufsatz (bzw. das Kapitel des Buches) aber von Paul Schachter allein stammte: 1985.
51Im Grunde genommen ist es schwer, im Englischen strikt zwischen Substantiven, Adjektiven und Verben zu trennen.
52Man beachte, dass bei diesem Beispiel stark simplifiziert wurde.
53Nouns
54Wie immer bei diesem Begriff ist schwer zu sagen, ob Substantive oder Nomina gemeint sind.
55Diesen Unterschied haben wir ja bereits und werden wir erneut beim Akkadischen sehen.
56Beispiel aus S&S (2007), dort ’nüaizi‘ statt ’nühaizi‘.
57Da sie als eigene Äußerungen bezeichnet werden (S&S 2007: 57) ist die Frage, inwiefern sie Pro-Formen sind.
58Was nur logisch ist.
59‚rigid‘.
60Übersetzung vielleicht als ‚Inhaltswort‘?
61Was auch Luuk vertritt und Hengeveld in späteren Arbeiten sozusagen ‚eingesehen‘ hat.
62z.B. „Typology and universals“ (2003) und „Radical Construction Grammar“ (2001)
63Sasse (1993) spricht explizit von Nomen; schon allein im Titel. Ob er darunter die klassischen Nomen (wozu Substantive, Adjektive, Artikel, Pronomen gezählt werden) oder nur Substantive meint, wird nicht klar. Dies ist seine größte Schwäche. Deshalb wird hier seine Terminologie übernommen.
64Also der Semantik, wie es auch andere Autoren hier schon sagten.
65Hier spricht er sich also für sprachliche Relativierung aus.
66Lexikalische Kategorien (für Wortklassen) können total komplementativ sein, eine überlappende Distribution haben oder voneinander Subklassen sein.
67Probleme hierbei: Festlegung von Kontexten die vielleicht widersprüchliche Ergebnisse liefern und die Abgrenzung von Flexion und Derivation.
68Er beruft sich hier auf Croft (1991).
69Ein sehr interessanter Punkt wenn man das Akkadische betrachtet.
70Noun
71Noun = N.
72Natürlich sollte man nicht gerade einen Satz mit freier Satzstellung heranziehen, wenn man die normale Wortstellung des Akkadischen zeigen will…
73In diesem Fall ist aššat- eine feste Konstruktion. Nie kommt ašš- ohne das Femininum vor. Anders ist das, wenn aus einem eigentlich maskulinen Lexem ein feminines wird, wie in: šarrum ‚König‘ → šarratum ‚Königin‘.
74Inu ist eine abgekürzte Form von inuma ‚als‘.
75Steht sowohl für ilum ‚Gott‘ als auch Anum (der Himmelsgott).
76Hier ist die Funktion die eines Attributs, also adjektivisch. Eine substantivische Form könnte z.B. mudī allein sein: ‚die, die wissen‘ = ‚die Wissenden‘.
77Kurzform von ina ‚in, an, unter‘.
78Man beachte die umgekehrte Wortreihenfolge.
79Die normale Form dieses Adjektivs lautet dannum ’stark‘ und das Verb danānum ’stark sein‘.
80Das Subjekt kann aber ‚versteckt‘ sein und damit dieses Attribut allein stehen.
81Die Diskussion inwiefern man unterscheiden darf zwischen substantivischen und verbalen Wurzeln kommt im Abschnitt über Sasse.
82Was man eh tun sollte, da man sich sonst mit solchen Izierern ziemlich verzetteln kann.
83Prominentes Beispiel: kī. Als Präposition ’so wie‘, als Adverb ‚wie?‘, als Subjunktion ‚Wenn‘ und andere Funktionen.
84Das Dativ-Suffix ist formgleich mit dem Ventiv, weshalb jener von diesem stammen muss. Es wird angenommen dass die Bedeutung ursprünglich ein ‚zu mir‘ war.
85Dessen können wir uns ja immer noch nicht sicher sein.
86Vielleicht ist das auch ein Grund, warum in Wörterbüchern semitischer Sprachen (abgesehen von den alten Sprachen wie Akkadisch, Altaramäisch und Ugaritisch) nach dem Imperfekt zitiert und sortiert wird und nicht nach dem Infinitiv.
87Was aber nicht völlig dasselbe ist.
88Adjektive als Kopf einer Phrase zähle ich zu den Attributphrasen.
89Das Partizip ist hier attributiv.
90Hier sind gleich zwei Partizipien, eines Subjekt, das andere Attribut.
91Auch übersetzbar als: ‚Der Fluss Tigris ist unter ihm.‘
92Ohne šumma würde die Übersetzung lauten: Ein Bürger brach in ein Haus ein.
93Der Š-Stamm (Kausativ-Stamm) von ’nehmen‘ kehrt die Bedeutung um zu ‚geben‘.
94Wurzel: ṣḫr. Infinitiv: ṣaḫārum ‚klein sein‘, Adjektiv: ṣeḫrum ‚klein‘.
95Das Adjektiv kongruiert mit dem zugehörigen Substantiv.
96Man beachte die umgekehrte Wortreihenfolge.
97Das Verb ebēru ‚umarmen‘ hat im D-Stamm u.a. die (rechtliche) Bedeutung beschuldigen.
98Das ist ein Wortspiel, da es auch ‚Geliebter‘ heißen kann.
99Für ausführliche Beispiele siehe den Abschnitt über Schachter & Shopen.
100Abgeleitet von amārum ’sehen‘: ‚der Sehende‘ bzw. ‚der, der sieht‘.
101Metathese von ‚ditabbab‘.
102Diachron mögen Forscher erkannt haben, dass die entsprechenden Verben von den Adjektiven kommen, wobei mir jedoch keine Argumente dafür bekannt sind. Auch ist dies kein Argument für eine synchrone Betrachtung wie sie diese für das Altbabylonische ist, denn synchron lassen sich bloß Wurzeln mit einer abstrakten Bedeutung erkennen und es spricht mehr dafür diese den Verben zuzuordnen: Von Verben können wesentlich mehr Formen mit entsprechenden Bedeutungen abgleitet werden, so auch Adjektive, derweil von diesen nur die Verben theoretisch (und nicht so greifbar wie bei Verben mit entsprechenden Formen) ableitbar sind. Ein Argument für die andere Seite ist, dass die statischen Verben sich ontologisch und semantisch deutlich von den dynamischen Verben unterscheiden.
103Genau hierin liegt auch das Problem, denn diese Affixe sind Adverbialisierer. Die minimale Gruppe ‚echter‘ Adverbien hat überhaupt keine Affixe, was damit ihre Besonderheit ist.
104Sieht man davon ab, dass nur Pronomen einen Dativ haben.
105Diese drei stehen allesamt zwischen nominal und verbal mit unterschiedlichem Schwerpunkt.
106Diese Form verstößt durch die Geminate aber gegen die Phonotaktik.
107Der D-Stamm ist hier faktativ; ein intransitives Zustandsverb wird zu einem dynamischen, um einen Zustand herbeizuführen und kann intransitiv bleiben oder transitiv werden.
108Ohne šumma würde die Übersetzung lauten: Ein Bürger brach in ein Haus ein.
109Die normale Form dieses Adjektivs lautet dannum ’stark‘ und das Verb danānum ’stark sein‘.
110Wobei man aber sagen könnte, dass sie es nur kann, weil sie eben das tut, was Croft kritisierte: Feinheiten missachten und Formen zu stark zusammenfassen.



 Veröffentlicht von kaltric
Veröffentlicht von kaltric