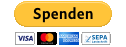Diesen Text gibt es auch als Buch.
Abstract
Spracherwerb ist gleichzeitig auch Erwerb kultureller Kompetenzen, was unter dem Begriff Sprachsozialisation bekannt geworden ist. Diese Arbeit beleuchtet zunächst den theoretischen Begriff um dann Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Sprachsozialisation einiger ausgewählter Sprachen zu zeigen, deren definitive Vergleichbarkeit aber noch zu untersuchen wäre.
Abstract 1
1. Einleitung 2
2. Sprachsozialisation. 2
3. Die Studien 5
3.1. Inuit: Soziale Tradition vs. Individuelle Moderne 6
3.2. Kwara’ae: Soziale Kompetenz in der Egalität 8
3.3. Basotho: Sprache als Überlebensmittel 10
3.4. Kaluli: Das Gleichgewicht der Gesellschaft bewahren 11
3.5. Japanisch: Soziale Unterwürfigkeit 13
3.6. Taiwan: Autoritäres Beschämen als Moralerziehung 15
4. Vergleich und Diskussion 17
5. Fazit 18
6. Referenzen 20
1. Einleitung
Viele Studien wurden durchgeführt zu untersuchen, wie der Spracherwerb vonstatten geht. Erst spät merkte die Spracherwerbsforschung, dass man sich hierbei zu sehr auf die westliche Welt konzentrierte und die restliche ignorierte. Als dies überwunden war, stellte man fest, dass verschiedene Kulturen verschiedene Strategien nutzen, ihren Kindern Sprache beizubringen, wobei sie ihnen aber vor allem auch stets ihre kulturellen Besonderheiten und soziale Kompetenz vermitteln, was man Sprachsozialisation nennt.
Eine Frage ist, welche Strategien interkulturell genutzt werden und worin sich verschiedene Kulturen bei dem Lehren ihrer Sprachen unterscheiden und auch gleichen. Dies möchte ich zumindest ansatzweise untersuchen. Aufgrund der teils großen Unterschiede in den Studien betreffend die Probanden (v.a. Anzahl, Alter, Entwicklung) werden keine absolut gültigen Aussagen zu treffen sein, doch soll es auch eher um den groben Überblick und allgemeine Tendenzen gehen.
Nicht untersucht werden z.B., wie sich Schule oder Zweitspracherwerb auswirken, da dies diesen Rahmen sprengen würde. Einige der folgenden Studien (v.a. Cook (2008) und Crago et. al. (1993) ) wiesen aber bereits darauf hin, dass ein Teil der Sozialisation erst in der Schule geschieht. Andere Kulturen wiederum aber haben gar keine Schule.
Die Gliederung sieht daher wie folgt aus: Zunächst sollte ich kurz erklären, was Sprachsozialisation ist und welche Auswirkungen sie haben kann. Daraufhin zeige ich erfolgte Studien zu teils grundverschiedenen Sprachen und Kulturen, gefolgt von der Diskussion.
2. Sprachsozialisation.
Nach Crago (1992) lernen Kinder Sprachen stets in einem sozialen und kulturellen Kontext. Der Begriff Sprachsozialisation käme ursprünglich von Ochs & Schieffelin (1984), nach denen kommunikative Kompetenz nötig sei um ein gutes Mitglied sowohl einer Gesellschaft als auch einer Kultur zu werden. Studien der Sprachsozialisation haben die Aufgabe herauszufinden, wie dies geschieht und welche Rolle dabei die Sprache spielt. Wenn Erzieher zu ihren Kindern Sprache benutzen tragen diese Äußerungen zeitgleich auch stets Hinweise darauf, was diese Kultur erwartet. Das lässt sich auch in unseren Kulturen sehen, wenn z.B. einem Kind ein Märchen erzählt wird, bei dem es um moralische Werte geht.
Ochs & Schieffelin (1984) schrieben, dass Spracherwerb und Sozialisation, die durch Sprache erfolgt, einst als strikt getrennt gesehen wurden. Kulturelle Faktoren beim Spracherwerb nannte man bloß Kontext. Tatsache ist aber, dass Erzieher, Eltern, Pfleger und wer sonst für die Kindeserziehung zuständig ist, starken Wert darauf legen den Kindern auch kulturelle Werte und soziale Verhaltensweisen zu vermitteln. Sprachsozialisation ist demnach ein Vorgang der Sozialisation, der durch kulturspezifische sprachliche Mittel den Kindern zuteil wird, derweil diese gleichzeitig besonders auch selber die angewendeten sprachlichen Mittel dabei lernen. Man kann keinem Kind soziales Verhalten beibringen ohne dabei Sprache zu benutzen und wer Sprach lehren will nutzt häufig Beispiele, die täglich vorkommen und praktischer Natur sind. Spracherwerb und Sozialisation sind also nicht, wie früher angenommen, voneinander trennbar. Studien erfolgten jedoch nur wenige; die meisten versuchten noch Kultur und Erwerb zu trennen. Dies merkt man vor allem an Studien, die Kinder der eigenen Sprache untersuchen: Die meisten Studien konzentrieren sich auf westliche Kinder und werden von westlichen Forschern erstellt, denen kulturspezifische Mittel und Formen gar nicht mehr auffallen. In Sprachsozialisationsstudien muss man demnach vor allem auf das sprachliche Umfeld des Kindes und die Erwartungen der Eltern an das Kind sprachliche und soziale Strukturen aufzunehmen achten. Dazu werden meist Longitudinal-Studien durchgeführt, bei denen der Forscher viele Stunden natürlicher Handlungen aufnimmt.
Peters & Boggs (1986) gingen das Thema etwas theoretischer an; benannten interaktionale Routinen, die Grundlage für den Spracherwerb von Kindern, durch die sie auch soziale Regeln lernen, wobei es schon immer ein Problem für Forscher war, diese Routinen zu erkennen. Besonders fixe, formelhafte Routinen sind leichter zu entdecken. Im Deutschen sind dies z.B. Dinge wie ‚Was ist das?‘ – ‚Das ist…‘, viele Höflichkeitsfloskeln und Wortspiele, die man mit den Kindern spielt. Bei diesen erkennt das Kind, sobald es sie gelernt hat, welche Antwort bei einer Äußerung gefordert ist, manchmal auch unterstützt durch Intonation. Allein durch die Intonation schon erkennt der Erwachsene später dann meist eine Verabschiedungsfloskel. Oft sind die Sprecher einer Kultur sich aber selber nicht mehr bewusst, dass solch eine Routine besteht, was wieder zu dem Problem des Forschers gehört. Routinen helfen dem Kind auch anders eine Sprache zu lernen. Hat es z.B. einen Teil einer Äußerung nicht verstanden, kann es diesen Teil bei häufiger Wiederholung derselben Äußerung wesentlich leichter lernen. Andere Routinen fordern von dem Kind Aufmerksamkeit, welche die Lernfähigkeit erhöht. Werden Routinen minimal verändert, kann das Kind diese Veränderungen leichter lernen. Oft werden Routinen mit wachsendem Alter und Aufnahmefähigkeit des Kindes erschwert und komplizierter; einige Kulturen beginnen z.B. mit einer vereinfachten Sprache, dem Babytalk.
Ein Beispiel für eine Routine, in der die Mutter dem Kind gleichzeitig sprachlichen Ausdruck beibringt, ist das Folgende:
(1) Von Peters & Boggs (1986: 85)
You go show mommy. Betonung auf ’show‘
Show mommy. Reduktion
Show mommy whatcha talking about Erweiterung/Variation
Birdie birdie. Wiederholung
usw.
Hier sieht man einige der Variablen, die Peters & Boggs aufstellen, wie Betonung, Reduktion und vor allem auch Wiederholung. Ganz langsam werden hier dem Kind (1;2) sowohl Phrasen als auch Wörter und Routinen beigebracht.
Durch Routinen lernen Kinder meist wie gesagt auch soziale Regeln und kulturelle Umgangsformen, Normen und ähnliches. Ab einem bestimmten Alter können und sollen die Kinder solche Routinen meist selbst initialisieren. Von da ab kann auch von der Formelhaftigkeit zu lockeren und damit komplexeren Formen übergegangen werden.
Laut Crago (1992) wird die Sprachsozialisation erst seit etwa der 1970er untersucht und stammte ursprünglich aus der Ethnographie, weshalb viele Studien sowohl ethnographische als auch (psycho)linguistische Methoden anwenden. Neben der sprachlichen Analyse der Longitudinal-Studien gehören dazu aber natürlich auch Analysen der sozialen Praktiken, Organisation und kultureller Werte.
Nach Ochs & Schieffelin (1984) gibt es ein paar Strategien, die einige Kulturen anwenden, andere jedoch nicht. Zunächst einmal muss nicht die Mutter die Erziehende sein. Wer auch immer erzieht muss auch nicht zwangsweise mit dem Baby sprechen. Sprechsituationen können diadisch (Kind und Erziehender), triadisch (die beiden und eine dritte Person) oder größer sein. Simplifizierte Versionen der Sprache, das sogenannte Babytalk, findet man nicht in allen Sprachen1. Größere Strategien, die vor allem für bereits sprechende Kinder angewandt werden, wollen wir in den Studien unten sehen.
(2) Samoanische Mutter weist Kind an zu reportieren, welches dadurch ein wichtiges Sozialverhalten der Kultur lernt (Ochs & Schieffelin (1984: 297))
a) Mutter fai o Elegoa lea. ‚Sage Elenoa (ist) hier.‘
b) Kind Sego lea ‚Elenoa (ist) hier.‘
Nach Lieven (1994) basieren Universalitätsansprüche den Spracherwerb betreffend meist auf Studien westlicher Mittelklassen, müssen jedoch auch mit anderen Kulturen verglichen werden. Probleme beim Vergleich beruhen meist darauf, dass westliche Studien oft eine große Anzahl Versuchspersonen zu Verfügung haben, andere Studien sich jedoch mit dem meist wenigen begnügen müssen, das gegeben ist. Wie schon gesagt kann daher zumindest in dieser Arbeit auch nicht absolut verglichen werden. Ein zweites Problem ist, dass gleich aussehende Verhaltensweisen nicht unbedingt dieselben Funktionen haben müssen. Dies betrifft uns hier aber nicht, da wir keine Typologie aufstellen wollen; darauf hinweisen werden wir trotzdem. Nach Crago (1992) muss man aber beachten, dass a) Sprachen auch intern Variationen aufweisen können2, b) einige Strategien nur bei einer, viele bei mehreren Kulturen vorkommen und c) sich Sprachsozialisation im Laufe der Zeit auch wandeln kann, was bei vielen Kulturen vor allem unter westlichen Einfluss geschah.
Laut Lieven (1994) basieren die meisten westlichen Studien auf Mutter-Kind-Dyaden, obwohl die meisten Kinder der Welt polyadisch aufwachsen. Dies ist ein Punkt, den wir im Folgenden überprüfen wollen. Andere Punkte die wir betrachten wollen, sind: Wie die verbale Umgebung des Kindes aussieht, also ob (normal oder mit Babytalk3) zu ihnen gesprochen wird oder ob sie sonstige Einflüsse haben; ob und wenn ja wie stark sich auch andere Kinder und Geschwister mit den Kindern beschäftigen; ob die Eltern der Meinung sind, Sprache müsse man direkt beibringen und in welchem Umfang die Erziehenden Direkte nutzen; welche Sprachsozialisatierungsstrategien verwendet werden.
3. Die Studien
Westliche Kulturen und Sprachen, vor allem aber das Englische und auch das Deutsche, wurden häufig genug in der Geschichte der Spracherwerbsforschung untersucht. Ihre Sozialisationierungsstrategien legen meist (wenngleich es auch regionale und soziale Unterschiede gibt) den Fokus auf das Individuum, sein Selbstbewusstsein, Umgang mit Spielsachen, seltener auch noch auf christliche, moralische oder sonstige Werte sowie einfache Höflichkeitsformen. Sie scheinen oft das Gegengewicht zu bilden gegenüber Kulturen, die mehr Wert auf die gesamte Gesellschaft legen. Nach Crago (1992) wurden früher vor allem Experimente angewendet etwas über den Spracherwerb herauszufinden, wozu die Kinder (und vielleicht ihre Erzieher) in ein absolut unnatürliches Umfeld kamen und oft für ihre Kultur unpassende Handlungen durchführen mussten. Hat eine Kultur z.B. keine Spielzeuge, macht es kaum Sinn die Kinder spielen zu lassen um zu sehen, wie sie damit umgehen.
Im Folgenden sollen Studien den Vorrang haben, die wenig untersuchte Sprachen und Kulturen betreffen bzw. solche, die nicht im normalen Fokus liegen. Dazu gehören z.B. sogenannte Eingeborene der ‚Dritten Welt‘ ebenso wie Japaner und Chinesen. Es wird keine spezielle Reihenfolge verfolgt.
3.1. Inuit: Soziale Tradition vs. Individuelle Moderne
Crago et. al. (1993) untersuchten, wie sich durch kulturelle Wechsel die Sprachsozialisation der Inuit änderte. Damit bietet ihre Studie Ergebnisse sowohl zu den klassischen als auch zu den modernen Inuit und soll hier den Bogen schlagen von klassischen westlichen Studien hin zu den anderen.
Inuit sind die Eskimos Kanadas und Grönlands. Crago et. al. untersuchten die östlichen Völker Kanadas, die Inuktitut sprechen. Dies ist eine eskimo-aleutische Sprache und in einem Territorium Kanadas anerkannte Minderheitensprache. Sie ist polysynthetisch, d.h. ein Wort stellt oftmals einen ganzen Satz dar, weshalb ‚Wörter‘ nur selten mehrmals vorkommen. Inuktitut ist Erstsprache der Inuit, die auch in Schule und Bürokratie genutzt wird.
In ihrer Studie betrachteten Crago et. al. vier Inuit-Kinder aus zwei Orten in Quebec: Sie nahmen 80 Stunden Videoaufnahmen der Kinder samt Familien in möglichst natürlicher Umgebung4, 20 Interviews mit anderen Inuit-Frauen und ihre persönlichen Notizen in den Jahren 1985 bis 1987 auf. Die Kinder waren gleichmäßig männlich und weiblich verteilt und zwischen 12 und 24 Monaten alt. Familienzusammensetzungen und Kinder waren recht unterschiedlich und komplex, daher nur schwach vergleichbar, aber bei der Studie ging es auch eher um Tendenzen; wie in dieser Arbeit. Grundsätzlich aber gab es pro Dorf je eine junge Mutter mit Sohn bzw. Tochter sowie eine alte Mutter mit adoptiertem Kind. Die älteren Frauen lieferten dabei für diese Studie hauptsächlich Erkenntnisse betreffend der traditionellen Inuit, derweil die jungen Frauen von der Kultur Kanadas und Quebecs beeinflusst waren. Die älteren Mütter waren einst in Iglus geboren worden, die jüngeren dagegen in Häusern, haben die Schule besucht und sprachen auch Englisch oder Französisch.
Crago et. al. beobachteten verschiedene Sprachsozialisierungsstrategien und ihre Wandlungen der Inuit. Eine davon ist das sogenannte Aqausiit. Dies sind rhythmische Verse, die Mütter ihren Babys vorsingen, wobei jede Mutter eigene Nonsens-Wörter nutzt. Aqausiit zeigt dem Kind die Liebe der Mutter und ist interaktional; die Kinder reagieren mit Freude auf ihre jeweiligen eigenen Lieder. Diese Tradition scheint jedoch zumindest anhand der Daten der Studie so gut wie ausgestorben; nach Crago et. al. nutzte keine der beobachteten Mütter dies und einige junge Mütter wüssten nicht einmal, was das sei. Aqausiit war aber eine frühe Form der Kommunikation zwischen Mutter und Kind; mit Babys wurde also schon gesprochen.
Eine zweite dem verwandte Strategie ist das Nilliujuusiq, das mit lauter Stimme gesprochen wird und ebenso Liebe ausdrückt. Oft werden hierbei Nonsens-Silben an sonst grammatische Konstruktionen gehängt. Dieses Sprechen wird auch heute noch von Jüngeren genutzt, doch eher selten.
Es liegen keine weiteren Informationen vor, wie sich Aqausiit und Nilliujuusiq weiter auswirken. Auf jeden Fall aber sind es eine spezielle Formen der Mütter früh mit ihren Kindern in einer eigenen Sprachform zu sprechen. Das Inuktitut hat auch ein sogenanntes Babytalk mit Babywörtern. Es gibt keine individuellen sondern nur kollektive Babywörter, die phonologisch einfacher sind als normale Wörter. Interessanterweise ist die Nutzung ausschließlich altersgebunden und endet mit 3 bis 3,5 Jahren. Allerding ist die Verbreitung sehr unterschiedlich. Vor allem jüngere Frauen scheinen der Ansicht zu sein, dass man mit den Kindern eher wie mit Erwachsenen reden sollte, während die älteren der Meinung sind, Babytalk sei einfacher zu verstehen für die Kinder.
Eine weitere Besonderheit der Inuit-Kultur ist es, dass die Kinder nicht dazwischen reden sollen, wenn Erwachsene sprechen. Auch diese Tradition scheint der Vergangenheit anzugehören, da die Kinder jüngerer Mütter in der Studie oft dazwischen sprachen und Fragen stellen durften. Daraus erklärt sich, dass traditionell die Fragen von Kindern oft auch einfach grundsätzlich ignoriert wurden, da sie Erwachsenen keine Fragen stellen sollen. Auch wenn sie schreien wird sich selten erkundigt, warum sie das tun. Die Jüngeren dagegen benutzten lieber rhetorische und Testfragen um die Kinder zu unterrichten. Die Älteren sprechen also mit jungen Kindern vereinfacht aber ignorieren ihre Fragen; erwarten, dass die Kinder verstehen. Die Auffassung, wann ein Kind sprechen kann, ist unterschiedlich zwischen den Generationen. Ältere sagen, Kinder haben eine Sprache gelernt, wenn sie verstehen können, derweil den Jüngeren die Produktion reicht.
Leider bietet die Studie hierüber nur wenig Informationen, doch auch die Inuit wollen, dass die Kinder ein nützlicher Teil der Gesellschaft werden, wofür sie auch Direktive nutzen. Diese sind imperativ und sollen eine Handlung auslösen.
Junge Mütter lassen ihre Kinder oft Handlungen imitieren um sie ihnen so beizubringen und sprechen auch öfter Englisch mit ihnen, was die älteren Frauen nicht tun. Höflichkeitsformen scheinen den Kindern erst in der Schule beigebracht zu werden; bis dahin sind sie reichlich ‚unhöflich‘.
Fazit: Aqausiit ist fast ausgestorben. Jüngere Frauen sind gegen Babytalk, ältere dafür; außerdem sind die Meinungen gegensätzlich beim Fragestellenlassen von Kindern. Junge Mütter achten auf Produktion, ältere auf Perzeption. Kurz gesagt: Jüngere Mütter sind stark von Kanada beeinflusst, die älteren zeigten dafür die traditionellen Sichtweisen.
3.2. Kwara’ae: Soziale Kompetenz in der Egalität
Watson-Gegeo & Gegeo (1986) untersuchten das Volk der Kwara’ae auf die Frage hin, welche kommunikative Kompetenz den Kindern warum und wie beigebracht wird und konzentrierten sich dabei auf die Strategien des Ausrufens und Wiederholens, die besonders wichtig für die Sprachsozialisation dieser Kultur sind.
Die Kwara’ae der Salomonen des Pazifiks (nahe Papua Neu-Guinea) sprechen die ebenso benannte Sprache, eine austronesische. Nach Watson-Gegeo & Gegeo sind sie konservativ, traditionell, sprachbewahrend und deshalb weniger stark gefährdet von fremdsprachlichen und -kulturellen Einflüssen. Sie sind egalitär und haben kein Oberhaupt, lediglich innerhalb der Familie stehen Ältere über den Jüngeren. Die Eltern überwachen ein älteres Kind, welches wiederum auf die kleineren aufpasst. Früher waren vor allem die Mütter Haupt der Erziehung, während es heutzutage auch genauso oft die Männer sind.
In der Studie betrachteten Watson-Gegeo & Gegeo in insgesamt 13 Monaten der Jahre 1978, 1979 und 1981 das Volk in ihren Dörfern und Hütten. Im letzten Jahr nahmen sie auch 80 Stunden Sprachmaterial von fünf Familien aus drei Dörfern auf. Die Aufnahmen fanden zu verschiedenen Tageszeiten statt und waren je ein bis zwei Stunden lang, dazwischen lagen dann zwei bis vier Wochen. Alle Situationen und Möglichkeiten können also nicht erfasst worden sein. Zusätzlich führten Watson-Gegeo & Gegeo aber auch Interviews durch; zweimal mit den fünf Familien, einmal mit fünf anderen Familien. Die Fragen betrafen u.a. Kindererziehung und Familiengeschichte. Insgesamt wurden 24 Kinder zwischen 6 Monaten und 15 Jahren aufgezeichnet sowie einige andere derselben Altersgruppe einmalig.
Entsprechend der Egalität werden Kinder dazu erzogen, weniger auf ihre eigenen Gefühle sondern mehr auf das Wohlergehen der Gruppe zu achten. Babys lässt man sprechen, indem man die Geräusche, die sie von sich ergeben, ‚übersetzt‘, somit für sie spricht, auch schon in triadischen Situationen. Ab 6 Monaten sprechen sie in einem Babytalk direkt zu den Kindern. Ab 9 bis 10 Monaten nutzen sie auch andere, unten beschriebene Strategien; etwa bis 2,5 Jahren. Ziel ist es, den Kindern das Sprechen und gleichzeitig Verhaltensnormen beizubringen. Ab etwa 3 Jahren sind die Kinder dann bereits sehr selbständig und helfen auch den Eltern in Haushalt und Garten, nutzen Erwachsenensprache. Durch viele Imperative, Erklärungen und Korrekturen wird ihnen das sozial richtige Verhalten beigebracht, was etwa bis 5 Jahren dauert.
Unter Erwachsenen werden Ausrufe für praktische Zwecke, Identifizierungen und als soziale Grüße genutzt; allesamt wichtige tägliche soziale Routinen, welche die Gesamtheit zusammenhalten und Frieden wahren. Das Ausrufen hat meist eine spezielle Intonationsstruktur und emphatische Partikel. Für Kinder wird es anfangs genutzt um sie abzulenken, z.B. vom Schreien, wobei sie dem erstmalig ausgesetzt sind. Dazu beschreibt der Erzieher dem Kind z.B. ein Objekt oder stellt ihm Fragen, wobei ein höherer Akzent benutzt wird und die Stimme meist eher sanft und freudig, also spielerisch ist. Dies sind auch die Unterschiede zum erwachsenen Ausrufen. Ab 18 Monaten etwa können die Kinder auch selber ausrufen und fangen an es als Spiel zu betreiben. Später wird zusätzlich noch ein Frage-Antwort-Spiel eingebaut. So wird den Kindern also früh das Ausrufen beigebracht.
(3) Erste Ausrufübungen: Mutter zeit Baby wie man älteres Kind ruft (Watson-Gegeo & Gegeo (1986: 20))
aok ‚uan sal / Sala! Sal! lae mai‘ tua hain Mosa
Ruf zu Sala / Sala, komm und passe auf Mosa auf!
Ausrufe sind auch wichtig für Kinder die ‚richtige‘, unterliegende Form von Wörtern zu lernen, da im Kwara’ae Metathesen häufig sind und beim Ausrufen oft beide Formen gleichzeitig benutzt werden, vor allem wenn eine nicht deutlich genug war.
Beim Wiederholen geben die Erziehenden den Kindern ein Imperativ der Art ‚Sage…‘ gefolgt von dem, was zu wiederholen ist. Es wird meist tieftönig und leise gesprochen. Damit bringt man Kindern vor allem soziales Verhalten bei, wie Grüße und Verabschiedungen, die ebenso wichtig für die gesellschaftliche Harmonie sind, was wiederholt wird, bis es das Kind richtig sagt. Klappt dies trotzdem nicht, wird das zu Wiederholende zerlegt bis es klein genug für das Kind ist, um es zu verstehen. Aus ‚Sage das ist ein Stock‘ wird ‚Sage das Stock‘. Da solche Fragen eine bestimmte Intonationskontur haben, lernen die Kinder oft diese allein schon zu erkennen. Das wird sowohl diadisch genutzt als auch triadisch um dem Kind zu zeigen, was es antworten soll.
Weiterhin unterhalten sich zwei Erwachsene oft über Kinder, indem sie diese antworten lassen. Dabei lernen die Kinder den Umgang mit Älteren und mit Gleichgestellten, sich durchzusetzen, Höflichkeitsformen etc. Und vor allem müssen so die Älteren nicht direkt miteinander reden, was bei negativen Antworten zu Streit führen könnte.
Ab 3 Jahren sind sämtliche Vereinfachungen und speziellen Intonationsmuster verschwunden, Kinder und Erwachsene unterhalten sich beide wie Erwachsene.
Fazit: Die Kwara’ae legen großen Wert darauf, dass Kinder ordentlich sprechen lernen und sich in die Gesellschaft schnell als wertvolles, doch gleichwertiges Mitglied einfügen. Wichtig sind hierzu vor allem die Strategien des Ausrufens und der Wiederholung, die mit zunehmendem Alter immer komplizierter werden.
3.3. Basotho: Sprache als Überlebensmittel
Demuth (1986) untersuchte, wie Basotho-Kinder Verhaltensnormen lernen und dieses ihnen gleichzeitig zur Sprachlehre beigebracht werden.
Die Basotho leben in Lesotho (südliches Afrika, ausgesprochen als Desotho) und sprechen Sesotho. Dies ist eine Bantusprache mit begrenztem Phoneminventar und wie alle Bantusprachen mit Nominalklassen ausgestattet.
In ihrer Studie untersuchte Demuth 2 präverbale Kinder sowie sieben weitere im Alter zwischen 25 Monaten und 7 Jahren. In 5-Wochen-Intervallen nahm sie über 14 Monate 3 bis 4 Stunden pro Sitzung auf5. Die Familien leben alle recht eng beieinander, sowohl in den Familien als auch zu den anderen. Männer sind selten daheim, weshalb Mütter, Großmütter und Geschwister für die Kinder sorgen. Dabei werden die Kinder überall mit hin getragen. Interessanterweise bekommen die Basotho in festen Abständen Kinder; sobald das Neue kommt, gilt das Alte als alt genug. Dann benutzt die Mutter mehr Direktive für das ältere Kind, während das neue Zentrum des Haushalts ist.
Zu jungen Kindern wird mit hohem Ton gesprochen, Wörter und Ausdrücke werden oft wiederholt und Ehrbezeichnungen bereits eingeführt. Bei älteren werden häufig Drohungen benutzt, um die Kinder zu kontrollieren. Die Basotho selber sind sich übrigens nicht einig, warum das Kind zu sprechen lernt, sind aber der Meinung, dass man es ihnen beibringen muss; auch, da Sprache ein Mittel zum Überleben ist.
Hierzu benutzen sie vor allem Direktive, die mit einem Imperativ der Form ‚Sage…‘ eingeleitet werden. Sie werden direkt und indirekt, diadisch und triadisch benutzt, meist aber direkt und triadisch. Der Großteil wird einfach nur genutzt um die Kinder zum Sprechen zu bekommen, sie zählen zu lassen und ihnen soziale Verhalten beizubringen, manchmal auch um sie abzulenken, z.B. vom Schreien.
(4) Älteres Kind (5 J.) sagt jüngerem (2J.), was es sagen soll (Demuth (1986: 54))
ere e teng ka mona
sage es ist hier, da drin.
Zusammen mit Fragen testet man die Kinder, ob sie schon sprechen können oder um Informationen zu bekommen. Bei jungen Kindern sind die fragen eher spielerisch, später dagegen wichtige soziale Interaktion. Direktive werden auch benutzt um Höflichkeitsformen zu lehren, was meist in der triadischen Praxis stattfindet. Dazu gehören z.B. Danke, Grüße, Respekt vor Älteren. Besonders letzteres ist den Basotho wichtig und wird deshalb häufig wiederholt.
(5) Mutter lässt Tochter (28 Monate) danken (Demuth (1986: 62))
ere danki6 me ‚Sag ‚Danke, Mutter“
Und die Tochter wiederholt es
danki me ‚Danke Mutter.‘
Andere wichtige soziale Funktionen wie das Geschenke verteilen werden oft auch durch Geschichtenerzählen beigebracht, in denen Direktive vorkommen. Die Kinder müssen lernen den entsprechenden Kontext richtig zu interpretieren. Eine triadische Situation findet oftmals auch statt, indem die Erwachsenen durch das Kind sprechen, ähnlich wie im Kwara’ae. Besonders mit jüngeren Kinder werden die Direktive oft in Form von Wortspielen gestaltet, die auch unterhalten sollen. Letztlich werden die Direktive auch ’normal‘ benutzt um den Kindern in ihrem täglichen Leben zu zeigen, was sie tun sollen.
Fazit: Für die Basotho ist es lebenswichtig, sprechen zu lernen. Von Geburt an haben ihre Kinder viele Gesprächspartner und ihnen wird viel Aufmerksamkeit geschenkt. Wichtig zu lernen sind vor allem korrekte soziale Formen. Weiter werden Direktive auch genutzt das Verhalten zu kontrollieren, verbale Routinen zu lernen, zu amüsieren und selten zur Korrektur.
3.4. Kaluli: Das Gleichgewicht der Gesellschaft bewahren
Schieffelin (1986) untersuchte die Sprachsozialisation der Kaluli, vor allem deren wichtigste Strategien: Necken und Beschämen (teasing & shaming).
Die Kaluli leben im Regenwald von Papua Neu Guineas Hochländern. Sie leben in etwa 20 Dörfern und sind egalitär, also ohne Anführer. Fast alle sprechen nur Kaluli, eine isolierte Sprache. Ihr tägliches Leben besteht größtenteils aus verbaler Manipulation und Sprache ist daher wichtiges soziales Werkzeug. Schieffelin nahm für ihre Studie 83 Stunden spontaner Familieninteraktionen auf.
Die Kaluli vermeiden physische Mittel andere zu beeinflussen, nutzen dafür aber stark das Necken und Beschämen. Sie sagen, man kann nicht wissen, was andere Menschen denken, also auch nicht empathisch sein7. Deshalb versuchen sie so zu sprechen, dass der Gesprächspartner seinen Wünschen folgend aus der Interaktion herauskommen kann; die meisten Äußerungen sind ambig.
Laut Ochs & Schieffelin (1984) sehen die Kaluli Babys als hilflos an und müssen daher für sie sorgen. Mütter lassen ihre Kinder niemals allein, behandeln sie aber auch nicht als Kommunikationspartner, da sie angeblich nicht verstehen können. Sie sollen ihre Kinder in einem Netz vor dem Bauch tragen, so dass die Kinder in dieselbe Richtung wie die Mutter blicken. Besonders andere Kinder grüßen und sprechen auch mit dem Baby, derweil die Mutter für dieses antwortet, allerdings nicht um dem Baby etwas beizubringen, sondern dem älteren Kind. Die Babys haben also ein reiches verbales Umfeld, ohne dass aber jemand mit ihnen direkt spricht. Erst wenn sie zwei bestimmte Schlüsselwörter sprechen können, gelten sie als sprachbegabt.
(6) Mutter spricht für Baby (nach Ochs & Schieffelin (1984: 289))
Mutter hält dreimonatigen Sohn.
a) Älteres Kind spricht zu Baby:
Bage – ni bokisi we badaya? – olibadaya?
B. – Siehst du meine Box hier? – Siehst du sie?
b) Mutter antwortet in hoher nasaler Stimme für Baby:
nao, hɛbɔ ni diɛni, nao.
Mein Bruder, Ich werde die Hälfte nehmen, mein Bruder.
Danach gibt die Mutter dem älteren Kind noch eine direktive Anweisung in normaler Sprache. Im späteren Alter wird ihnen im Stil ‚Sage…‘ mehr beigebracht, wobei sie aber kein Babytalk benutzen. Die Kaluli korrigieren allerdings falsche Äußerungen sehr häufig.
(7) Direktiv der Mutter (nach Ochs & Schieffelin (1984: 292))
Mutter lässt jüngsten Sohn der ältesten Tochter etwas sagen:
abɛnowo? ɛlɛma ‚Wessen ist es? Sag es so.‘
Und der Sohn wiederholt:
abɛnowo? ‚Wessen ist es?‘
Nach Schieffelin (1986) wird Necken und Beschämen ab etwa 6 Monaten angewendet. Solche Vorgänge bestehen anfangs zunächst aus ’neckischen‘ Beleidigungen wie ‚Idiot‘, was allerdings durch ein Lachen o.ä. abgeschwächt wird. Die Eltern wollen das Kind sanft necken, es ist niemals das Ziel es wirklich zu beleidigen oder gar zu verletzen. Ab etwa 3 Jahren wird das Necken ernster, später werden auch spöttische Tricks angewendet. Ab etwa 30 Monaten setzen die Kinder diese Techniken auch selber ein; sogar gegenüber Erwachsenen. Manchmal wird es auch soweit getrieben, dass das Kind anfängt zu weinen, woraufhin es aber sofort getröstet wird.
Wichtig sind für die Kaluli auch rhetorische Fragen, die oft ambig sind und ebenso den Gegenüber beeinflussen sollen. Diese Fragemuster werden den Kindern bereits früh beigebracht, indem die Mutter eine rhetorische Frage anbringt und sofort die dafür erwünschte physische Handlung vollführt. So könnte eine Mutter z.B. zu einem Kind, dass auf einen Baum klettern will sagen ‚Bist du ein Vogel‘ und es danach sofort aus dem Baum nehmen. In triadischen Situationen wird den Kindern dabei durch imperative Direktive gezeigt, wie sie mit einer rhetorischen Frage zu antworten haben. Ab etwa 14 Monaten wird den Kindern expliziter gesagt, wie sich in bestimmten Situationen zu fühlen haben und gleichzeitig durch eine drohende unwillkommene Situation sie beschämt sein lassen; meist vor einer dritten, nicht anwesenden Person. Die Kaluli drohen so gut wie nie damit, dass sie selber es sind, denen es missfällt.
Fazit: Die Kaluli sind eine egalitäre Gesellschaft, in der, um das Gleichgewicht des Miteinanderauskommens zu bewahren, vor allem ambige rhetorische Fragen genutzt werden. Den Kindern werden diese rhetorischen Fragen durch Necken und Beschämen beigebracht, die ihnen zeigen, was sozial akzeptabel ist und was nicht und wie sie sich selber durchsetzen können.
3.5. Japanisch: Soziale Unterwürfigkeit
Clancy (1986) führte eine Studie des Japanischen durch um zu sehen, wie Kindern beigebracht wird, wie sie in ihrer Gesellschaft ihre Sprache zu nutzen haben und wie diese ihre Weltsicht beeinflusst.
Japanisch ist eine isolierte Sprache, die eventuell mit Koreanisch und weiteren altaischen Sprachen verwandt sein könnte, ihre Einflüsse jedoch hauptsächlich aus dem pazifischen Raum nimmt. Zwar wachsen die westlichen Einflüsse in Japan, trotzdem ist die Gesellschaft immer noch traditionell. Die Japaner kommunizieren intuitiv und indirekt, benutzen eher ihre Empathie denn explizite Äußerungen (Fragen wie es geht und spontane Äußerungen der Befindlichkeit), was sich auch in ihrem Sprichwort ‚Schweigen ist besser denn Sprechen‘ zeigt. Daraus ergibt sich auch, dass sie weniger sprechen, oft Nominal-Ellipsen nutzen, ihre Äußerungen ambig halten und Sätze erst im letzten Moment negieren können, sollte dies notwendig sein. Höflichkeitsformen sind wichtig und ein hohes Ziel ist die soziale Harmonie, für die das Individuum zur Not auch leiden muss: Oft werden eher sozial akzeptierte Äußerungen getätigt denn ihre wahren Gefühle, z.B. Dank bei Geschenkannahme obwohl es einen verärgert. Direkt Nein wird selten gesagt, es gibt aber viele Wege dieses auf andere Art auszudrücken. Individuen müssen interpretierbar und daher sozial konform sein; Gefühle und Wünsche müssen sofort erkennbar sein.
Japanische Mütter sprechen mit 3-4 Monate alten Kindern selten, doch kümmern sich fast pausenlos um sie, vor allem wenn es ihnen an etwas fehlt. Die Mütter wollen die Gefühle ihrer Kinder verstehen. Älteren Kindern bringen sie korrektes soziales Verhalten bei und korrigieren falsches; Höflichkeit soll Fremden, jedoch nicht den Müttern dargebracht werden. Dies ist ein interessanter Punkt. Es bindet die Kinder besonders stark an die Mutter und lässt ihnen eine relativ ungezwungene Kindheit zukommen, derweil das Alter sozial konform sein muss.
In ihrer Studie untersuchte Clancy fünf Kinder um 2 Jahre und nahm hierzu die Interaktionen der Mutter und des Kindes auf; nur im Haushalt, doch auch in triadischen Situationen. Die Väter hatten gute Karrieren und waren selten zuhaus. Clancy war stets bei den Interaktionen anwesend und wurde selten auch mit einbezogen, vor allem wenn die Mütter triadische Verhalten üben wollten.
Den Müttern ist es wichtig, dass ihre Kinder gute Zuhörer werden, um den Sprecher verstehen zu können und Fragen zu beantworten. Dabei bleiben sie solange hartnäckig, bis das Kind mitmacht. Mit jedem Versuch wird sie dabei nachdrücklicher, sogar alarmiert. Sehr häufig werden Direktive verwendet, meist direkt und nachdrücklich. Andere lassen Freiraum bei der Reaktion. Diese Direktive sollen Kinder verstehen lassen, da sie später nie wieder so ausdrücklich mitgeteilt bekommen, wie sich etwas verhält. Mit 2 Jahren können die Kinder diese auch bereits selbst einsetzen. Eine andere Möglichkeit für Direktive bietet sich, wenn soziales Verhalten geübt werden soll.
(8) Clancy fragte ein Kind, ob es ihr etwas zeigen könnte, doch es reagierte nicht. Die Mutter weist es an zu reagieren (Clancy (1986: 221))
sa, hayaku. Patricia-san misete tte yutteru yo. Isoganakucha. Isoganakucha. A! A!
Los, schnell. Patricia sagt ‚Zeig es mir‘. Du musst dich beeilen. Du musst dich beeilen. Oh! Oh!
Auch Imperative der Form ‚Sage‘ werden häufig benutzt.
Oft setzten die Mütter auch rhetorische Fragen ein, welche die korrekte Antwort schon in sich bargen. Manchmal versuchen Mütter den Kindern auch rational zu erklären, warum sie etwas so und nicht anders tun sollen; die Kinder sollen verstehen können. Versteht das Kind eine indirekte Anweisung nicht, wird die Mutter direkter. Meist paraphrasiert sie auch, allerdings auch dann, wenn das Kind schon verstanden hat.
Kinder sollen die Gefühle anderer verstehen, wozu die Mütter oft ein Spiel einsetzen, bei welchem das Kind Gastgeber einer imaginären Teeparty ist, bei denen das Kind lernt einfache Äußerungen als Imperative zu verstehen. (‚Ich würde gerne lesen‘ = ‚Gib mir die Zeitung‘). Diese ‚Teepartys‘ üben das, was den kleinen Kindern noch allein durch Direktive beigebracht wurde, die jetzt weniger stark vorkommen.
Weiter werden ihnen kleine Kinder und Tiere als süß dargestellt; sie sollen gut zu ihnen sein. In triadischen Situationen sagen die Mütter den Kindern, was die andere Person will, damit die Kinder dies verstehen. Ist keine dritte Person da, wird eine vorgestellt, und wenn es nur ein Stein ist (‚Herr Apfel sagt aua‘).
Auch Verhaltens- und Sprechnormen werden den Kindern beigebracht, sowohl subtil als auch explizit. Jede Situation wird dabei genutzt, dem Kind etwas beizubringen. Meist wird dem Kind erzählt, warum es in einer Situation beschämt sein sollte, z.B. weil seiner Mutter eine Handlung Angst machte. Auch das Necken findet man im Japanischen; es soll die Emotionen hervorrufen, die erwartet werden.
Andere Fakten sind, dass japanische Kinder selten bestraft werden und meist, solang sie klein sind, machen können was sie wollen. Weiter wird den Kindern beigebracht wie sie es vermeiden können Nein sagen zu müssen. Die Mütter beschützen durch Prohibitionen ihre Kinder nicht nur vor Verletzungen, sondern auch um Konflikte zu vermeiden.
Laut Cook (2008) lernen die Kinder Höflichkeitsformen größtenteils erst spät, in der Schule. Bei Clancy kommt dieses Detail auch kaum vor. Geschlechtsunterschiede bei der Erziehung gibt es eigentlich keine, meist erst im Zusammenhang mit Spielkameraden.
Fazit: In Japan ist das Individuum ein Teil des Ganzen, muss konform sein und sich in die anderen hineinfühlen, um die Harmonie erhalten zu können. Beigebracht wird ihnen dies bereits als Baby; Erweiterung findet es durch verschiedene spätere Strategien.
3.6. Taiwan: Autoritäres Beschämen als Moralerziehung
Fung (1999)8 untersuchte taiwanesische Familien auf ihre Nutzung der Beschämung und wie diese die Moralvorstellungen der Kinder prägt und beeinflusst.
In der chinesischen Kultur ist Scham wichtig, was man auch schon an den zahlreich vorhanden Ausdrücken merkt. Ein Großteil konfuzianischer Lehren beruht auf Scham, da diese wichtig für Moral und Normen ist; das Individuum soll sich schämen, wenn es falsch handelt, was oftmals auf eine ganze Gruppe übertragen wird. Chinesische Eltern sind größtenteils der Meinung, dass ihre Kindern lernen sollen sich zu schämen. Die meisten dieser Eltern haben hohe Erwartungen an ihre Kinder und verfolgen eine autoritäre Erziehung.
In ihrer Studie untersuchte Fung Familien in ihrer Heimat Taiwan in Taipeh. Ein Großteil der Bewohner dieser Insel stammt von Chinesen ab, die in verschiedenen Immigrationsschüben kamen, zuletzt vor wenigen Jahrzehnten. Mandarin ist die offizielle Sprache und konfuzianische Lehren sind wichtig, wenngleich die meisten Taiwanesen Taiwanesisch sprechen, einen chinesischen Dialekt, um nach westlichen Vorbildern zu leben. 9 Mittelklasse-Familien nahmen teil, wobei jeder Haushalt aus zwei Generationen bestand: Eltern und Kindern. Tanten und Großmütter halfen aber oft bei der Kinderaufsicht. Die Familien sprachen gänzlich Mandarin, ein Teil auch Taiwanesisch. Die Väter hatten universitäre Abschlüsse und gingen ihren Arbeiten nach, während nur die Hälfte der Mütter auch arbeitete. Interessanterweise hatten alle Familien dieselbe Art von Apartment.
Fung führte eine Longitudinal-Observation durch, ergänzt um Interviews mit den Erziehenden. Die Kinder wurden bei der familiären Interaktion auf insgesamt 140 Stunden Video aufgenommen und später analysiert. Selten wurde Fung auch Teil der Interaktionen. In ihrem Bericht beschränkt sie sich aber größtenteils auf die Kinder, die am meisten sprachen.
In einem Interview mit den Eltern fand Fung heraus, dass alle Eltern Scham mit Moral verbinden und eine glückliche Kindheit als höchstes Ziel ansehen, neben der guten moralischen Erziehung. Eltern versuchen ihre Kinder zu verstehen und ziehen auch Literatur heran um als Eltern ‚ausgebildet‘ zu werden. Auch der soziale Aspekt fehlt nicht: Eltern werden stolz, wenn ihre Kinder vor Dritten eine gute Figur machen. Nach der Ansicht der Eltern müsse Liebe mit Disziplin verbunden werden, ansonsten würde man die Kinder zu sehr verwöhnen und damit verderben. Jedoch dürfe es auch nicht zuviel sein. Die Kinder sollen zuhören und auch gehorchen können; jedoch auch verstehen, weshalb Schandtaten explizit erklärt werden. Dieses immer dann, wenn etwas entsprechendes geschehen ist, und nicht später an abstrakten Beispielen, welche die Kinder eh nicht verstehen könnten. Obwohl sie gehorchen sollen, dürfen die Kinder auch ihre Gefühle ausdrücken.
Scham wurden die Kinder vor allem dann ausgesetzt, wenn sie etwas falsch taten. Die Mittel dazu waren sowohl explizit als auch implizit; erstere besaßen auch explizite Scham-Markierungen. Die sprachlichen und nichtsprachlichen Mittel waren dabei reichlich. Auch Geschwister des Kindes dürfen beim Beschämen mitmachen; übertreiben sie es jedoch, werden sie bestraft. Oft dauerte das Beschämen sogar noch an, obwohl das Kind bereits sein Fehlverhalten zugegeben hatte, wohl als verstärkende erzieherische Maßnahme. Manchmal beschämten die Eltern das Kind auch ohne Grund, um ihm etwas beizubringen. Fehlverhalten der Kinder entstand größtenteils im Zusammenhang mit sozialem Verhalten, Besitz oder Gesundheit. Beschämung kann ernst oder spielerisch erfolgen, meist letzteres. Wenn die Kinder älter werden, lernen sie auch auf Beschämungen zu reagieren, vor allem wenn diese ohne Grund vorgebracht wurden.
Ein Schamgefühl tritt bei Erwachsenen später dann bei Fehlverhalten oder Versagen auf, wobei sie das Gefühl haben, dass Dritte von ihnen enttäuscht sind.
Scham ist mit 2,5 bei den Kindern bereits gut ausgebildet, wobei das Geschlecht kaum einen Unterschied macht.
Fazit: Scham ist für die chinesischen Taiwanesen ein wichtiges Mittel der Moral und soll sie auf die Welt der Erwachsenen vorbereiten, in welcher die Kinder später sich behaupten müssen; gut und moralisch handeln sollen.
4. Vergleich und Diskussion
Nun haben wir verschiedene, nicht-westliche, nicht-europäische Sprachen und Kulturen betrachtet. Welche Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten und Unterschiede ließen sich finden? Zunächst eine allgemeine Behandlung aufgefundener Formen, Strategien und Ziele.
Es lassen sich verschiedene Formen aufzeigen, wie die erziehende Person mit einem Baby bzw. Kleinkind interagiert. Da gab es das persönliche Singen, liebevolles Zureden, Babytalk, Erwachsenensprache, Übersetzung von Babygeräuschen, Wiederholungen, hochtönige Sprache – sogar gar keine Interaktion lässt sich finden.
Mit älteren Kindern sind die Formen noch diverser: Ignoranz von Fragen, Direktive, rhetorische Fragen, Erklärungen, Korrekturen, Ausrufe mit speziellen Partikeln, Belehrungen, imperative Wiederholungen, Erwachsenenunterhaltungen durch das Kind hindurch, Kontexte interpretieren lassen, Necken, Beschämen, fiktive Teeparties, Wortspiele, andere Spiele, sogar Beschämen mit speziellen Schammarkern.
Auffällig sind dabei folgende Gemeinsamkeiten.
Babytalk ließ sich bei den traditionellen Inuit und den Kwara’ae sehen, bei den anderen Kulturen aber nicht. Diese haben stets vereinfachte Formen. Direktive finden sich bei allen Kulturen, jedoch in verschieden starker Ausprägung (direkt und indirekt, implizit und explizit, stark und weniger stark geäußert). Auch Imperative der Form ‚Sage…‘ finden sich in vielen Kulturen, wobei stets der zu sagende Satz neben einem Imperativ ‚Sage‘ steht. Alle betrachteten Kulturen legen großen Wert auf ein korrektes soziales Verhalten des Kindes; eine Ausnahme hierbei sind die modernen, westlich geprägten Inuit. Rhetorische Fragen nutzen die modernen Inuit, die Kaluli und Japaner gerne. Auch diese sollen korrekte Verhaltensweisen beibringen, deren Art jedoch kulturell unterschiedlich ist. Alle sehen Babys als hilfsbedürftig an und haben sie zumeist mindestens stets überwacht. Auch scheinen alle zu meinen, die Kindern müssten verstehen, warum etwas passiert, oder warum man etwas so und nicht anders sagt. Der Großteil dieser Kulturen nutzt triadische Situationen, um sowohl dem Kind allgemein das Sprechen beizubringen, als auch vor allem Höflichkeitsformen und soziales Verhalten zu erproben. Und letztlich findet man bei den pazifischen Kulturen (Japan, Kaluli, Taiwan) die Scham als wichtiges Mittel den Kindern soziales Verhalten beizubringen. Interessanterweise sind auch in allen Kulturen Frauen zumindest gleichberechtigt mit an der Erziehung beteiligt, tragen sie meist sogar allein.
Unterschiede ergeben sich zumeist schon allein aus den Studien und ihrem Aufbau selber. Die Studien zu Kwara’ae und Kaluli betrachteten die meisten Kinder, in der japanischen Studie waren sie am ältesten, derweil die anderen die Kinder von Kleinauf bis etwa 3 Jahren betrachteten; allerdings treffen sich alle Studien bei 2 Jahren. Zwei der Kulturen (Kwara’ae und Kaluli) sind egalitär, während besonders Japan eine starke Hierarchie besitzt. Während einige Kulturen (v.a. Kaluli) überhaupt nicht empathisch sind, legen andere starken Wert darauf (Japan)9.
Nun zu einigen scheinbar kulturspezifischen Formen. Die traditionellen Inuit besitzen eine Form liebevollen Zusingens, das von den anderen Kulturen nicht belegt ist; es erinnert aber an Schlaflieder der westlichen Welt. Die Kwara’ae nutzen als einzige der hier vorgestellten Kulturen eine Form des Ausrufens, die im täglichen Leben sehr wichtig ist und deshalb schon früh beigebracht wird, wobei die Kinder aber auch schon früh als erwachsen betrachtet werden. Die Basotho nutzen besonders viele Direktive, die Taiwanesen legen als einzige vor allem Wert auf Moral statt nur korrektes soziales Verhalten. Die Kaluli sind die einzigen, die kleine Kinder völlig ignorieren und später stark Necken, um ihnen Möglichkeiten verbaler Manipulation zu vermitteln. Aber auch die Japaner sprechen kaum mit ihren Babys, derweil sie später am stärksten die Scham einsetzen und extremen Wert auf soziales Verhalten legen, wobei die Kinder interessanterweise eine lockerere Sonderstellung gegenüber ihren Müttern halten dürfen. . Die Taiwanesen letztlich sind die einzigen, die einen autoritären Erziehungsstil verfolgen sollen.
5. Fazit
Diese Arbeit betrachtete einige teils grundverschiedene Kulturen auf den Aspekt der Sprachsozialisation hin: Wie erlernen die Kinder spezielle sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten und dabei gleichzeitig soziale Kompetenz? Da die Studien nur einen begrenzten Rahmen überprüfen und beschreiben konnten, kann keine endgültig wahre Aussage vor allem für größere Kulturen wie Japan und Taiwan gegeben werden, da in solch großen Populationen stärkere Variationen innerhalb der Kultur erwartet werden müssen. Auch haben die Studien teils verschiedene Aufbauten gehabt, mit einer unterschiedlich großen Anzahl von Studienteilnehmern und Variationen der Altersstruktur, doch ließen sich immerhin Tendenzen erkennen. Am augenfälligsten ist, das ‚traditionelle‘ Kulturen, also nicht oder nur schwach westliche geprägte, starken Wert auf soziale Kompetenz legen, welche meist eine wichtige Grundlage zum Überleben darstellen. Lediglich die stark westlich geprägten modernen Inuit legen mehr Wert auf individuelle Entwicklung.
Die meisten der Studie sind schon mindestens 10 Jahre alt, manche 20. Daraus ergeben sich einige Konsequenzen. Zunächst einmal könnten sich die Kulturen heutzutage stärker gewandelt haben, zweitens sind die Studien auch wegen der zeitlichen Unterschiede nur schlecht vergleichbar, drittens weißt es darauf hin, dass mehr Studien zu diesem Thema erfolgen müssten, da die Anzahl auch heute noch gering ist. Vor allem aber müssten die Studien eine gemeinsame Basis haben, was z.B. Anzahl und Alter der Probanden sowie die Methoden betrifft, um vergleichbar zu werden. Auch müsste überprüft werden, inwieweit einzelne Formen des Sprachgebrauchs in der Sprachsozialisation überhaupt vergleichbar sind; schon allein die verschieden starken Ausprägungen der Direktive zeigen dies. Ein anderes Problem sind die Faktoren der Schulsozialisation und des Zweitspracherwerbs der kulturell geprägt ist, wenn die Erstsprachkultur eine Minderheit ist. Ein größer angelegtes Projekt müsste dann die Sprachsozialisation mehrerer Kulturen in einer Studie vergleichen, wobei sich da aber das Problem ergibt, wie man unterschiedliche Formen überhaupt vergleichen könnte.
Wir sahen kulturspezifische Formen der Sprachsozialisation aber auch viele, die in allen oder den meisten Sprachen vorkommen, wie z.B. Direktive, eine Mischung von diadischen und triadischen Beziehungen, soziale Werte, Fragen ein besonderer Umgang mit Babys. Nichts hiervon scheint universell zu sein, doch lässt sich auf eine Basis aus der kulturell gewählt wird schließen.
6. Referenzen
- Clancy, Patricia M. (1986): The acquisition of communicative style in Japanese. In: Schieffelin, Bambi B. & Ochs, Elinor (Eds.): Language socialization across cultures. Cambridge University Press 1986.
- Cook, Haruko M. (2008): Language socialization in Japanese. In: Duff, Patricia A. & Hornberger, Nancy H. (Eds): Encyclopedia of Language and Education, Vol. 8: Language Socialization. New York: Springer 2008.
- Crago, Martha B. (1992): Ethnography and language socialization: A cross-cultural perspective. In: Topics in Language Disorders, Vol. 12, No. 3 (May 1992), S. 28-39.
- Crago, Martha B., Annahatak, Betsy, Ningiuruvik, Lizzie (1993): Changing Patterns of Language Socialization in Inuit Homes. In: Anthropology & Education Quarterly, Vol. 24, No. 3 (1993), S. 205 – 223.
- Demuth, Katherine (1986): Prompting routines in the language socialization of Basotho children. In: Schieffelin, Bambi B. & Ochs, Elinor (Eds.): Language socialization across cultures. Cambridge University Press 1986.
- Fung, Heidi (1999): Becoming a Moral Child: the Socialization of Shame among Young Chinese Children. In: Ethos, Vol 27, No. 2 (Jun. 1999), S. 180 – 209.
- Lieven, Elena V. M. (1994): Crosslinguistic and crosscultural aspects of language addressed to children. In C. Gallaway & B. J. Richards (Eds.), Input and interaction in language acquisition. Cambridge University Press.
- Ochs, Elinor & Schieffelin, Bambi B. (1984), Language acquisition and socialization: Three developmental stories and their implications. In R. LeVine & R. Shweder (eds.), Culture Theory: Essays on Mind, Self, and Emotion.
- Peters, Ann M. & Boggs, Stephen T. (1986): Interactional routines as cultural influences upon language acquisition. In: Schieffelin, Bambi B. & Ochs, Elinor (Eds.): Language socialization across cultures. Cambridge University Press 1986.
- Schieffelin, Bambi B. (1986): Teasing and shaming in Kaluli children’s interactions. In: Schieffelin, Bambi B. & Ochs, Elinor (Eds.): Language socialization across cultures. Cambridge University Press 1986.
- Watson-Gegeo, Karen Ann & Gegeo, David W. (1986). In: Schieffelin, Bambi B. & Ochs, Elinor (Eds.): Language socialization across cultures. Cambridge University Press 1986.
————————
Fußnoten:
1Interessant ist dabei auch, dass einige Sprachen eine simplifizierte Version für Ausländer haben, jedoch nicht für Kinder.
2Dies werden wir vor allem an den Inuit sehen.
3 Crago (1992) wies aber bereits darauf hin, dass ein spezielles Babytalk oder ‚Motherese‘ längst nicht in allen Sprachen gefunden wurde.
4Unbekannt ist, ob sie nur Daheim aufgenommen wurden, aber vermutlich schon. Jedenfalls wurden auch triadische Situationen mit anderen Bewohnern der Dörfer aufgenommen.
5Wieder wird nicht erwähnt, wo genau aufgenommen wurde, vermutlich aber Daheim und im Dorf.
6Lehnwort aus dem Holländischen / Afrikaans.
7Starker Gegensatz zum Japanischen.
8Diese Studie ist nur am Rande linguistisch, weshalb sie keine Beispiele bietet und nur in beschränktem Umfang auf die Sprachsozialisation eingeht. Mir schien es trotzdem lohnend diese Studie hier darzustellen.
9Wobei aber auch bei den Kaluli unpassende Gespräche durch ihre ambiguität schnell beendet oder in andere Bahnen gelenkt werden können.